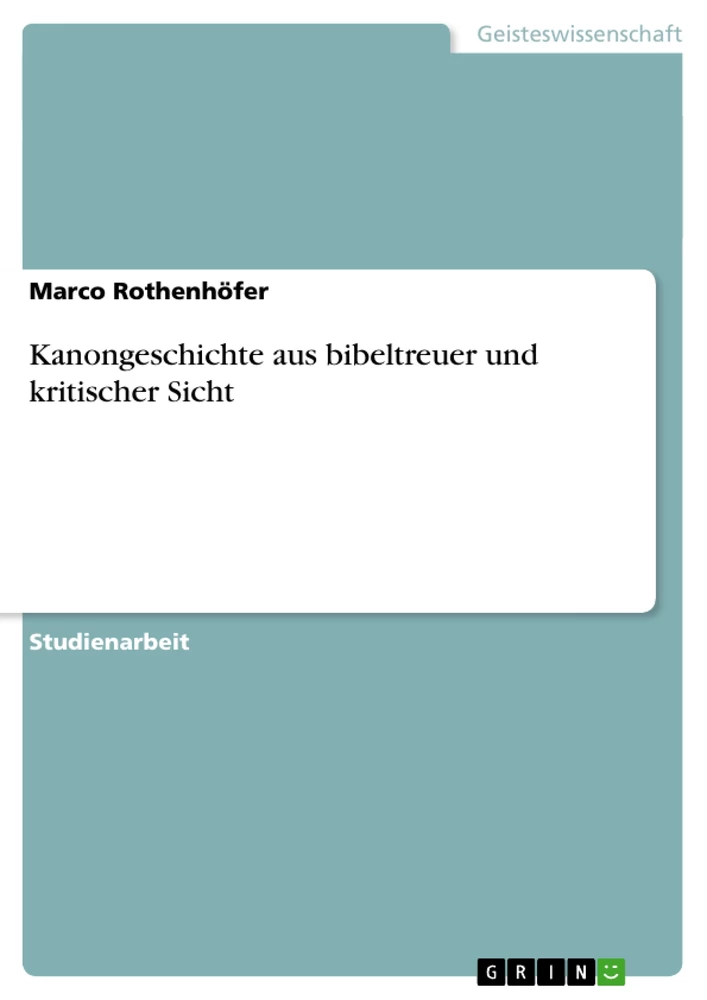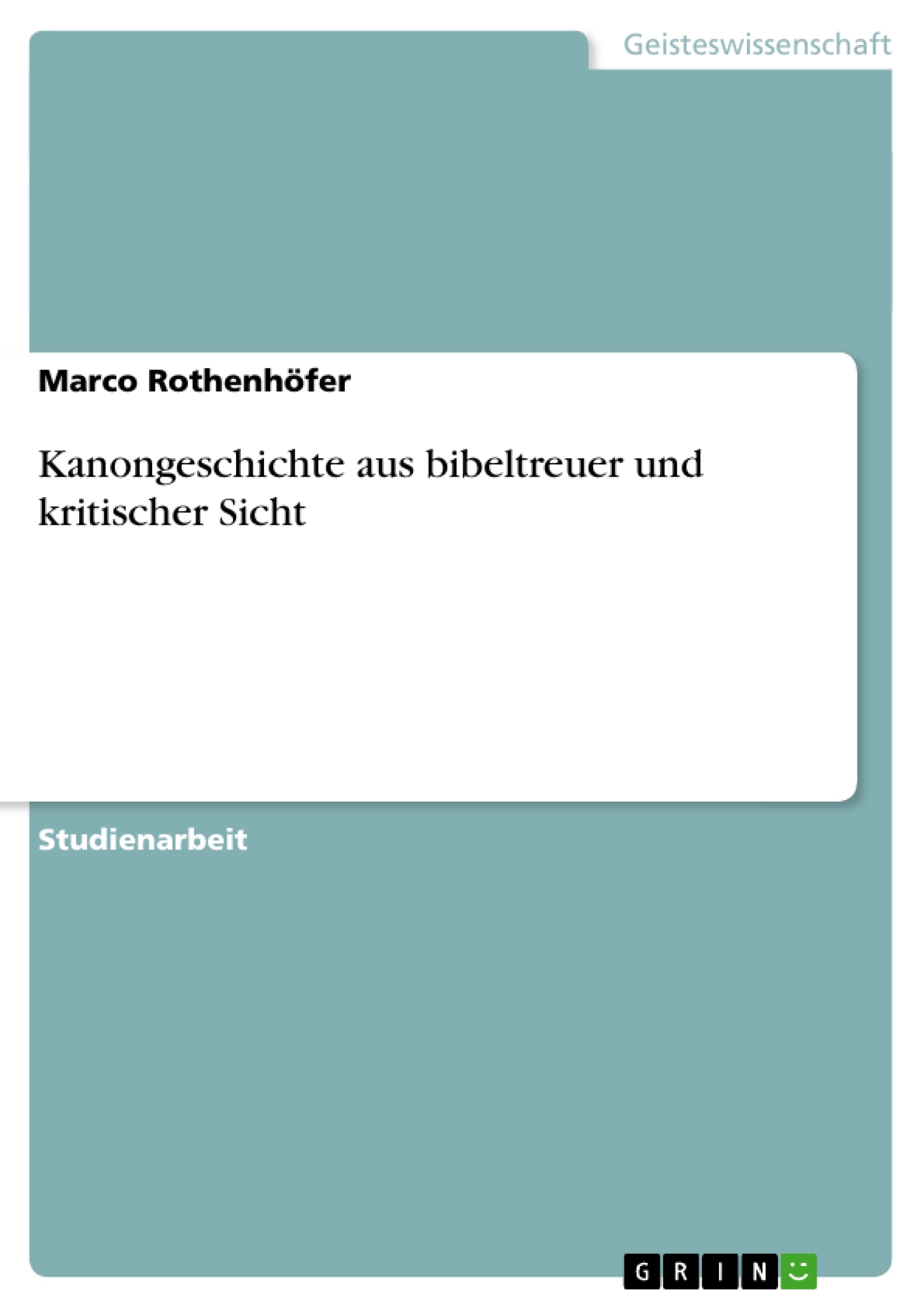Bedeutung des Kanons
Das Wort Kanon, das mit dem semitischen Wort qanä Rohr zusammenhängt und im griechischen Gebrauch mit den Worten ‘gerader Stab‘ wiedergegeben wird, hat in der griechischen Philosophie die übertragene Bedeutung für Richtschnur, Regel und Norm. Dieser übertragene Sinn wird von Philo und der Kirche des 3. Jahrhunderts übernommen und im 4 Jahrhundert durch das Konzil von Laodizea auf die Bibel bezogen, welche durch die Schriften einen normativen Inhalt für unsere Lebensbereiche darstellen. Die Bedeutung einer solchen Norm oder Richtschnur für die täglichen Angelegenheiten des Lebens für die junge christliche Gemeinde können wir uns nur schwer vorstellen in unserer heutigen westlichen Welt mit den vielen Bibelübersetzungen und hunderten von Aus- legungen. Aber in der Zeit Jesu gab es diesen Überfluß noch nicht. Es war jedoch wegen dem jüdischen Denken der ersten Christen gar nicht denkbar ohne eine Schrift zu sein, welche Verhaltensregeln für den Alltag gibt und an den Versammlungen gelesen wird. Egelkraut schreibt hierzu: “Seit der Zeit Moses gehörten inspirierte Schriften zum hebräischen Erbe“ (21). Hierzu kommt schon ein kritischer Einwand, welchen ich auf einer Ausarbeitung im Internet fand und ihn hier kurz darstellen möchte: Erstens umfaßt ein Kanon – in diesem Fall gleichgültig, welcher – eine Vielheit von Büchern mit einer Vielheit von Theologien. Zweitens erhebt er inhaltlich einen Einheitsanspruch, den zum Beispiel eine entwicklungsgeschichtliche Darstellung nicht einlösen könnte. Es kann nicht bei rein deskriptiver Wahrnehmung einer Vielfalt von Theologien bleiben. Drittens schließt er auf der kanonischen Geltungsebene weitere Texte und Zeugnisse aus - was eine historische Betrachtung niemals dürfte, da sie grundsätzlich alle vorhandenen Quellen berücksichtigen muß. (NOBERT LOHFINGER THESE 16)
Die Notwendigkeit des Schutzes vor Betrug kommt diesem Mann nicht in den Sinn, was für mich nicht nachvollziehbar ist. Rendtorff schreibt in diesem Zusammenhang folgendes: “Die moderne Bibelwissenschaft hat dem kanonischen Endstadium der einzelnen Bücher sowie dem Kanon insgesamt wenig Beachtung geschenkt“…“In jüngster Zeit läßt sich jedoch eine Veränderung der Fragestellung erkennen. Sie betrifft sowohl die einzelnen Bücher als auch den Kanon als ganzen“ (304). Dies ist meiner Ansicht nach eine ehrliche Einschätzung, welche nun zu keinen Aussagen hinreißen lassen sollte wie sie von Lohfinger und anderen kritischen Auslegern gemacht wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Die Bedeutung des Kanons
- Die Notwendigkeit eines Kanons
- Die Kriterien für den Kanon
- Kriterien an den Verfasser
- Der Autor
- Die Adressaten
- Die Lehraussagen
- Kriterien an den Text
- Kriterien an den Verfasser
- Die Sammlung heiliger Schriften
- Die Festlegung des Kanons
- Die Dreiteilung des Kanons
- Gesetz
- Propheten
- Die vorderen Propheten
- Die hinteren Propheten
- Die großen Propheten
- Die kleinen Propheten
- Schriften
- Die Megilloth
- Weisheitsliteratur
- Die Dreiteilung des Kanons
- Die Festlegung des Kanons
- Kritik an der Einteilung und bibeltreue Ansicht
- Das NT und die Schriften des AT
- Jesus Christus und das Alte Testament
- Die Apostel und das Alte Testament
- Johannes und das Alte Testament
- Petrus und das Alte Testament
- Jakobus und das Alte Testament
- Matthäus und das Alte Testament
- Paulus und das Alte Testament
- Das Verhältnis der Geschichtsschreiber, Philosophen und der Kirchenväter zum Alten Testament
- Der Philosoph Philo (15/ 10 v. Chr. - 45/ 50 n. Chr.)
- Josephus von Jerusalem (37-95 n. Chr.)
- Bischof Melito von Sardis (um 170 n. Chr.)
- Origenes (um 185- 254 n. Chr.)
- Tertullian (160- 250 n. Chr.)
- Hilarius von Poitiers (305- 366 n. Chr.)
- Hieronimus (340- 420 n. Chr.)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Entstehung und Bedeutung des Alten Testaments (AT) im Kontext der biblischen Kanonbildung. Sie untersucht die Kriterien, die zur Festlegung des Kanons führten, sowie die Kritik an der Einteilung des AT. Darüber hinaus beleuchtet die Arbeit das Verhältnis des Neuen Testaments (NT) zum AT und die Rezeption des AT durch verschiedene historische Persönlichkeiten.
- Die Entstehung und Bedeutung des Alten Testaments (AT)
- Die Kriterien für die Kanonbildung des AT
- Kritik an der Einteilung des AT
- Das Verhältnis des NT zum AT
- Die Rezeption des AT in der Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Bedeutung des Kanons
Dieses Kapitel erklärt die Bedeutung des Wortes "Kanon" und seine Entwicklung von einer "Richtschnur" in der griechischen Philosophie hin zu einer normativen Schriftensammlung im frühen Christentum. Es betont die Wichtigkeit des Kanons für die junge christliche Gemeinde in einer Zeit, in der es noch keine vielfältigen Übersetzungen und Interpretationen der Bibel gab.
Die Notwendigkeit eines Kanons
Dieses Kapitel argumentiert, dass die schriftliche Fixierung der Offenbarung Gottes im AT, besonders deutlich in den Zehn Geboten, für die Erhaltung des Glaubens und die Abgrenzung von anderen spirituellen Einflüssen der damaligen Zeit essentiell war. Der Fokus liegt auf dem Schutz vor Betrug und der Notwendigkeit, ein autoritatives Wort Gottes zu etablieren.
Die Kriterien für den Kanon
Dieses Kapitel behandelt die Kriterien, anhand derer Schriften in den Kanon des AT aufgenommen wurden. Es werden drei zentrale Faktoren hervorgehoben: der Autor, die Adressaten und die Lehraussagen. Die Arbeit analysiert die Bedeutung der prophetischen Inspiration des Autors, die Universalität der Botschaft und die Kohärenz der Lehraussagen als entscheidende Elemente für die Kanonisierung eines Textes.
Die Sammlung heiliger Schriften
Dieses Kapitel befasst sich mit der Festlegung des Kanons des AT, insbesondere mit der Dreiteilung in Gesetz, Propheten und Schriften. Es beschreibt die verschiedenen Unterteilungen innerhalb der Kategorie der Propheten und Schriften und beleuchtet die Einordnung der Megilloth und der Weisheitsliteratur.
Kritik an der Einteilung und bibeltreue Ansicht
Dieses Kapitel präsentiert unterschiedliche Perspektiven auf die Kanonbildung des AT, insbesondere die kritische Betrachtung der Entstehung und Entwicklung einzelner Bücher. Es beleuchtet die Ansicht der modernen Bibelwissenschaft und stellt diese der bibeltreuen Sichtweise gegenüber.
Das NT und die Schriften des AT
Dieses Kapitel untersucht das Verhältnis des NT zum AT und die Bedeutung der Schriften des AT für die frühen Christen. Es analysiert die Verwendung des AT durch Jesus Christus und die Apostel und beleuchtet die Rezeption des AT durch verschiedene historische Persönlichkeiten, darunter Philo, Josephus, Melito, Origenes, Tertullian, Hilarius und Hieronymus.
Schlüsselwörter
Biblischer Kanon, Altes Testament, Neues Testament, Kanonisierung, Kriterien, Autor, Adressaten, Lehraussagen, Prophetie, Offenbarung, Inspiration, Kritik, Bibeltreue, Geschichte, Rezeption.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „Kanon“ im biblischen Kontext?
Das Wort Kanon stammt vom griechischen Wort für „Richtschnur“ oder „Norm“ ab. Im biblischen Sinne bezeichnet er die Sammlung von Schriften, die als normativ für den Glauben und das Leben angesehen werden.
Nach welchen Kriterien wurden Schriften in den Kanon aufgenommen?
Wichtige Kriterien waren die prophetische Inspiration des Autors, die Adressaten der Botschaft sowie die Übereinstimmung der Lehraussagen mit dem bereits etablierten Wort Gottes.
Wie ist das Alte Testament traditionell eingeteilt?
Der jüdische Kanon ist dreigeteilt in: Gesetz (Tora), Propheten (Nebiim) und Schriften (Ketubim). Diese Einteilung wird in der Arbeit detailliert erläutert.
Wie unterscheidet sich die bibeltreue von der kritischen Sicht?
Die kritische Bibelwissenschaft betrachtet den Kanon oft als historisches Endstadium einer Entwicklung, während die bibeltreue Sicht die göttliche Inspiration und die Notwendigkeit des Schutzes vor Betrug betont.
Welches Verhältnis hatten Jesus und die Apostel zum Alten Testament?
Für Jesus und die Apostel war das Alte Testament die autoritative Heilige Schrift. Die Arbeit untersucht, wie Johannes, Petrus, Paulus und andere die Schriften des AT zitierten und anwandten.
- Quote paper
- Marco Rothenhöfer (Author), 2004, Kanongeschichte aus bibeltreuer und kritischer Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37282