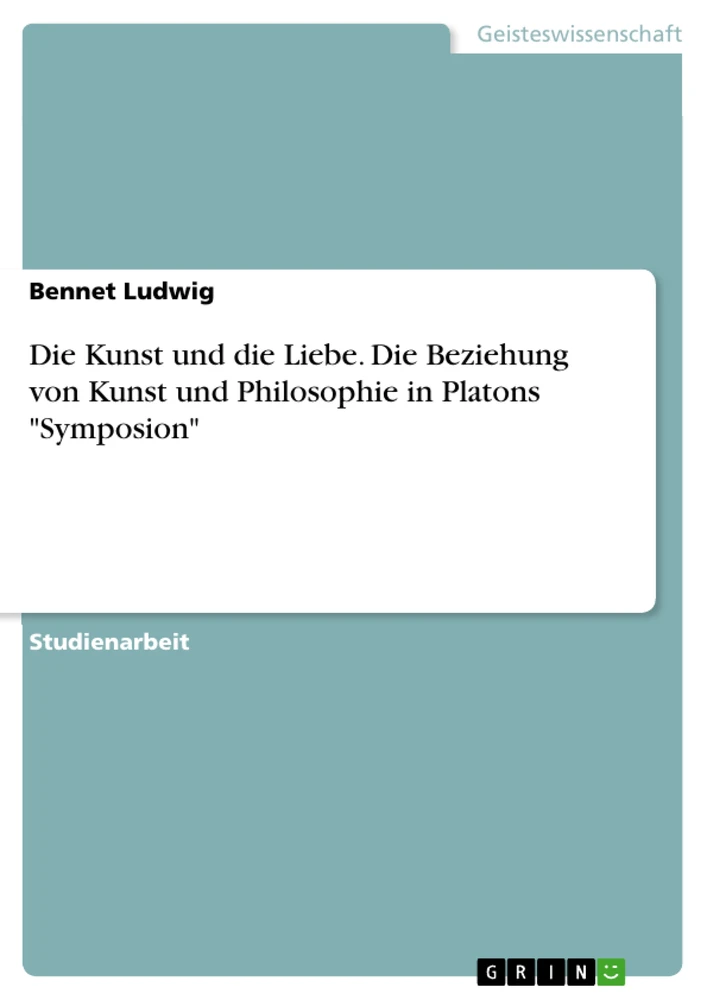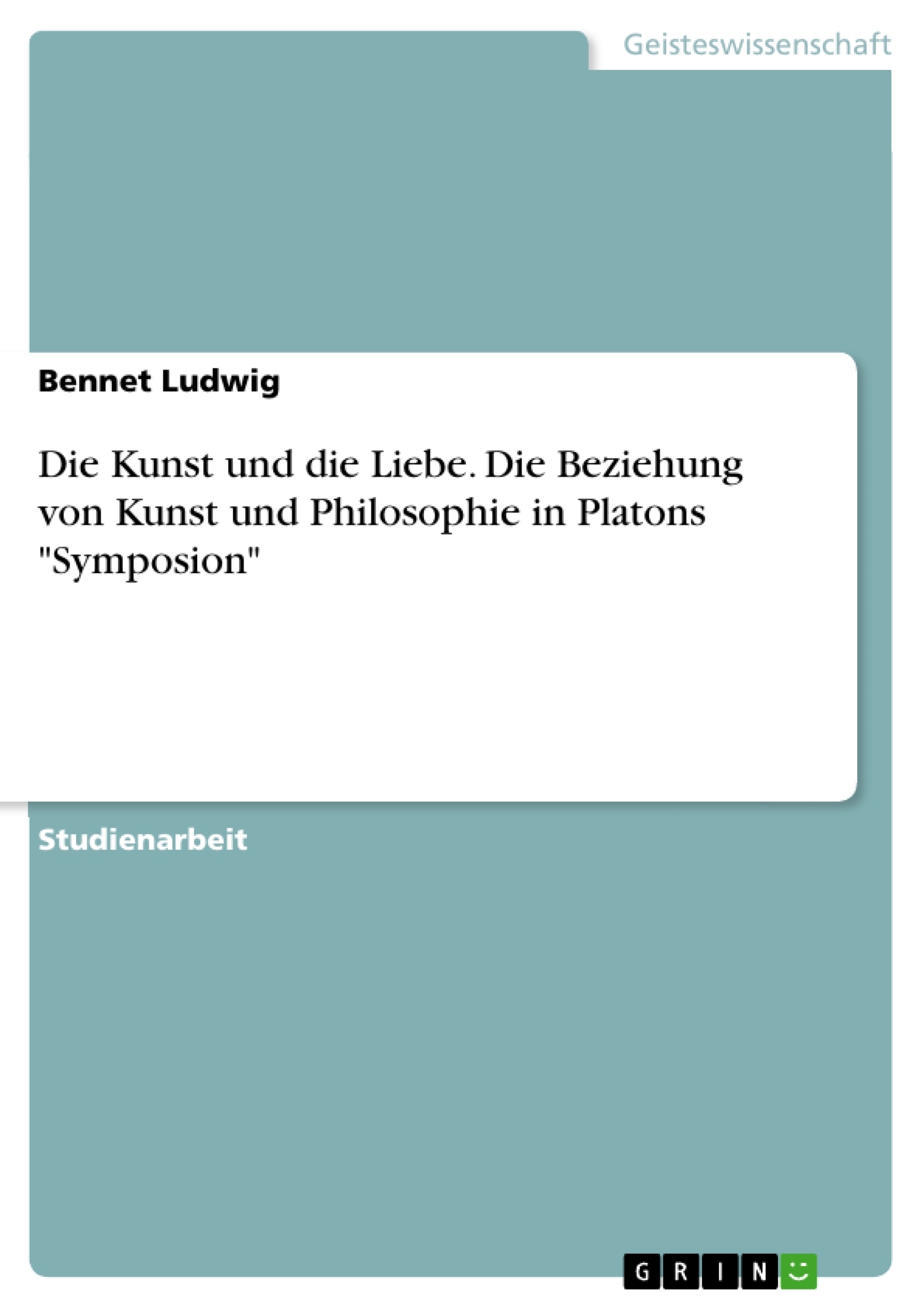Die folgende Arbeit soll anhand Platons „Symposion“ zeigen, wie aktuell die darin angeführten Aspekte der Liebe sind und insbesondere, welche Rolle die Kunst damals wie heute für die Wissenschaft spielt. Dafür werden zuerst die Figuren, ihre Konstellation und deren Reden analysiert.
Das anschließende Kapitel befasst sich dann mit der Entwicklung des Liebesverständnisses bis hin zum 21. Jahrhundert, um die Parallelen von Antike und Moderne für die spätere Analyse zu umreißen. Vor der kurzen Zusammenfassung im Fazit werden die Beziehung von Kunst und Philosophie bzw. Wissenschaft betrachtet sowie weitere Parallelen zur heutigen Gesellschaft gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Symposion
- 2.1. Die Teilnehmer
- 2.2. Die Reden
- 3. Die Liebe im Wandel der Zeit?
- 3.1. Die Entwicklung der Liebe
- 3.2. Die neue Liebe
- 4. Kunst und Philosophie
- 5. Die Moderne im Symposion
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Platons Symposion, um die Aktualität der darin dargestellten Liebesvorstellungen aufzuzeigen und die Rolle der Kunst in der philosophischen Auseinandersetzung mit dem Thema Liebe zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der Analyse der Reden der einzelnen Teilnehmer und ihrer gesellschaftlichen Bedeutung. Die Arbeit verfolgt das Ziel, Parallelen zwischen dem antiken Verständnis von Liebe und der modernen Sichtweise zu identifizieren.
- Die verschiedenen Liebesauffassungen im Symposion und ihre gesellschaftliche Einbettung
- Die Entwicklung des Liebesverständnisses von der Antike bis zur Moderne
- Die Rolle der Kunst in der philosophischen Betrachtung der Liebe
- Parallelen zwischen dem antiken und modernen Verständnis von Liebe
- Die Bedeutung der rhetorischen Gestaltung des Symposions
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Liebe ein und stellt dessen Komplexität und Vielschichtigkeit heraus. Sie verweist auf die unterschiedlichen kulturellen Interpretationen des Begriffs "Liebe" und betont die Bedeutung des kulturellen Kontextes. Platons Symposion wird als Ausgangspunkt für die Untersuchung des antiken Liebesverständnisses präsentiert, wobei die Aktualität der darin behandelten Aspekte hervorgehoben wird. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz, der die Analyse der Figuren, ihrer Konstellation und Reden im Symposion umfasst, sowie die Betrachtung der Entwicklung des Liebesverständnisses bis zur Moderne und die Analyse der Beziehung von Kunst und Philosophie.
2. Das Symposion: Dieses Kapitel beschreibt die Struktur und die Besonderheiten des Symposions als platonischer Dialog. Es hebt die Bedeutung des „Dialogverfahrens“ hervor und betont die Monologe der einzelnen Gäste. Die Bedeutung der Rednerauswahl und die Rolle der rhetorischen Wettstreits werden beleuchtet. Die doppelte Erzählperspektive (Apollodoros und Aristodemos) und die Bewunderung für Sokrates werden als Aspekte der Wahrheitsfindung und der detailgetreuen Wiedergabe dargestellt. Das Kapitel legt den Grundstein für die anschließende Analyse der einzelnen Reden und ihrer gesellschaftlichen Relevanz.
2.1. Die Teilnehmer: Dieser Abschnitt analysiert die Teilnehmer des Symposions im Hinblick auf ihren gesellschaftlichen Status, ihre Berufstätigkeit und ihren Bezug zur Philosophie. Es wird deutlich gemacht, dass die ersten drei Redner (Phaidros, Pausanias, Eryximachos) stellvertretend für die breite Masse stehen, während spätere Redner eine höhere gesellschaftliche und intellektuelle Stellung innehaben. Die Auswahl der Redner und deren Reihenfolge wird als bewusste Entscheidung Platons interpretiert, die auf die Darstellung verschiedener gesellschaftlicher Perspektiven abzielt. Der unerwartete Wechsel zwischen Aristophanes und Eryximachos wird als Indiz für eine mögliche intellektuelle Hierarchie interpretiert.
Schlüsselwörter
Platon, Symposion, Liebe, Kunst, Philosophie, Antike, Moderne, Rhetorik, Gesellschaft, Eros, Dialog, gesellschaftliche Normen, Liebesverständnis, Kulturvergleich.
Häufig gestellte Fragen zum Symposion Platons
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Platons Symposion. Sie untersucht die im Symposion dargestellten Liebesvorstellungen auf ihre Aktualität und beleuchtet die Rolle der Kunst in der philosophischen Auseinandersetzung mit dem Thema Liebe. Der Fokus liegt auf der Analyse der Reden der einzelnen Teilnehmer und ihrer gesellschaftlichen Bedeutung. Die Arbeit sucht nach Parallelen zwischen dem antiken und modernen Liebesverständnis.
Welche Themen werden im Symposion behandelt?
Das Symposion behandelt verschiedene Liebesauffassungen und deren gesellschaftliche Einbettung. Es untersucht die Entwicklung des Liebesverständnisses von der Antike bis in die Moderne und die Rolle der Kunst in der philosophischen Betrachtung der Liebe. Weiterhin werden Parallelen zwischen antikem und modernem Liebesverständnis sowie die Bedeutung der rhetorischen Gestaltung des Symposions analysiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema einführt und den methodischen Ansatz erläutert. Es folgt die Analyse des Symposions selbst, inklusive der Beschreibung der Teilnehmer und der Analyse ihrer Reden. Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Liebesverständnisses über die Zeit und die Interaktion von Kunst und Philosophie im Kontext der Liebe. Abschließend gibt es ein Fazit.
Wer sind die Teilnehmer des Symposions und welche Rolle spielen sie?
Das Symposion umfasst verschiedene Teilnehmer mit unterschiedlichem gesellschaftlichem Status und Bezug zur Philosophie. Die ersten Redner repräsentieren die breite Masse, während spätere Redner eine höhere gesellschaftliche und intellektuelle Stellung einnehmen. Die Auswahl und Reihenfolge der Redner wird als bewusste Entscheidung Platons interpretiert, die verschiedene gesellschaftliche Perspektiven darstellen soll.
Wie wird das Liebesverständnis im Symposion dargestellt?
Die Arbeit analysiert die verschiedenen Liebesauffassungen, die im Symposion von den einzelnen Rednern vertreten werden. Sie untersucht, wie sich das Liebesverständnis von der Antike bis in die Moderne entwickelt hat und welche Parallelen zwischen beiden Epochen bestehen. Die Rolle der Kunst und Philosophie bei der Betrachtung der Liebe wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit analysiert die Figuren, ihre Konstellation und Reden im Symposion. Sie betrachtet die Entwicklung des Liebesverständnisses bis zur Moderne und analysiert die Beziehung zwischen Kunst und Philosophie. Die Bedeutung des „Dialogverfahrens“ und der rhetorischen Gestaltung des Symposions wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Schlüsselbegriffe sind Platon, Symposion, Liebe, Kunst, Philosophie, Antike, Moderne, Rhetorik, Gesellschaft, Eros, Dialog, gesellschaftliche Normen, Liebesverständnis und Kulturvergleich.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, beginnend mit der Einleitung, die das Thema einführt und den methodischen Ansatz erläutert. Die Kapitel zum Symposion beschreiben dessen Struktur, die Teilnehmer und die Analyse ihrer Reden. Die Zusammenfassung beleuchtet die Entwicklung des Liebesverständnisses und die Beziehung zwischen Kunst und Philosophie.
- Citar trabajo
- Bennet Ludwig (Autor), 2015, Die Kunst und die Liebe. Die Beziehung von Kunst und Philosophie in Platons "Symposion", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373035