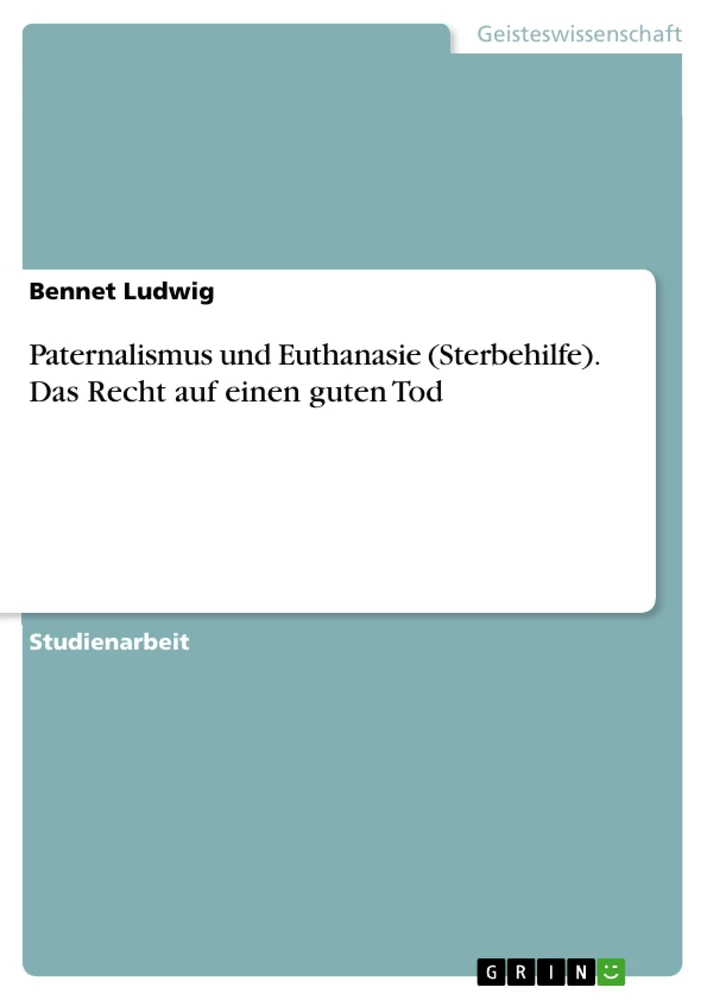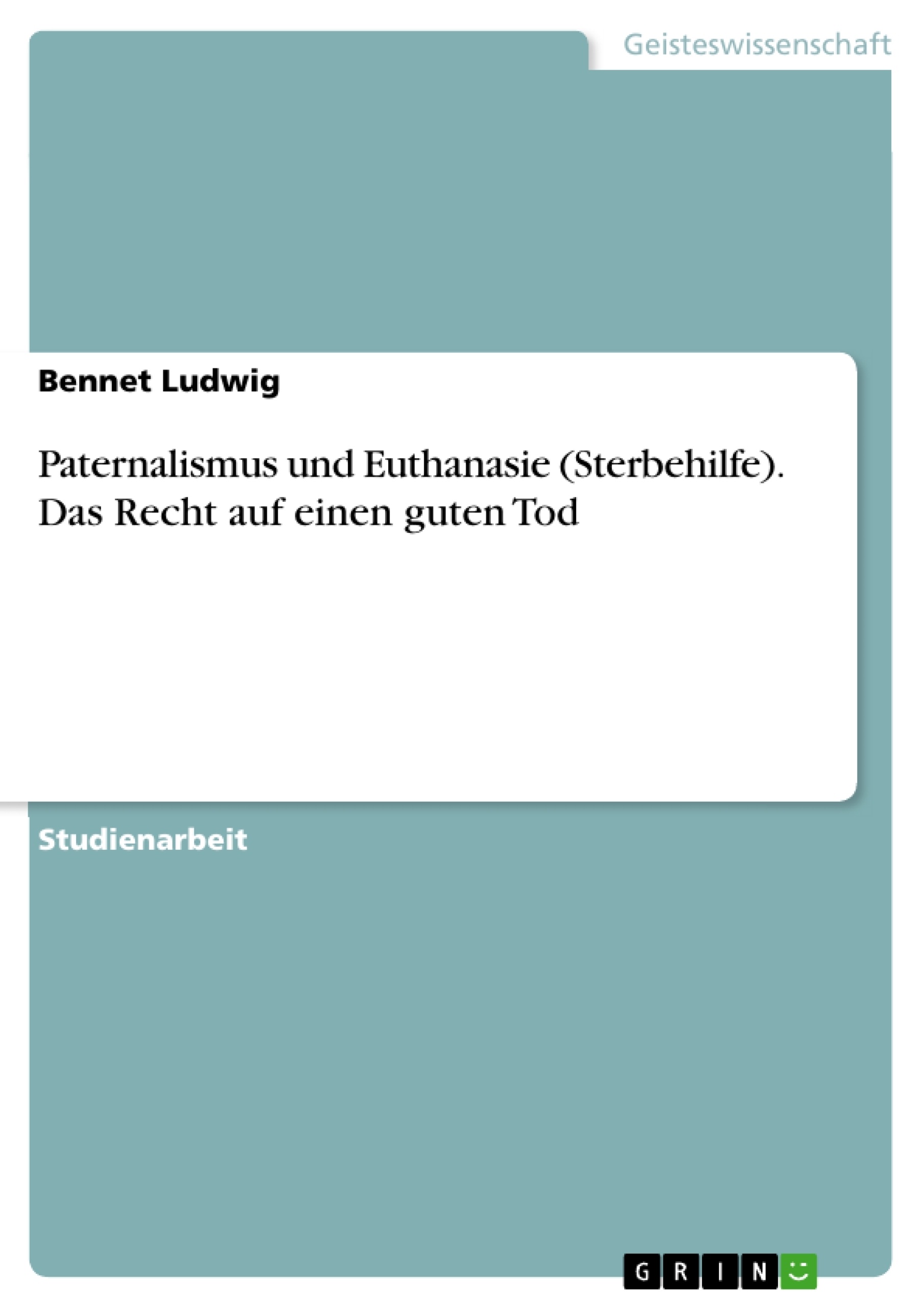Die Sterbehilfe ist eines der prekärsten Themen dieser Zeit. Diese Arbeit setzt sich mit den moralischen Aspekten auseinander und stellt dar, warum ein Verbot von Sterbehilfe längst nicht mehr zeitgemäß ist.
Die Arbeit versucht dabei zu erarbeiten, wann sich Paternalismus – also eine Bevormundung durch Dritte – bezüglich der Euthanasie nicht nur moralisch, sondern auch schon anhand bestehender Gesetze verbietet, beziehungsweise wann und in welchem Maße dieser angebracht ist. Zu diesem Zweck wird das Konzept des Paternalismus anhand zweier Aufsätze von Joel Feinberg und Gerald Dworkin vorab erläutert. Danach die Geschichte, die Formen – unter diesem Aspekt auch die Schwierigkeiten der dafür verwendeten Begriffe – und die derzeitige Rechtslage der Euthanasie. Diesem zusammenfassenden Überblick folgt dann der eigentliche Problemaufriss, welcher die paternalistischen Aspekte analysiert und damit letztlich auf ein uraltes philosophisches Dilemma hinweist, welches sich in der Medizin und folglich auch der Diskussion um Euthanasie manifestiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Paternalismus - Zwischen Freiheit und Zwang
- Euthanasie – Geschichte, Begriffe und Recht
- Die Krankheitssituation – Betroffene, Umgang und Wille
- Das Recht auf Selbstbestimmung des Lebens – Der Tod gehört dazu
- Das Dilemma von Körper und Geist – Psychisch krank, körperlich behandelt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der ethischen Frage der Euthanasie und analysiert, inwiefern Paternalismus - also die Bevormundung durch Dritte - in diesem Kontext gerechtfertigt ist. Dabei werden die Geschichte und die verschiedenen Formen der Euthanasie sowie die aktuelle Rechtslage beleuchtet.
- Paternalismus und seine Grenzen
- Euthanasie und das Recht auf Selbstbestimmung
- Die Rolle der Medizin bei der Entscheidung über Leben und Tod
- Das Dilemma von Körper und Geist
- Die ethische Herausforderung der Lebensverlängerung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung thematisiert die aktuelle Debatte um Euthanasie und stellt den Bezug zum hippokratischen Eid her. Sie verdeutlicht die ethischen Herausforderungen, die sich aus den Möglichkeiten der modernen Medizin ergeben.
- Paternalismus - Zwischen Freiheit und Zwang: Dieses Kapitel erläutert das Konzept des Paternalismus anhand der Theorien von Joel Feinberg und Gerald Dworkin. Es wird zwischen verschiedenen Formen des Paternalismus unterschieden und die Frage nach der Rechtfertigung von paternalistischen Zwängen aufgeworfen.
- Euthanasie – Geschichte, Begriffe und Recht: Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte der Euthanasie, die verschiedenen Formen und die damit verbundenen Begrifflichkeiten. Außerdem wird die aktuelle Rechtslage der Euthanasie in Deutschland dargestellt.
- Die Krankheitssituation – Betroffene, Umgang und Wille: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den konkreten Krankheitssituationen, in denen die Frage nach Euthanasie auftritt. Es werden die Perspektiven der Betroffenen, der Angehörigen und der behandelnden Ärzte beleuchtet.
- Das Recht auf Selbstbestimmung des Lebens – Der Tod gehört dazu: Dieses Kapitel argumentiert für das Recht auf Selbstbestimmung des Lebens, einschließlich der Entscheidung über den eigenen Tod. Es werden die Grenzen des paternalistischen Eingriffs in diese Selbstbestimmung diskutiert.
- Das Dilemma von Körper und Geist – Psychisch krank, körperlich behandelt: Dieses Kapitel analysiert das Dilemma, das sich ergibt, wenn psychisch kranke Menschen in ihrem körperlichen Zustand behandelt werden. Es werden die ethischen Herausforderungen und die Grenzen des paternalistischen Eingriffs in diesen Kontext beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Paternalismus, Euthanasie, Selbstbestimmung, Lebensverlängerung, Krankheitssituation, psychische Krankheit, ethische Herausforderungen, Recht auf einen guten Tod.
- Arbeit zitieren
- Bennet Ludwig (Autor:in), 2016, Paternalismus und Euthanasie (Sterbehilfe). Das Recht auf einen guten Tod, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373036