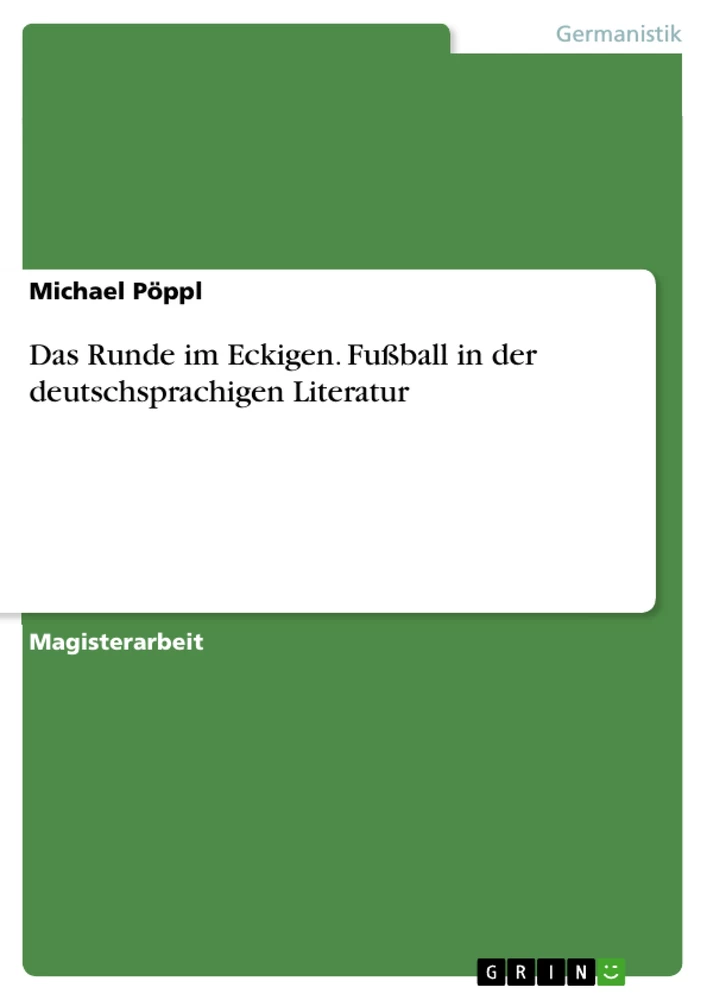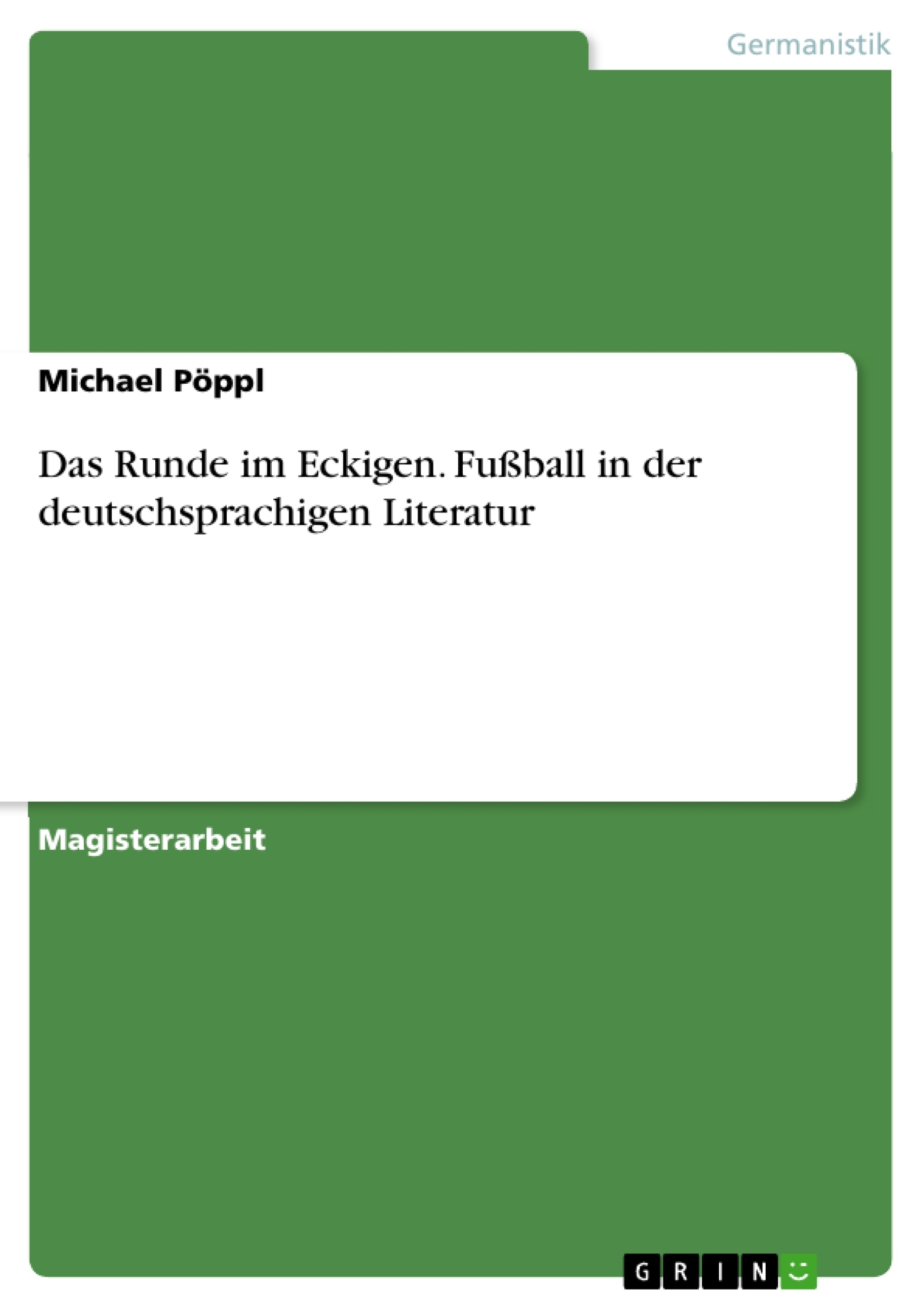Fußball ist ein wenig beachtetes Thema in der Germanistik, das sich jedoch, ähnlich wie andere Modernisierungsphänomene des zwanzigsten Jahrhunderts, in allen Bereichen der Literatur wiederfindet. Neben dem Film und der Popmusik hat sich der Sport zu einer typischen Massenerscheinung entwickelt. Dies gilt bis heute: Jede Saison ziehen bis zu 10 Millionen Zuschauer in die Fußballstadien, über acht Millionen Fernsehzuschauer hat die Bundesliga jeden Samstag in der Spielzeit. Während der Weltmeisterschaften werden sogar ansonsten uninteressierte Menschen zu Fußballfans.
Mit dieser Arbeit wird versucht, zwei scheinbar unvereinbare Dinge zusammenzubringen: Fußball und Literatur. Die Idee dazu kam mir durch die Lektüre des Romans "Ballfieber (Fever Pitch)"1 des englischen Autors Nick Hornby, der im Frühjahr 1996 in kürzester Zeit zu einem Kultbuch unter Fußball- und Literaturbegeisterten wurde. Hier war die Verbindung von Fußball und Literatur bestens geglückt. "The best football book ever was written"2 begeisterte auch die Kritiker des Feuilletons, und die tageszeitung (taz) schwärmte: "»Fever Pitch« gehört mindestens zu den besten Büchern der neunziger Jahre."
Wie kommt es, daß in der deutschen Literatur ein derartiges Massenphänomen wie Fußball nur als Marginalie vorkommt? Um diese Frage zu beantworten, war es auch nötig, die Ursprünge des Fußballs in Deutschland anhand von literarischen Texten zu betrachten. Das machte eine umfangreiche Recherche nötig. Außer in satirischen oder ironischen Texten, in Kolportagegeschichten, in der Kategorie "Heiteres" und im Jugendbuch waren mir Fußballtexte bis dahin kaum bekannt. Bei der weiteren Suche stellte sich heraus, daß aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg keine Texte zu finden waren. Dies hing offensichtlich mit der mangelnden gesellschaftlichen Präsenz des Fußballs im Kaiserreich zusammen. Im zweiten und dritten Kapitel soll deshalb gezeigt werden, wie mit der zunehmenden Popularisierung des Sports in Deutschland auch der Fußball ein literarisches Thema wurde. Mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt sich das vierte Kapitel. Hier sollen die Zusammenhänge von Fußball und Gesellschaft des "Dritten Reichs" behandelt werden...
--------
1 Nick Hornby: Ballfieber – Die Geschichte eines Fans, Hamburg 1996
2 René Martens: Ich träume von George - und Charlie N., in: die tageszeitung (taz) vom 20.4.96, S.24
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Fragestellung
- 2. Eine kurze Geschichte des Fußballs in Deutschland
- 2.1. "Das englische Spiel" - Vom Volksfußball zum Schulsport
- 2.2. Die Weimarer Republik und der Breitensport
- 3. Die zwanziger Jahre - Fußball als Modernisierungsphänomen
- 3.1. "Der Fußballwahn ist eine Krank-" - Joachim Ringelnatz
- 3.2. Der Ball auf der Bühne - Fußballspieler und Indianer
- 3.3. Ein Tag im Stadion - Die Fußballplatzangst des Karl Valentin
- 4. "Feldherren der Fußballschlachten" - Fußball im "Dritten Reich"
- 4.1. Sport als Propagandainstrument
- 4.2. Mitläufer und Täter - Fußballspieler im "Dritten Reich"
- 4.3. Kaffehauskultur und Fußball - Literatur in den dreißiger Jahren
- 4.3.1. Die Wiener Schule - jüdische Literatur und der Sport
- 4.3.2. "Er spielte stets, er kämpfte nie" - Mathias Sindelar und der österreichische Fußball der dreißiger Jahre
- 4.3.3. Der Tod eines Fußballspielers - Friedrich Torberg
- 5. "Das Wunder von Bern" 1954 - Fußball, Mythen und Politik
- 5.1. Der deutsche Fußball nach dem Zweiten Weltkrieg
- 5.2. Wir sind wieder wer!
- 5.3. "Vor dem Spiel ist nach dem Spiel" - Die Herberger-Legende
- 5.4. Das Unverständnis der Dichter - Literatur der fünfziger Jahre
- 5.5. "Toni, du bist ein Fußballgott!" - Der Sonntag, an dem Friedrich C. Delius Weltmeister wurde
- 5.6. Verschwörungen im "Hexenkessel von Göteborg" - WM 1958
- 6. Fußballgedicht und Wembleytor – Die sechziger Jahre
- 6.1. Die Modernisierung des Spiels
- 6.2. Das Tor von Wembley - WM 1966 in England
- 6.3. Ablehnung und Annäherung - die Literatur der sechziger Jahre
- 6.3.1. Die Belagerung von Müngersdorf - Heinrich Böll
- 6.3.2. Uweh uweh uweh! - Die jungen Wortspieler
- 6.3.3. Die Angst des Dichters beim Elfmeter - Peter Handke
- 6.3.4. Die Weltmeisterschaftskrimis von Erich Loest - Fußball in der DDR
- 7. Utopie und lange Mähnen - Der Fußball in den Siebzigern
- 7.1. Die Befremdung der Linken - Faszination und Skepsis
- 7.2. "Sozialaufsteiger am Ball" - Fußball und zaghafter Kapitalismus
- 7.3. Der Mythos vom linken Fußballer
- 7.3.1. Bayern oder Gladbach, rechts oder links?
- 7.3.2. "Netzer kam aus der Tiefe des Raums"
- 7.4. Die Frankfurter Eintracht und die Neue Frankfurter Schule
- 8. Fußball als literarischer Auftrag - Eckhard Henscheid und Ror Wolf
- 8.1. "Fußball ist wichtiger als Camus" - Die Verbindung von Hochkultur und Fußball bei Eckhard Henscheid
- 8.2. Texte aus der Tiefe des Raums - Intellektuelle Offenbarungen
- 8.3. "Inmitten gewalt'gen Gestöhnes" - Das Ende der deutschen Fußballherrlichkeit
- 8.4. "Im Fußball findet sich eine ganze Menge Welt" - Das fußballerische Werk von Ror Wolf
- 8.4.1. "Punkt ist Punkt" - Ror Wolfs literarische Fußballtexte
- 8.4.2. "Ball, Ball, Ball, Ball, Ball, Ball ..." - Die Hörspiel-Collagen
- 8.4.3. "Rotweißrot ins Himmelreich" - Die Stunde des Edi Finger
- 9. Die achtziger Jahre
- 9.1. Die Befreiungstheorie des Fußballs - Das Menotti-Manifest
- 9.2. Die Schande von Gijon - WM 1982
- 9.3. Die Suche nach einer Ästhetik des Fußballs - Die Literatur der achtziger Jahre
- 9.3.1. Die neue deutsche Innerlichkeit
- 9.4. Hymnen und Hohn - Eckhard Henscheid zum zweiten
- 9.4.1. "Hymne auf Bum Kun Cha" - Erhabenheit und Parodie
- 9.4.2. Standardsituationen - Die Isolation der Intellektuellen
- 9.5. "Herr Maradona in der Heldenrolle" - Ein modernes Epos
- 10. Von der Ästhetik des Fußballs
- 10.1. Die Besonderheiten des Fußballs
- 10.2. Die Liebe zum Fußball
- 10.3. Die unerfüllte Liebe der Intellektuellen
- 10.4. Die wahre Liebe findet im Stadion statt
- 10.5. It's a Man's World - Ein Exkurs
- 10.6. "Sie konnten zueinander nicht kommen..." - Die Intellektuellen und der Sport
- 11. Fußballboom und Bücherschwemme - Die neunziger Jahre
- 11.1. Deutschland gegen den Rest der Welt - WM 1990
- 11.2. Fußball und Privatfernsehen
- 11.3. "Vanitas! vanitatum vanitas!" - Der Untergang der DDR-Oberliga - Ein Exkurs
- 11.4. Fußballboom und Bücherschwemme - Literatur in den Neunzigern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung des Fußballs in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts. Ziel ist es, die scheinbar marginale Rolle des Fußballs in der Literatur im Kontext seiner Popularität in der Gesellschaft zu beleuchten und zu erklären. Die Arbeit analysiert, wie sich das Massenphänomen Fußball in literarischen Texten spiegelt und welche gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Aspekte dabei zum Ausdruck kommen.
- Der Fußball als Modernisierungsphänomen
- Die politische Instrumentalisierung des Fußballs
- Die Wahrnehmung des Fußballs in der Literatur verschiedener Epochen
- Der Fußball als Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen
- Die Beziehung zwischen Intellektuellen und dem Fußball
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Fragestellung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der unterrepräsentierten Rolle des Fußballs in der deutschsprachigen Literatur trotz seiner immensen Popularität. Sie begründet die Notwendigkeit einer Untersuchung, die den Fußball als ein Modernisierungsphänomen betrachtet, vergleichbar mit Film und Popmusik. Die Arbeit zielt darauf ab, die Verbindung zwischen Fußball und Literatur aufzuzeigen, inspiriert durch den Erfolg des Buches "Ballfieber" von Nick Hornby.
2. Eine kurze Geschichte des Fußballs in Deutschland: Dieses Kapitel liefert einen kurzen Überblick über die Geschichte des Fußballs in Deutschland, beginnend mit der Einführung des "englischen Spiels" und seiner Entwicklung vom Volkssport zum Schulsport. Es beleuchtet die Rolle des Fußballs in der Weimarer Republik und die Bedeutung des Breitensportes. Dieser historische Abriss bildet den Kontext für die spätere literarische Auseinandersetzung mit dem Thema.
3. Die zwanziger Jahre - Fußball als Modernisierungsphänomen: Das Kapitel analysiert die Darstellung des Fußballs in der Literatur der 1920er Jahre als ein Zeichen der gesellschaftlichen Modernisierung. Es untersucht verschiedene literarische Perspektiven auf den Fußball, von der satirischen Kritik Ringelnatz' bis hin zur Inszenierung des Fußballs auf der Bühne. Das Kapitel verdeutlicht, wie der Fußball als neues Massenphänomen die Literatur beeinflusst.
4. "Feldherren der Fußballschlachten" - Fußball im "Dritten Reich": Dieses Kapitel untersucht die Nutzung des Fußballs als Propagandainstrument im Dritten Reich. Es analysiert die Rolle der Fußballspieler im NS-Regime, sowohl als Mitläufer als auch als Täter. Besonderes Augenmerk liegt auf der literarischen Auseinandersetzung mit dem Thema, insbesondere im Kontext der Wiener Schule und der Werke von Autoren wie Friedrich Torberg.
5. "Das Wunder von Bern" 1954 - Fußball, Mythen und Politik: Das Kapitel analysiert die Bedeutung des "Wunders von Bern" für die deutsche Nachkriegsgesellschaft und seine literarische Verarbeitung. Es beleuchtet den Fußball als Mittel der nationalen Identitätsfindung und die unterschiedlichen literarischen Reaktionen auf dieses Ereignis. Der Fokus liegt auf der Mythenbildung um das Spiel und die politische Dimension des Fußballs.
6. Fußballgedicht und Wembleytor – Die sechziger Jahre: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung des Fußballs in den 1960er Jahren und seine Reflexion in der Literatur. Es beleuchtet sowohl die Modernisierung des Spiels als auch literarische Reaktionen darauf, die von Ablehnung bis hin zu Annäherung reichen. Die unterschiedlichen Perspektiven werden anhand von Beispielen aus der Literatur der BRD und der DDR veranschaulicht.
7. Utopie und lange Mähnen - Der Fußball in den Siebzigern: Dieses Kapitel befasst sich mit der ambivalenten Wahrnehmung des Fußballs in den 1970er Jahren, insbesondere durch linke Intellektuelle. Es analysiert die Faszination und gleichzeitig die Skepsis gegenüber dem Fußball, beleuchtet die Entwicklung des Kapitalismus und die Entstehung des Mythos vom "linken Fußballer".
8. Fußball als literarischer Auftrag - Eckhard Henscheid und Ror Wolf: Das Kapitel konzentriert sich auf das Werk von Eckhard Henscheid und Ror Wolf und deren Auseinandersetzung mit dem Fußball. Es analysiert, wie sie die Verbindung von Hochkultur und Fußball herstellen und welche literarischen Mittel sie dabei einsetzen. Die Bedeutung des Fußballs als Metapher wird hier besonders hervorgehoben.
9. Die achtziger Jahre: Das Kapitel behandelt die Entwicklung des Fußballs in den 1980er Jahren und seine literarische Reflexion. Es analysiert den Einfluss von Ereignissen wie der Schande von Gijon und die Suche nach einer neuen Ästhetik des Fußballs in der Literatur dieser Zeit.
10. Von der Ästhetik des Fußballs: Dieses Kapitel widmet sich einer eingehenden Analyse der ästhetischen Aspekte des Fußballs und seiner Bedeutung für verschiedene Gruppen, insbesondere Intellektuelle. Es untersucht die Liebe zum Fußball, die unerfüllte Liebe der Intellektuellen zum Fußball und die Suche nach einer Verbindung zwischen beiden Welten.
11. Fußballboom und Bücherschwemme - Die neunziger Jahre: Das Kapitel beschreibt den Fußballboom der 1990er Jahre und die damit verbundene literarische Produktion. Es analysiert den Einfluss von Ereignissen wie der WM 1990 und dem Aufstieg des Privatfernsehens auf die Literatur. Der Untergang der DDR-Oberliga wird als ein Exkurs behandelt.
Schlüsselwörter
Fußball, deutschsprachige Literatur, Modernisierung, Politik, Identität, Kultur, Massenphänomen, Intellektuelle, Satire, Ironie, Propaganda, Nachkriegsgesellschaft, Ästhetik, Kapitalismus, DDR, BRD, WM.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Darstellung des Fußballs in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts"
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Darstellung des Fußballs in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts. Sie beleuchtet die scheinbar marginale Rolle des Fußballs in der Literatur im Kontext seiner enormen Popularität in der Gesellschaft.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert, wie sich das Massenphänomen Fußball in literarischen Texten spiegelt und welche gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Aspekte dabei zum Ausdruck kommen. Sie möchte die Verbindung zwischen Fußball und Literatur aufzeigen und die unterrepräsentierte Rolle des Fußballs in der Literatur erklären.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem den Fußball als Modernisierungsphänomen, die politische Instrumentalisierung des Fußballs, die Wahrnehmung des Fußballs in der Literatur verschiedener Epochen, den Fußball als Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen und die Beziehung zwischen Intellektuellen und dem Fußball.
Welche Zeiträume werden untersucht?
Die Arbeit betrachtet die Darstellung des Fußballs in der Literatur des gesamten 20. Jahrhunderts, von den 1920er Jahren bis in die 1990er Jahre. Jedes Jahrzehnt wird separat analysiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in elf Kapitel. Diese beginnen mit einer Einleitung und Fragestellung und behandeln die Geschichte des Fußballs in Deutschland, seine Darstellung in der Literatur der verschiedenen Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, die Rolle von prominenten Autoren und die ästhetischen Aspekte des Fußballs in der Literatur.
Welche Autoren werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die Werke verschiedener Autoren, die sich mit dem Thema Fußball auseinandergesetzt haben. Besondere Aufmerksamkeit erhalten Eckhard Henscheid und Ror Wolf, deren Werke ausführlich untersucht werden. Weitere erwähnte Autoren sind Joachim Ringelnatz, Karl Valentin, Mathias Sindelar, Friedrich Torberg, Heinrich Böll, Peter Handke, Erich Loest und Friedrich C. Delius.
Wie werden die Kapitel zusammengefasst?
Für jedes Kapitel gibt es eine kurze Zusammenfassung, die die zentralen Themen und Ergebnisse beschreibt. Diese Zusammenfassungen bieten einen schnellen Überblick über den Inhalt der Arbeit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Fußball, deutschsprachige Literatur, Modernisierung, Politik, Identität, Kultur, Massenphänomen, Intellektuelle, Satire, Ironie, Propaganda, Nachkriegsgesellschaft, Ästhetik, Kapitalismus, DDR, BRD, WM.
Welche Ereignisse werden im Kontext des Fußballs betrachtet?
Wichtige Ereignisse wie das "Wunder von Bern" (1954), das Wembley-Tor (1966), die Schande von Gijon (1982) und die Fußball-Weltmeisterschaft 1990 werden im Kontext ihrer literarischen Verarbeitung analysiert.
Welche Art von Literatur wird untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene literarische Genres, darunter Gedichte, Prosa, Hörspiele und literarische Essays, die sich mit dem Fußball auseinandersetzen.
Wo finde ich das Inhaltsverzeichnis?
Das detaillierte Inhaltsverzeichnis befindet sich im HTML-Dokument selbst und ist in übersichtlicher Form als geordnete Liste dargestellt.
- Arbeit zitieren
- Michael Pöppl (Autor:in), 1999, Das Runde im Eckigen. Fußball in der deutschsprachigen Literatur, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37304