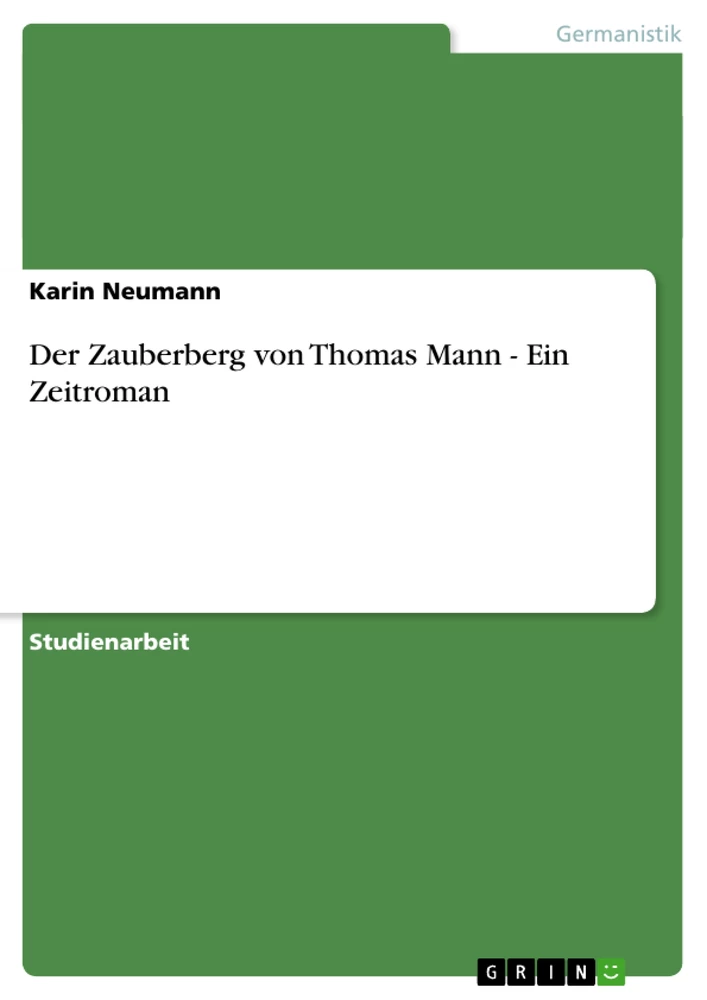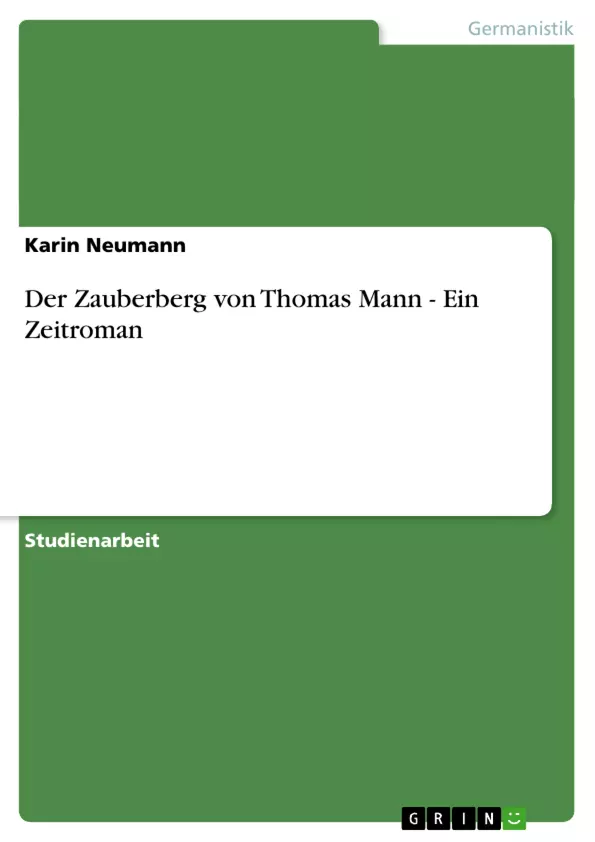Einleitung
„Kann man die Zeit erzählen, diese selbst, als solche, an und für sich?“ Der Erzähler des Zauberbergs stellt sich diese Frage im siebenten Kapitel des Zauberbergs.1 Sie fungiert als Aufgabenstellung für den gesamten Roman und nennt aber lediglich einen Aspekt der Zeitthematisierung. Thomas Manns Werk ist ein Zeitroman. Er selbst formuliert in seiner Princetoner Einführung in den Zauberberg:
Damit komme ich auf etwas schon Berührtes zurück, nämlich auf das Mysterium der Zeit, mit dem der Roman auf mehrfache Weise sich abgibt. Er ist ein Zeitroman im doppeltem Sinn: einmal historisch, indem er das innere Bild einer Epoche, der europäischen Vorkriegszeit, zu entwerfen versucht, dann aber, weil die reine Zeit selbst sein Gegenstand ist, den er nicht nur als die Erfahrung seines Helden, sondern auch in und durch sich selbst behandelt.2
Zu diesen zwei Aspekten der Zeit im Zauberberg gesellt sich noch ein dritter. Der Roman ist auch ein Roman der Erzählzeit. Thomas Mann thematisiert das Verhältnis von erzählter Zeit und Erzählzeit. Es handelt sich also um einen Zeitroman im dreifachen Sinn. Diese drei unterschiedlichen Perspektiven der Zeit sollen im Weiteren näher beleuchtet werden. Es soll gezeigt werden, wie Thomas Mann Zeit behandelt und welche Quellen und Bezüge er eventuell verwendet hat.
----
1 Mann, Thomas: Der Zauberberg. Roman. Frankfurt am Main 2000, S. 741.
2 Mann, Thomas: Gesammelte Werke in dreizehn Bänden, Band XI. Frankfurt am Main 1990, S. 611f. Im Folgenden werden alle Angaben aus den Gesammelten Werken durch Nennung des Bandes und der Seite angeführt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Roman als Erzählung von der Zeit
- Die Ewigkeitssuppe
- Zeitphilosophische Aspekte
- Wege aus dem zeitlichen Einerlei
- Der Roman der Zeitgeschichte
- Ein Roman der Erzählzeit
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Zeit in Thomas Manns Roman "Der Zauberberg". Ziel ist es, die verschiedenen Aspekte der Zeitthematik im Roman zu beleuchten und zu analysieren, wie Mann Zeit als literarisches Mittel einsetzt. Die Arbeit konzentriert sich auf die spezifischen Weisen, wie Zeit im Roman dargestellt wird und welche Bedeutung diese Darstellung für das Gesamtverständnis des Werkes hat.
- Die Kontrastierung von Zeitwahrnehmung im Sanatorium und im Flachland
- Die Rolle der Langeweile und Untätigkeit als zeitraffende und -dehnende Faktoren
- Die verschiedenen Zeitebenen im Roman (erzählte Zeit, Erzählzeit, historische Zeit)
- Die Beziehung zwischen Zeit und Handlung im Roman
- Die Auswirkungen der veränderten Zeitwahrnehmung auf die Charaktere
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Frage nach der Erzählbarkeit von Zeit im Roman "Der Zauberberg" und führt die drei Ebenen der Zeitthematik ein: die historische Zeit, die Zeit als Gegenstand des Romans und die Erzählzeit. Sie skizziert den Ansatz der Arbeit, der diese drei Perspektiven näher beleuchten wird.
Der Roman als Erzählung von der Zeit: Dieses Kapitel analysiert den Kontrast zwischen der Zeitwahrnehmung im Sanatorium und im Flachland. Im Sanatorium wird die Zeit als dehnbar und inhaltslos beschrieben, während sie im Flachland durch Ereignisse und Aktivitäten geprägt ist. Die "Ewigkeitssuppe" des Sanatoriums symbolisiert die langsame, fast stehende Zeit, die eine andere Zeiterfahrung erzeugt. Der Roman veranschaulicht, wie die Umgebung die Wahrnehmung der Zeit beeinflusst und wie sich diese veränderte Wahrnehmung auf die Charaktere auswirkt. Beispiele wie die drei Wochen Besuch, die für Hans Castorp im Sanatorium länger erscheinen, veranschaulichen dieses Konzept.
Zeitphilosophische Aspekte: [An dieser Stelle wäre eine Zusammenfassung der zeitphilosophischen Aspekte des Romans einzufügen. Da diese im gegebenen Textauszug nicht ausführlich erläutert werden, kann hier nur ein Platzhalter stehen. Eine vollständige Zusammenfassung würde eine tiefgründige Analyse der philosophischen Konzepte in Bezug auf Zeit im Roman erfordern.]
Wege aus dem zeitlichen Einerlei: [An dieser Stelle wäre eine Zusammenfassung der Wege, wie die Charaktere mit der erlebten Zeit umgehen und diese eventuell überwinden, einzufügen. Da dies im gegebenen Textauszug nicht ausführlich behandelt wird, kann hier nur ein Platzhalter stehen. Eine vollständige Zusammenfassung würde die verschiedenen Strategien der Charaktere zum Umgang mit dem Zeitgefühl im Sanatorium analysieren.]
Der Roman der Zeitgeschichte: [An dieser Stelle wäre eine Zusammenfassung des Romans im Kontext der historischen Zeit und der gesellschaftlichen Bedingungen der Vorkriegszeit zu ergänzen. Da dies im gegebenen Textauszug nicht detailliert beschrieben wird, kann hier nur ein Platzhalter stehen. Eine vollständige Zusammenfassung würde den historischen Kontext des Romans und seine Bedeutung für das Verständnis der dargestellten Zeit untersuchen.]
Ein Roman der Erzählzeit: [An dieser Stelle wäre eine Zusammenfassung der Beziehungen zwischen erzählter Zeit und Erzählzeit zu ergänzen. Da dies im gegebenen Textauszug nur kurz angeschnitten wird, kann hier nur ein Platzhalter stehen. Eine vollständige Zusammenfassung würde die Erzähltechniken Manns und ihren Einfluss auf die Zeitgestaltung analysieren.]
Schlüsselwörter
Zeitwahrnehmung, Erzählzeit, historische Zeit, Sanatorium, Flachland, Thomas Mann, Der Zauberberg, Langeweile, Untätigkeit, Zeitphilosophie.
Häufig gestellte Fragen zu Thomas Manns "Der Zauberberg" - Zeitliche Aspekte
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Zeit in Thomas Manns Roman "Der Zauberberg". Sie untersucht, wie Mann Zeit als literarisches Mittel einsetzt und welche Bedeutung diese Darstellung für das Gesamtverständnis des Werkes hat. Der Fokus liegt auf der spezifischen Darstellung der Zeit und deren Auswirkungen auf die Charaktere und die Handlung.
Welche Aspekte der Zeitthematik werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte der Zeitthematik, darunter die Kontrastierung der Zeitwahrnehmung im Sanatorium und im Flachland, die Rolle von Langeweile und Untätigkeit als zeitraffende und -dehnende Faktoren, die verschiedenen Zeitebenen (erzählte Zeit, Erzählzeit, historische Zeit), die Beziehung zwischen Zeit und Handlung sowie die Auswirkungen der veränderten Zeitwahrnehmung auf die Charaktere.
Wie wird die Zeit im Sanatorium dargestellt?
Im Sanatorium wird die Zeit als dehnbar und inhaltslos beschrieben, im Gegensatz zum erlebnisreichen Flachland. Die "Ewigkeitssuppe" symbolisiert die langsame, fast stehende Zeit, die eine andere Zeiterfahrung erzeugt. Die Umgebung beeinflusst die Wahrnehmung der Zeit, was sich auf die Charaktere auswirkt (z.B. erscheinen drei Wochen Besuch für Hans Castorp viel länger).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, die die zentrale Frage nach der Erzählbarkeit von Zeit im Roman einführt und den Ansatz der Arbeit skizziert. Weitere Kapitel untersuchen den Roman als Erzählung von der Zeit (mit Fokus auf den Kontrast Sanatorium/Flachland), zeitphilosophische Aspekte (Platzhalter im gegebenen Text), Wege aus dem zeitlichen Einerlei (Platzhalter), den Roman im Kontext der Zeitgeschichte (Platzhalter) und den Roman als Beispiel für Erzählzeit (Platzhalter). Ein Resümee schließt die Arbeit ab.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Zeitwahrnehmung, Erzählzeit, historische Zeit, Sanatorium, Flachland, Thomas Mann, Der Zauberberg, Langeweile, Untätigkeit, Zeitphilosophie.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die verschiedenen Aspekte der Zeitthematik im Roman "Der Zauberberg" zu beleuchten und zu analysieren, wie Mann Zeit als literarisches Mittel einsetzt und welche Bedeutung diese Darstellung für das Gesamtverständnis des Werkes hat.
- Quote paper
- Karin Neumann (Author), 2004, Der Zauberberg von Thomas Mann - Ein Zeitroman, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37307