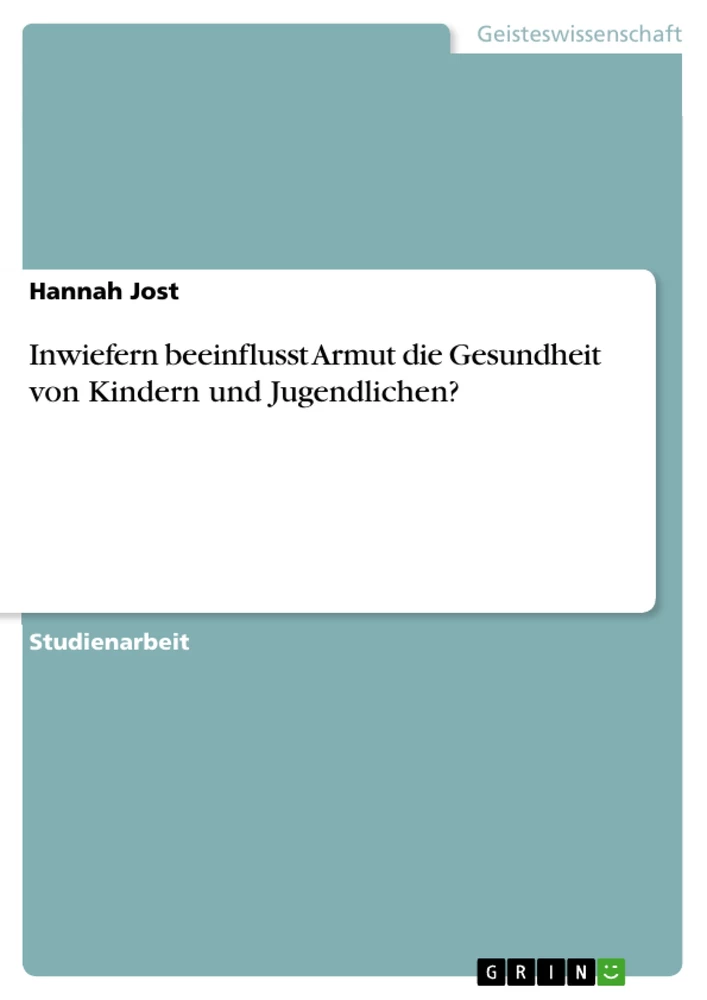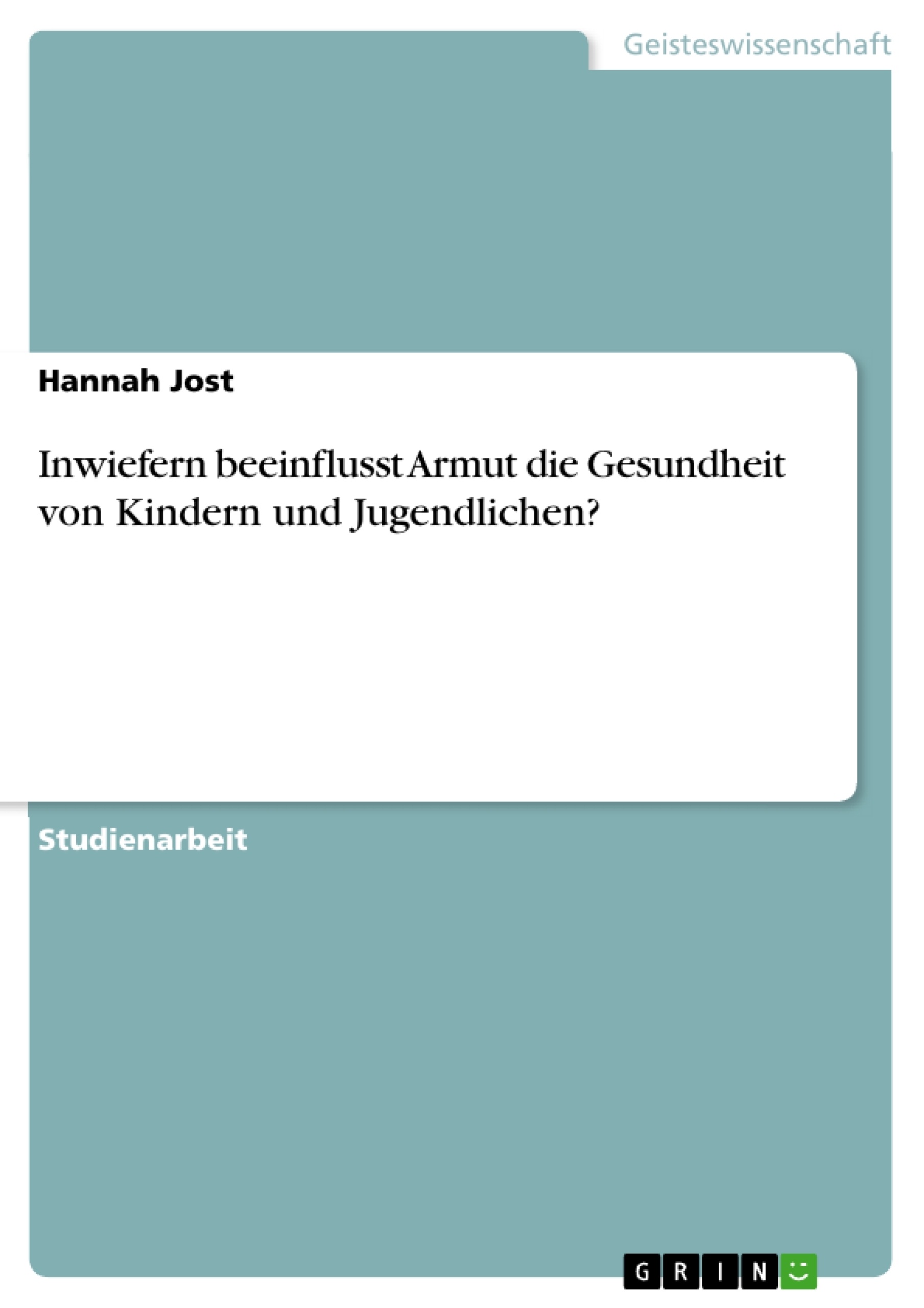Nicht erst im Erwachsenenalter ist ein Unterschied nach Schicht im gesundheitlichen Bereich auffällig. Bereits im Kindes- und Jugendalter hat Armut deutliche Auswirkungen auf die Gesundheitschancen. Nicht nur das eigene Verhalten der Minderjährigen, sondern auch die Erziehung und Achtsamkeit der Eltern sowie die mit dem sozialen Stand verbundenen Ungleichheiten im gesellschaftlichen Alltag haben Einfluss auf das Wohlbefinden.
In der vorliegenden Hausarbeit werden zum einen die mangelnde Vorsorge, zum anderen die fehlende Aufklärung in Sachen "gesund leben" als Ursachen für negative Auswirkungen auf die Gesundheitschancen von Kindern und Jugendlichen aufgeführt. Außerdem werden zwei Projekte der Gesundheitsförderung vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Auswirkungen von Armut auf die Gesundheitschancen
- 2.1 Mangelnde Vorsorge
- 2.1.1 Sparsamkeit bei Arztbesuchen
- 2.1.2 Impfungen
- 2.2 Fehlende Aufklärung in Sachen „gesund leben“
- 2.2.1 Zahnpflege
- 2.2.2 Art und Maß der Ernährung
- 2.2.3 Mangelnde Bewegung
- 2.2.4 Anfälligkeit für Suchten
- 3. Projekte der Gesundheitsförderung
- 3.1 Gesundheitsfördernde Schulen
- 3.2 Deutschlands „,IN FORM“ – Initiative
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern Armut die Gesundheitschancen von Kindern und Jugendlichen beeinflusst. Sie analysiert die negativen Auswirkungen von Armut auf die Gesundheit, insbesondere im Kontext von mangelnder Vorsorge und fehlender Aufklärung in Sachen „gesund leben“. Die Arbeit beleuchtet zudem Projekte der Gesundheitsförderung, die darauf abzielen, diese Herausforderungen zu adressieren.
- Auswirkungen von Armut auf die Gesundheitschancen von Kindern und Jugendlichen
- Mangelnde Vorsorge in medizinischer Hinsicht bei Kindern aus armen Familien
- Fehlende Aufklärung in Sachen „gesund leben“ in einkommensschwachen Familien
- Projekte der Gesundheitsförderung im Kampf gegen die gesundheitlichen Nachteile von Armut
- Die Bedeutung von frühzeitiger Intervention zur Verbesserung der Gesundheitschancen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit anhand von Statistiken zur Lebenserwartung dar. Kapitel 2 analysiert die Auswirkungen von Armut auf die Gesundheitschancen von Kindern und Jugendlichen, wobei der Fokus auf mangelnder Vorsorge in medizinischer Hinsicht und fehlender Aufklärung in Sachen „gesund leben“ liegt. Kapitel 3 beleuchtet Projekte der Gesundheitsförderung, die sich auf diese Herausforderungen konzentrieren.
Schlüsselwörter
Armut, Gesundheitschancen, Kinder, Jugendliche, Vorsorge, Gesundheitsförderung, Lebenserwartung, Ernährung, Bewegung, Suchten, Prävention, Soziale Ungleichheit, Gesundheitswesen, Projekte, „IN FORM“ – Initiative
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst Armut die Gesundheit von Kindern?
Armut führt oft zu mangelnder medizinischer Vorsorge, schlechterer Ernährung und fehlender Aufklärung über einen gesunden Lebensstil.
Warum ist die Vorsorge in einkommensschwachen Familien oft mangelhaft?
Ursachen sind oft Sparsamkeit bei Arztbesuchen, geringere Impfquoten und eine geringere Achtsamkeit der Eltern aufgrund multipler Belastungen.
Welche Rolle spielt die Ernährung?
Einkommensschwache Familien haben oft weniger Zugang zu gesunden Lebensmitteln, was zu Fehlernährung und Übergewicht bei Kindern führen kann.
Was ist die Initiative „IN FORM“?
Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung, die darauf abzielt, das Lebensumfeld von Kindern nachhaltig zu verbessern.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Armut und Suchtrisiko?
Ja, Kinder aus armen Verhältnissen zeigen statistisch gesehen eine höhere Anfälligkeit für Suchterkrankungen im Jugend- und Erwachsenenalter.
- Quote paper
- Hannah Jost (Author), 2014, Inwiefern beeinflusst Armut die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373566