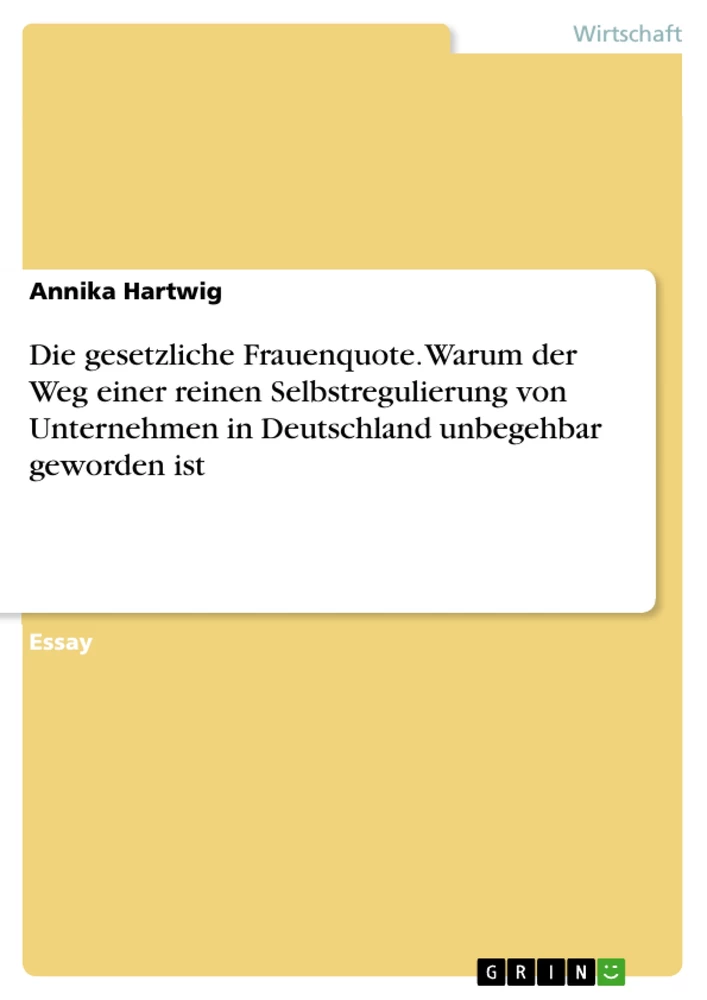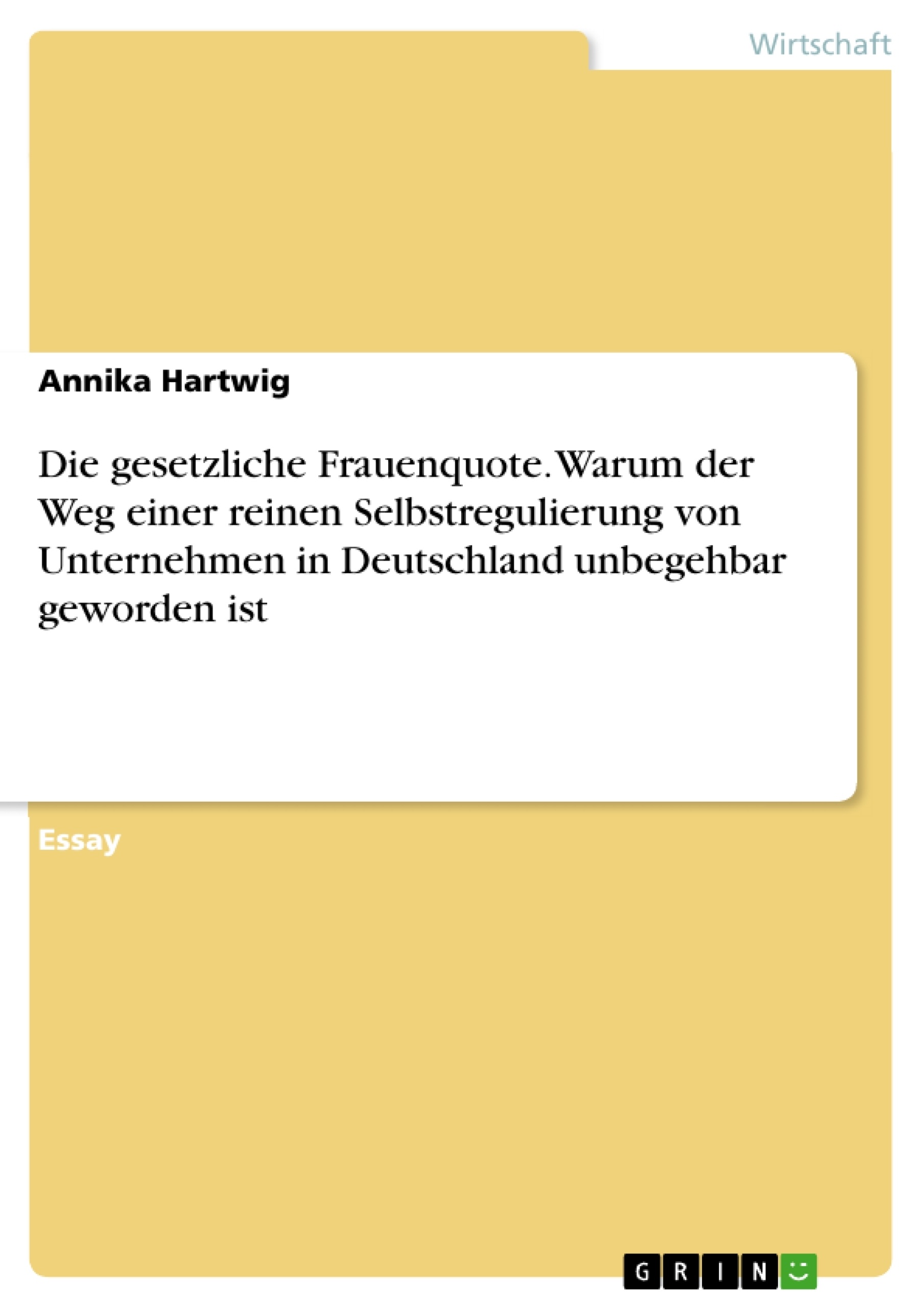Jeder hat sie mitbekommen: die aufwühlenden Debatten um die gesetzliche Frauenquote in Deutschland. Spitzenpolitiker warfen sich gegenseitig „Weinerlichkeit“, „Macho- Gehabe“, „Frauenprobleme“ und „schlechte Kinderstuben“ vor und der ehemalige ThyssenKrupp-Chef Gerhard Cromme belehrte einige Top Juristinnen des Landes darüber, dass Aufsichtsräte keine Kaffeekränzchen seien. Doch nachdem Frau Merkel und Herr Gabriel die Angelegenheit zur Chefsache erklärten und Herr Cromme am Weltfrauentag zurücktrat, steht nun fest: der Gesetzesentwurf für eine festgelegte Frauenquote in Deutschland wurde am elften Dezember vom Kabinett beschlossen. Doch was genau bedeutet das? Nach monatelangen Koalitionsverhandlungen haben sich CDU/CSU und SPD nun auf einen Kompromiss in Sachen Genderquote geeinigt. Voll mitbestimmungspflichtigen und börsennotierten Großunternehmen ist es vom ersten Januar 2016 an auferlegt, ihre Aufsichtspositionen bei Neuwahlmit mindestens dreißig Prozent weiblichen Kandidatinnen zu besetzen. Sollte ein Großunternehmen keine geeignete weibliche Bewerberin findet, wird diese Stelle unbesetzt bleiben, so die Sanktion. Betroffen sind von diesem Gesetzesentwurf ca. 108 deutsche Großunternehmen sowie 3500 weitere, börsennotierte oder voll mitbestimmungspflichtige Unternehmen, welche die Auflage haben, ab dem Jahr 2015 Unternehmensziele zu formulieren, die den Frauenanteil unter ihren Führungspersönlichkeiten deutlich anheben. Diese beziehen sich sowohl auf Aufsichtsräte, als auch Vorstandspositionen und das oberste Management. Darüber hinaus werden Ziele und deren Erreichung für die Öffentlichkeit transparent gemacht. Härtefallregelungen oder Sanktionen, für den Fall, dass Unternehmen nach erstmaligem Erreichen der dreißig Prozent erneut unter die gesetzlich festgelegte Frauenquote fallen, sind bisher nicht vorgesehen. Die Regierung möchte in solchen Fällen vorerst auf den sozialen Druck von Medien und Gesellschaft setzen.
Inhaltsverzeichnis
- Vom Kaffeekränzchen zum Gleichstellungsgesetz
- Selbstregulierung als Mantel des Nichtstuns?
- Die ungenutzten Chancen der Selbstregulierung
- Rückblick in vergangene, erfolglose Jahre: „Vereinbarung 2001“
- Das schwarze Loch zwischen Uni und Chefetage
- Bitte, bitte lieber Aufsichtsrat
- Der Wettbewerbsvorteil von Kaffeekränzchen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay analysiert die Debatte um die gesetzliche Frauenquote in Deutschland und beleuchtet die Notwendigkeit eines staatlichen Eingriffs in die Selbstregulierung von Unternehmen. Er untersucht die Argumente der Gegner der Quote und widerlegt deren Behauptungen durch empirische Daten und Beispiele aus der Praxis.
- Die unzureichende Repräsentation von Frauen in Führungspositionen in Deutschland
- Das Scheitern der Selbstregulierung als Mittel zur Erhöhung des Frauenanteils
- Der positive Einfluss von Frauen in Führungspositionen auf die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen
- Die Rolle des Staates als Garant für Gleichstellung und soziale Gerechtigkeit
- Die rechtliche und wirtschaftliche Bedeutung der gesetzlich verankerten Frauenquote
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel zeichnet die historische Entwicklung der Debatte um die Frauenquote in Deutschland nach und schildert die Einführung des Gesetzesentwurfs im Dezember 2014. Es beleuchtet die wichtigsten Punkte des Gesetzesentwurfs und die damit verbundenen Ziele der Regierung.
Das zweite Kapitel analysiert die Argumente der Gegner der Frauenquote, die eine Selbstregulierung der Unternehmen favorisieren. Es zeigt, dass die Selbstregulierung in der Vergangenheit zu keinem signifikanten Anstieg des Frauenanteils in Führungspositionen geführt hat.
Das dritte Kapitel beleuchtet die Chancen und Herausforderungen der Selbstregulierung am Beispiel der „Vereinbarung 2001“. Es zeigt, dass die Unternehmen die Vereinbarung nur unzureichend umgesetzt haben und dies zu einem weiteren Anstieg der Forderung nach einer gesetzlichen Frauenquote geführt hat.
Das vierte Kapitel thematisiert die Gründe für den niedrigen Frauenanteil in Führungspositionen und widerlegt das Argument der mangelnden Qualifikation von Frauen. Es zeigt, dass ein großes Potenzial an qualifizierten Frauen in Deutschland existiert, das jedoch durch die mangelnde Förderung und die ungleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt nicht ausgeschöpft wird.
Das fünfte Kapitel schildert die politischen Debatten um die Frauenquote in den Jahren 2010 bis 2014. Es zeigt, dass die Unternehmen trotz des steigenden Drucks seitens der Politik und der Gesellschaft nicht bereit waren, ihre Strukturen eigenständig zu ändern.
Das sechste Kapitel beleuchtet den positiven Einfluss von Frauen in Führungspositionen auf die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Es zeigt, dass Unternehmen mit einer gemischtgeschlechtlichen Führungsetage einen erheblichen Wettbewerbsvorteil haben.
Schlüsselwörter
Frauenquote, Selbstregulierung, Gleichstellung, Führungspositionen, Unternehmen, Wirtschaft, Politik, Geschlechterverhältnis, Arbeitsmarkt, Wettbewerbsvorteil, Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt das Gesetz zur Frauenquote von 2016?
Börsennotierte und voll mitbestimmungspflichtige Großunternehmen müssen Aufsichtsratsposten bei Neuwahlen mit mindestens 30 Prozent Frauen besetzen.
Warum hat die Selbstregulierung der Unternehmen versagt?
Trotz freiwilliger Zusagen (wie der „Vereinbarung 2001“) stieg der Frauenanteil in Führungspositionen jahrelang kaum an, was den Weg für staatliche Eingriffe ebnete.
Welche Sanktionen gibt es bei Nichterfüllung der Quote?
Findet ein Unternehmen keine geeignete weibliche Bewerberin für einen Aufsichtsratsposten, bleibt dieser Platz leer („Leerer Stuhl“).
Bieten Frauen in Führungsetagen wirtschaftliche Vorteile?
Ja, empirische Daten zeigen, dass Unternehmen mit gemischtgeschlechtlichen Führungsteams oft wettbewerbsfähiger sind und bessere Ergebnisse erzielen.
Wie viele Unternehmen sind von der gesetzlichen Quote betroffen?
Direkt betroffen sind etwa 108 Großunternehmen sowie ca. 3500 weitere Firmen, die sich eigene Zielgrößen zur Erhöhung des Frauenanteils setzen müssen.
- Arbeit zitieren
- Annika Hartwig (Autor:in), 2014, Die gesetzliche Frauenquote. Warum der Weg einer reinen Selbstregulierung von Unternehmen in Deutschland unbegehbar geworden ist, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373594