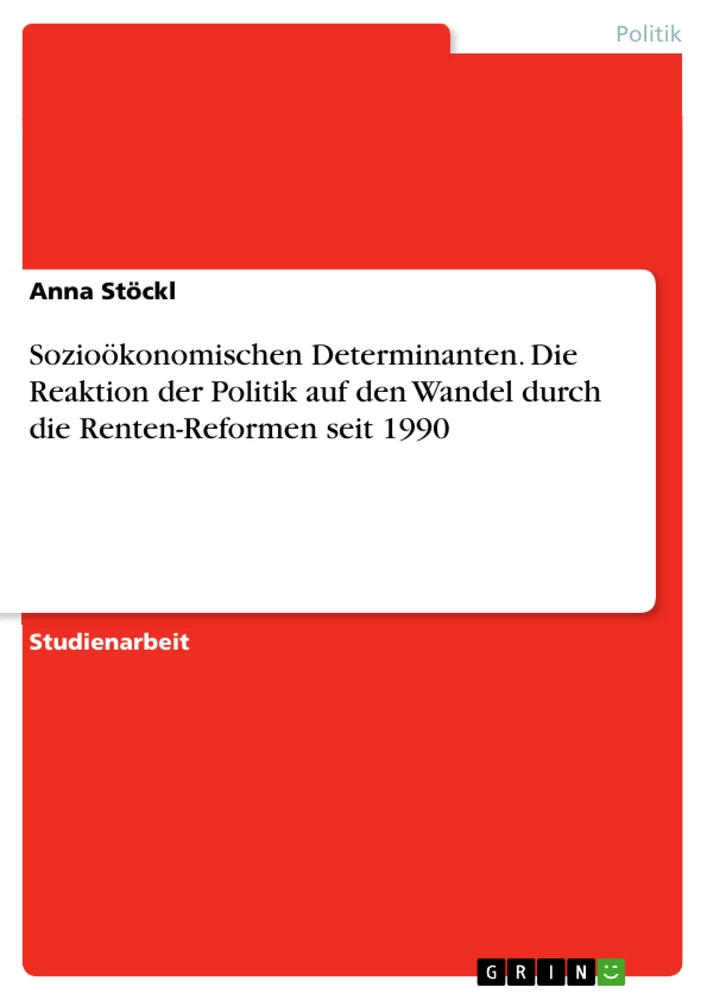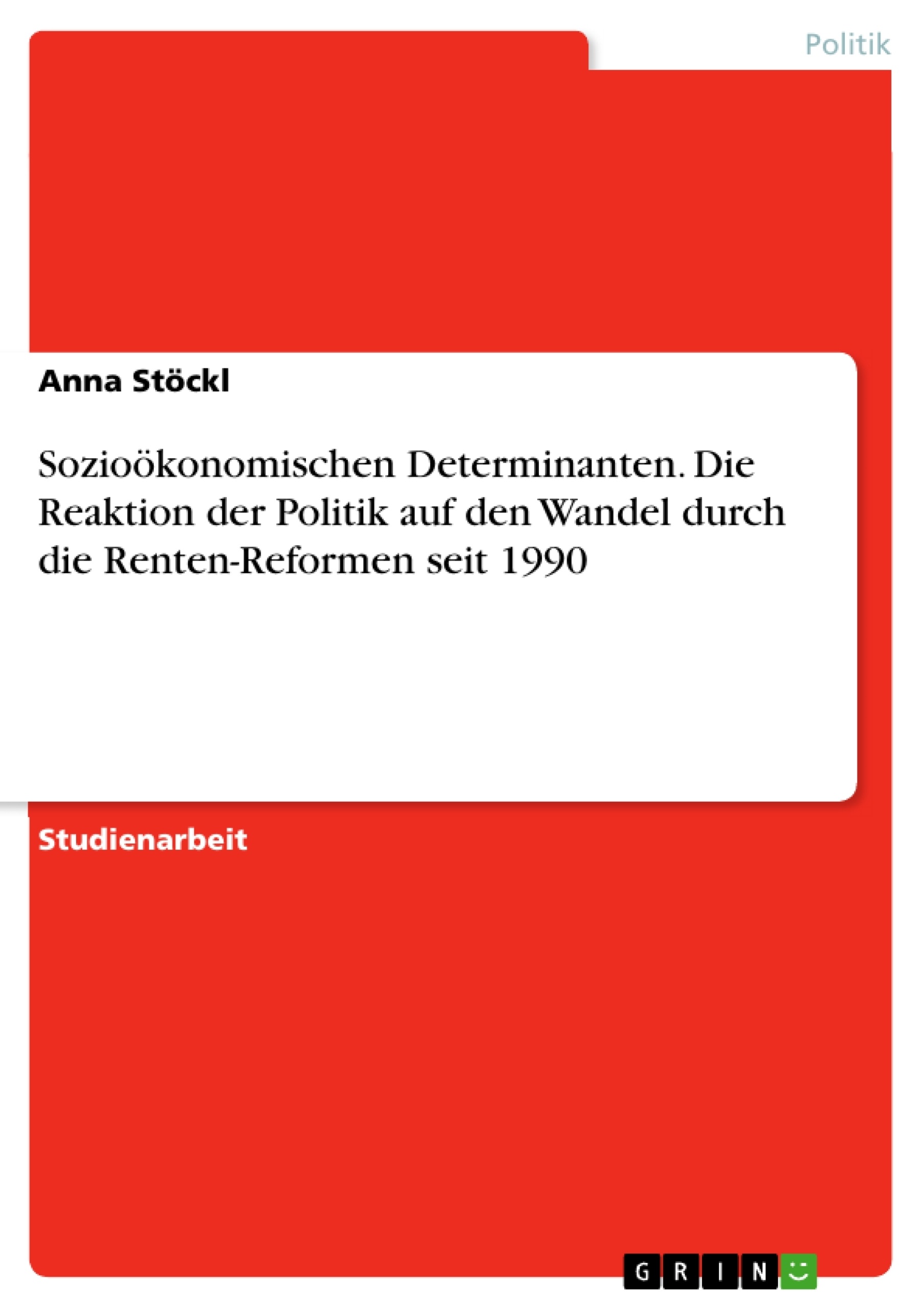Seit jeher erlebt die Welt einen Wandel in der Gesellschaft. Natur, Bevölkerungen, Systeme und Strukturen, alles verändert und wandelt sich im Laufe der Zeit. Der demografische Wandel wurde schon im 18. Jahrhundert als eine Wissenschaft der Bevölkerungsstruktur definiert. Fundamentale Veränderungen in der Bevölkerung bringen Folgen in vielen verschiedenen Bereichen mit sich, sowohl in sozialen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen als auch in politischen Dimensionen. Es stellt sich nun die Frage, welche Schwierigkeiten strukturelle Veränderungen mit sich bringen und welche Reaktionen dadurch hervorgerufen werden. Ziel dieser Hausarbeit soll es sein, die Frage zu untersuchen, wie die Politik auf den demografischen Wandel in Deutschland im Bereich der Rentenpolitik seit dem Jahre 1990 bis heute reagiert hat, beziehungsweise reagiert. Aufgrund des großen thematischen Umfangs, habe ich mich auf die Folgen in der Rentenpolitik seit dem Jahre 1990 beschränkt. Mithilfe der Theorie der sozioökonomischen Schule, in die im ersten Teil dieser Arbeit eingeführt wird, ist es möglich die Korrelation zwischen Demografie und Staatstätigkeit zu untersuchen.
Im zweiten Teil der Hausarbeit wird eine Übersicht über den demografischen Wandel in der Bundesrepublik Deutschland seit dem Jahre 1990 bis heute dargestellt und schließlich ausgewählte politische Maßnahmen in dem Bereich der Rentenpolitik erörtert. Im nächsten Punkt, der Policy-Analyse wird untersucht, inwieweit die Politik auf den demografischen Wandel am Beispiel der Rentenpolitik seit 1990 reagiert hat. Des Weiteren soll die Hypothese, dass die Staatstätigkeit aufgrund von demografischen Wandlungsprozessen seit 1990 gezwungen ist sich auszuweiten, bekräftigt oder entkräftet werden.
Zum Schluss werden in der Auswertung die Ergebnisse zusammengefasst und im Fazit die anfänglich gestellte Frage beantwortet. Als Letztes versucht diese Arbeit einen Blick auf die zukünftige Sicht zu geben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie der sozioökonomischen Schule
- Policy-Analyse
- Wandel der Gesellschaft
- Reaktionen der Politik
- Rentenreform 1990 - 1999
- Rentenreform 2000 - 2004
- Rentenreform 2005 - 2016
- Sozioökonomische Determinanten
- Auswertung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Reaktion der Politik auf den demografischen Wandel in Deutschland im Bereich der Rentenpolitik seit 1990. Sie nutzt die Theorie der sozioökonomischen Schule, um die Korrelation zwischen Demografie und Staatstätigkeit zu untersuchen.
- Der demografische Wandel in Deutschland seit 1990
- Die Reaktion der Politik auf den demografischen Wandel im Bereich der Rentenpolitik
- Die sozioökonomische Schule als analytisches Werkzeug
- Die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Staatstätigkeit
- Die Frage, ob die Staatstätigkeit aufgrund von demografischen Wandlungsprozessen seit 1990 ausgeweitet werden musste
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit dar: Wie reagiert die Politik auf den demografischen Wandel in Deutschland im Bereich der Rentenpolitik seit 1990? Die Arbeit wird auf die Folgen in der Rentenpolitik seit 1990 beschränkt und nutzt die sozioökonomische Schule, um die Korrelation zwischen Demografie und Staatstätigkeit zu untersuchen.
2. Theorie der sozioökonomischen Schule
Dieser Abschnitt führt in die sozioökonomische Schule als Teil der Policy-Analyse und vergleichenden Staatstätigkeitsforschung ein. Er erklärt die zentrale Annahme der sozioökonomischen Schule, dass Staatstätigkeit als Reaktion auf wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen verstanden wird.
3. Policy-Analyse
Dieses Kapitel untersucht die Reaktion der Politik auf den demografischen Wandel am Beispiel der Rentenpolitik seit 1990. Es beleuchtet den Wandel der Gesellschaft, die Reaktionen der Politik in Form von Rentenreformen, die sozioökonomischen Determinanten und die Auswertung der Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: demografischer Wandel, Rentenpolitik, sozioökonomische Schule, Staatstätigkeit, Policy-Analyse, Deutschland, Rentenreform.
Häufig gestellte Fragen
Wie reagiert die deutsche Politik auf den demografischen Wandel in der Rentenpolitik?
Die Arbeit untersucht verschiedene Rentenreformen seit 1990 (unterteilt in die Phasen 1990-1999, 2000-2004 und 2005-2016), um zu zeigen, wie der Gesetzgeber auf die alternde Gesellschaft reagiert.
Was besagt die Theorie der sozioökonomischen Schule?
Diese Theorie geht davon aus, dass staatliches Handeln (Staatstätigkeit) primär eine Reaktion auf wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen, wie eben den demografischen Wandel, ist.
Gibt es eine Korrelation zwischen Demografie und Staatstätigkeit?
Ja, die Arbeit prüft die Hypothese, dass die Staatstätigkeit aufgrund von demografischen Wandlungsprozessen gezwungen ist, sich auszuweiten oder anzupassen, um die Systeme der sozialen Sicherung stabil zu halten.
Was ist das Ziel der Policy-Analyse in dieser Hausarbeit?
Sie dient dazu, die konkreten politischen Maßnahmen und Reformen im Bereich der Rente seit 1990 systematisch zu untersuchen und deren Wirksamkeit in Bezug auf den demografischen Wandel zu bewerten.
Welche sozioökonomischen Determinanten sind für die Rentenpolitik entscheidend?
Dazu gehören vor allem die Bevölkerungsstruktur (Alterung), die Geburtenraten und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die den Spielraum für staatliche Rentenzahlungen festlegen.
- Quote paper
- Anna Stöckl (Author), 2016, Sozioökonomischen Determinanten. Die Reaktion der Politik auf den Wandel durch die Renten-Reformen seit 1990, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373682