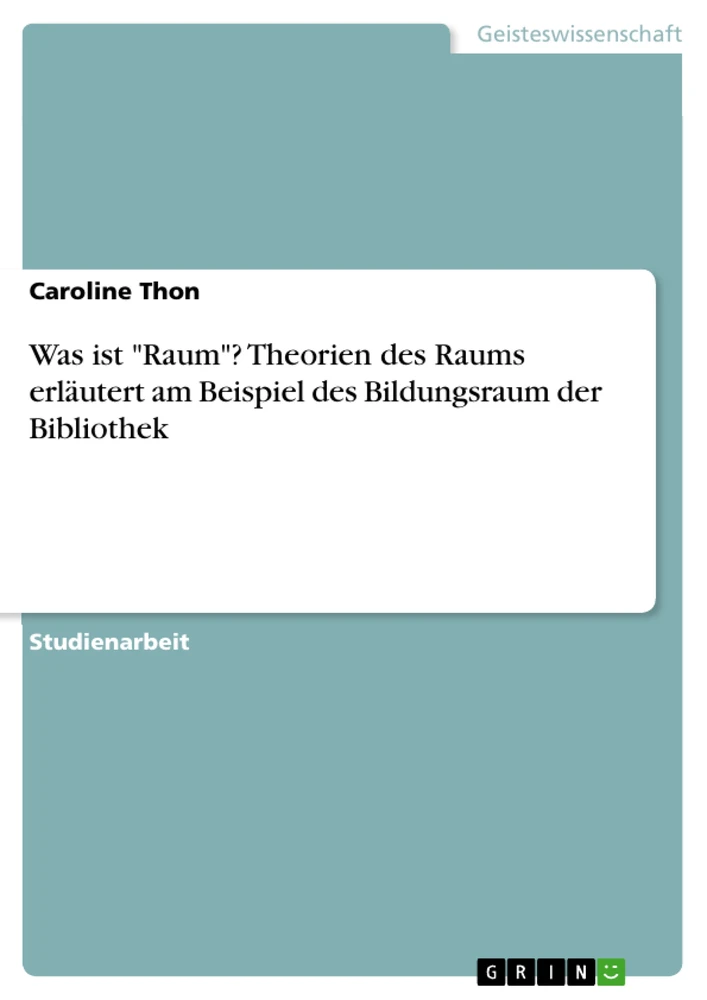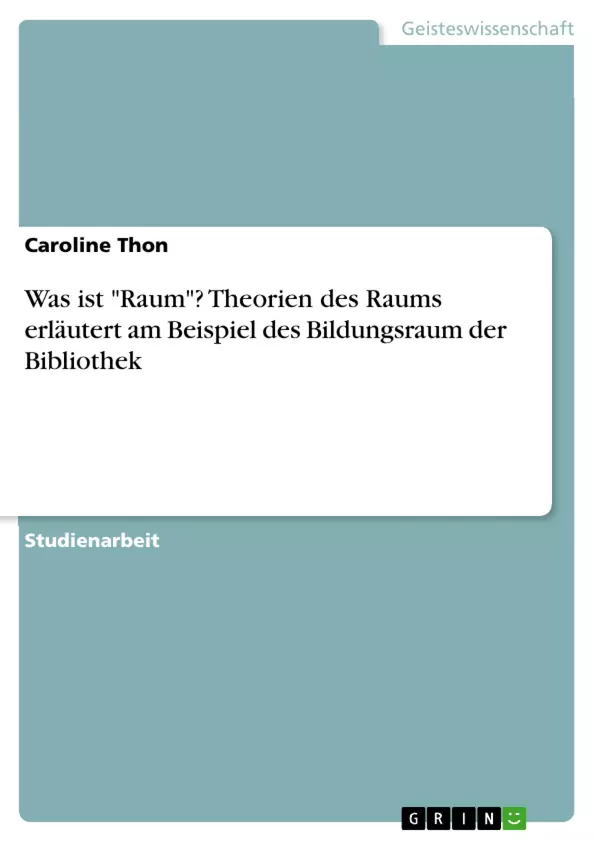Die folgende Arbeit umfasst die Bibliothek als offenen Bildungsraum sowohl unter dem Aspekt des phänomenologischen Raumverständnisses als auch der Raumsoziologie, die im Anschluss zum näheren Verständnis kurz definiert und erläutert werden. Die Anwendung der Raumtheorien auf den gewählten Bildungsraum stützen sich insbesondere auf die Texte "Der offene Raum". Handlungs-Räume in Kunst und Kunstvermittlung von Bill Masuch sowie "Raumsoziologie" von Martina Löw, welche die Basis und das Grundkonzept stellen, auf dem weitergehend eigene Ideen entwickelt und erläutert werden sollen. Es soll unter anderem auch der Frage nachgegangen werden, was Raum eigentlich ist, wie die Menschen ihn heutzutage wahrnehmen und versuchen zu definieren, ob es so etwas wie ein allgemeines Raumverständnis überhaupt gibt und ob nicht Raum sogar ein menschengemachtes Korrelat zur Einheit Zeit ist.
Wenn wir uns heute, ohne uns näher mit dem Raum in der Physik, Raumtheorien oder einem weiterführenden Raumbegriff beschäftigt zu haben, fragen, was Raum eigentlich ist, haben wir meist konkrete dreidimensionale Modelle von Innenraum in unseren Köpfen, die einem rechteckigen Kasten mit sich darin befindlichen Objekten sehr ähnlich sehen. In seiner einfachsten Form ist dieser Kasten vergleichbar mit einem Zimmer, in seinen komplexeren Darstellungsweisen bildet er die Basis, Objekte und Subjekte die miteinander in Relation stehen, zu verbinden. Es gibt wie bei der Zeit kein konkretes Ende oder einen konkreten Anfang, sondern lediglich Abschnitte, welche von Menschen festgelegt wurden.
Das Verständnis von Raum hat sich in der heutigen Zeit gewandelt. Während man früher den Raum noch als etwas Rechteckiges, in sich geschlossenes wahrnahm - also folglich einer Art Behältnis für jene Dinge, die er umgibt - wird heutzutage mehr von einem „relativistischen Raumverhältnis“ ausgegangen, welches eine Beziehungsstruktur zwischen konstant bewegten Körpern umreißt. Es haben sich eine Vielzahl an Raumtheorien entwickelt und verbreitet, von denen die Raumsoziologie ebenso wie die phänomenologische Raumtheorie nur zwei aus einer ganzen Reihe von Sichtweisen repräsentieren und somit auch nur ein abgegrenztes Spektrum der Möglichkeiten abdecken.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung: Der weitergeführte Raumbegriff
- II. Begriffe
- II.1. Raumsoziologie
- II.2. Die phänomenologische Raumtheorie
- III. Formale Beschreibung des gewählten Bildungsraumes
- III.1. Die Bibliothek als öffentlicher Raum
- IV. Moderne Raumtheorien auf den öffentlichen Raum angewandt
- V. Der veränderte Raum
- V.1. Der geschlossene Raum
- V.2. Der geöffnete Raum
- VI. Fazit: Der unendliche Raum
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Raumbegriff anhand einer Fallstudie: der Universitätsbibliothek Oldenburg. Ziel ist es, verschiedene Raumtheorien, insbesondere die Raumsoziologie und die phänomenologische Raumtheorie, auf einen konkreten, öffentlichen Bildungsraum anzuwenden und dessen Charakteristika zu analysieren. Dabei wird der Wandel des Raumverständnisses von einem statischen hin zu einem relationalen Konzept beleuchtet.
- Der Wandel des Raumverständnisses in der Gesellschaft
- Anwendung der Raumsoziologie auf einen öffentlichen Raum
- Anwendung der phänomenologischen Raumtheorie auf einen öffentlichen Raum
- Die Bibliothek als öffentlicher Bildungsraum
- Der öffentliche Raum als relationales Konzept
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Der weitergeführte Raumbegriff: Die Einleitung führt in die Thematik des Raumbegriffs ein. Sie vergleicht die intuitive Vorstellung von Raum als dreidimensionaler Kasten mit komplexeren, relationalen Raumverständnissen. Es wird hervorgehoben, dass sich das Verständnis von Raum im Laufe der Zeit gewandelt hat, von einer statischen hin zu einer dynamischen, relationalen Sichtweise. Die Arbeit wird als Anwendung verschiedener Raumtheorien auf den öffentlichen Raum einer Bibliothek angekündigt.
II. Begriffe: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe der Arbeit. Zuerst wird die Raumsoziologie vorgestellt, die den Raum als relationale Anordnung sozialer Güter und Menschen an Orten versteht, über die rein materiellen Grenzen hinausgehend. Anschließend wird die phänomenologische Raumtheorie diskutiert, die den Raum als Substrat der Verknüpfung von Dingen und als Ergebnis einer leiblichen Bezogenheit beschreibt, wobei die subjektive Erfahrung im Mittelpunkt steht. Beide Theorien bilden die Grundlage der weiteren Analyse.
III. Formale Beschreibung des gewählten Bildungsraumes: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Bibliotheksfoyer der Universität Oldenburg als gewählten Fallstudienraum. Die Beschreibung umfasst Architekturmerkmale wie die Glasfront, die Backsteinwände, den Bodenbelag und die Beleuchtung, sowie die Anordnung von Möbeln und Ausstattungselementen. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der räumlichen Struktur und ihrer Auswirkung auf die Nutzung des Raumes als öffentlicher Bildungsraum.
Schlüsselwörter
Raumsoziologie, Phänomenologische Raumtheorie, Öffentlicher Raum, Bildungsraum, Bibliothek, Raumverständnis, Relationale Anordnung, Subjektive Erfahrung, Offener Raum, Geschlossener Raum.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Raumbegriffs in einer Universitätsbibliothek
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Raumbegriff anhand einer Fallstudie: der Universitätsbibliothek Oldenburg. Sie wendet verschiedene Raumtheorien, insbesondere die Raumsoziologie und die phänomenologische Raumtheorie, auf einen konkreten, öffentlichen Bildungsraum an und analysiert dessen Charakteristika. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Wandel des Raumverständnisses von einem statischen hin zu einem relationalen Konzept.
Welche Raumtheorien werden angewendet?
Die Arbeit bezieht sich hauptsächlich auf die Raumsoziologie und die phänomenologische Raumtheorie. Die Raumsoziologie betrachtet den Raum als relationale Anordnung sozialer Güter und Menschen, während die phänomenologische Raumtheorie den Raum als Substrat der Verknüpfung von Dingen und als Ergebnis leiblicher Bezogenheit beschreibt, wobei die subjektive Erfahrung im Mittelpunkt steht.
Welche Fallstudie wird untersucht?
Die Fallstudie konzentriert sich auf die Universitätsbibliothek Oldenburg, genauer gesagt auf das Bibliotheksfoyer. Die Analyse umfasst die Beschreibung der Architekturmerkmale (Glasfront, Backsteinwände, Bodenbelag, Beleuchtung, Möblierung etc.) und deren Auswirkungen auf die Nutzung des Raumes als öffentlicher Bildungsraum.
Wie wird der Raumbegriff in der Arbeit definiert?
Die Arbeit vergleicht die intuitive Vorstellung von Raum als dreidimensionaler Kasten mit komplexeren, relationalen Raumverständnissen. Sie beleuchtet den Wandel des Raumverständnisses in der Gesellschaft von einer statischen hin zu einer dynamischen, relationalen Sichtweise.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung (Der weitergeführte Raumbegriff), Begriffe (Raumsoziologie und phänomenologische Raumtheorie), Formale Beschreibung des gewählten Bildungsraumes (Bibliotheksfoyer Oldenburg), Moderne Raumtheorien auf den öffentlichen Raum angewandt, Der veränderte Raum (geschlossener und geöffneter Raum) und Fazit (Der unendliche Raum).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Raumsoziologie, Phänomenologische Raumtheorie, Öffentlicher Raum, Bildungsraum, Bibliothek, Raumverständnis, Relationale Anordnung, Subjektive Erfahrung, Offener Raum, Geschlossener Raum.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung besteht darin, verschiedene Raumtheorien auf einen konkreten öffentlichen Bildungsraum (die Universitätsbibliothek Oldenburg) anzuwenden und dessen Charakteristika zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet den Wandel des Raumverständnisses und untersucht den öffentlichen Raum als relationales Konzept.
- Arbeit zitieren
- Caroline Thon (Autor:in), 2017, Was ist "Raum"? Theorien des Raums erläutert am Beispiel des Bildungsraum der Bibliothek, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373747