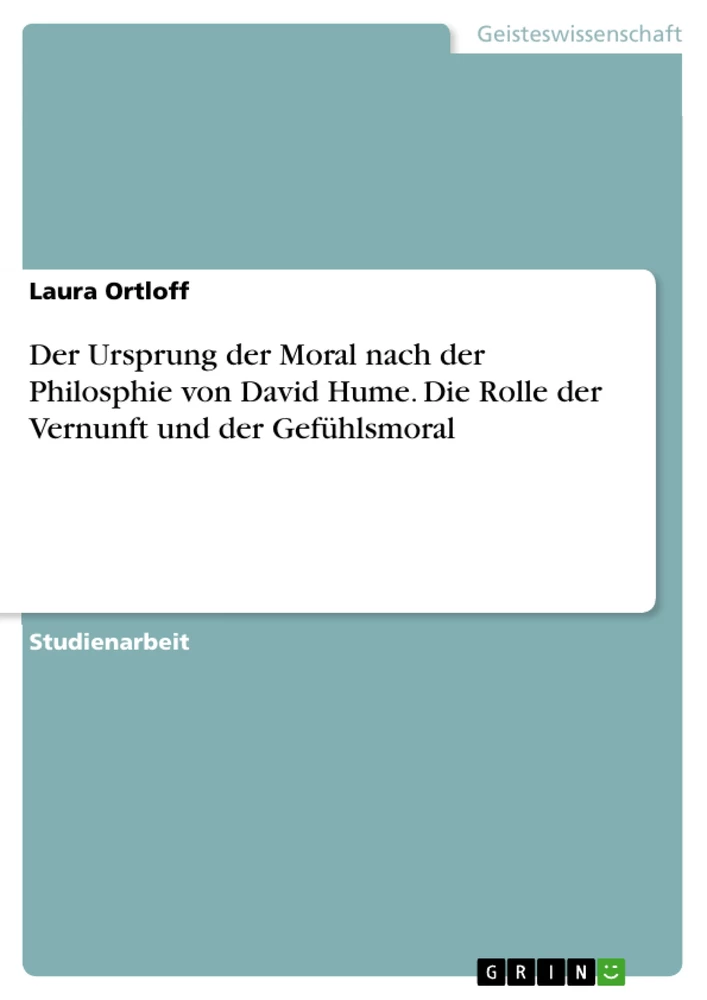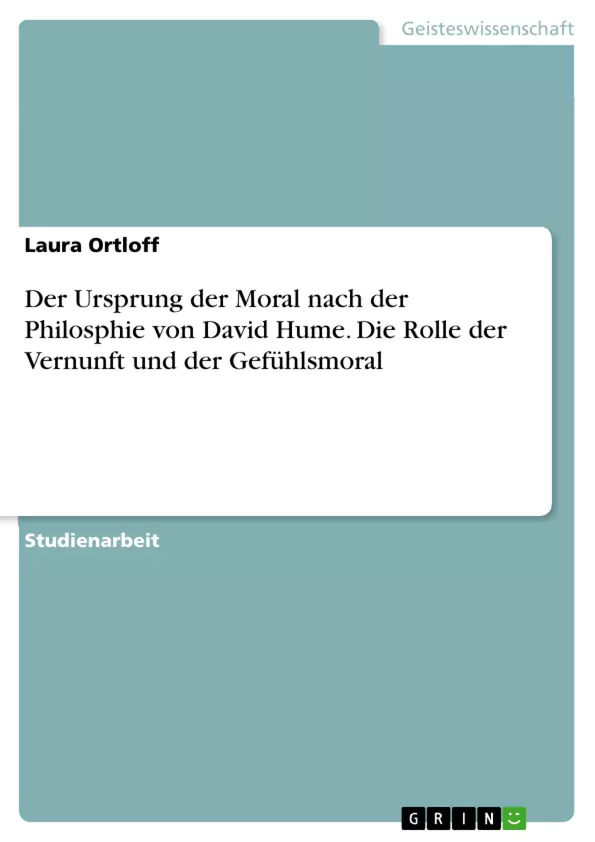Im Interesse dieser Arbeit steht die Frage nach dem Ursprung der Moral bei David Hume. Dabei wird überprüft, inwieweit sich diese Frage überhaupt eindeutig für die Vernunft oder für das Gefühl entscheiden kann oder ob nicht vielmehr beide ihren Anteil zur Entstehung moralischer Urteile beitragen. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit untersucht, wie Hume die Entstehung unserer moralischen Urteile unter anderem mit Hilfe von Nützlichkeitserwägungen und dem Allgemeininteresse konzipiert. Dabei wird der Autor auch auf den Relativismusvorwurf zu sprechen kommen, um anschließend die Wichtigkeit der Sympathie in Humes Moralphilosophie hervorzuheben. Abschließend wird geklärt, welche Rolle die Vernunft bei der Entstehung unserer moralischen Urteile spielt, um gegebenenfalls den anfänglichen Anschein einer reinen Gefühlsmoral zu berichtigen.
Der Mensch ist einerseits ein einzigartiges und autonomes Wesen, andererseits ist er ebenso auf das Zusammenleben in einer Gemeinschaft angewiesen. Mit anderen Worten, der Einzelne ist sowohl Individuum als auch Sozialwesen. Dabei sind es bestimmte Regeln des gegenseitigen Umgangs miteinander, die eingehalten werden müssen, um das gesellschaftlich strukturierte Zusammenleben zu bewahren. Diese Regeln werden gemeinhin unter den Begriff der Moral zusammengefasst. Soziale Gemeinschaft wäre ohne Moral nicht denkbar.
Doch woher kommt diese Moral? Worin liegt der Ursprung unserer moralischen Unterscheidungen und aus welchem Grund halten es Individuen für sinnvoll, diese anzunehmen und zu befolgen? Diese Fragen untersucht David Hume unter anderem in seinem zweiten und dritten Buch des Traktats sowie in der gesamten Untersuchung über die Prinzipien der Moral. In seiner Moralphilosophie wird deutlich, dass er grundsätzlich zwischen zwei Ursprungskandidaten für unsere moralischen Überzeugungen und Urteile unterscheidet: Vernunft und Gefühl.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Moralische Urteile
- Eigeninteresse und Allgemeininteresse
- Der Relativismusvorwurf
- Das Prinzip der Sympathie
- Voreingenommenheit des Mitgefühls
- Die Idee des verständnisvollen Beobachters
- Die Rolle der Vernunft
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Ursprung der Moral bei David Hume und analysiert, ob Vernunft oder Gefühl die entscheidende Rolle in der Entstehung moralischer Urteile spielen. Die Untersuchung zielt darauf ab, zu beleuchten, wie Hume die Entstehung unserer moralischen Urteile mit Hilfe von Nützlichkeitserwägungen und dem Allgemeininteresse konzipiert. Dabei werden auch der Relativismusvorwurf sowie die Bedeutung der Sympathie in Humes Moralphilosophie beleuchtet. Die Rolle der Vernunft in der Entstehung moralischer Urteile wird ebenfalls analysiert, um gegebenenfalls den anfänglichen Anschein einer reinen Gefühlsmoral zu berichtigen.
- Der Ursprung der Moral bei David Hume
- Die Rolle von Vernunft und Gefühl in der Entstehung moralischer Urteile
- Nützlichkeitserwägungen und das Allgemeininteresse in Humes Moralphilosophie
- Der Relativismusvorwurf und die Bedeutung der Sympathie
- Die Rolle der Vernunft in der Entstehung moralischer Urteile
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Ursprungs der Moral bei David Hume ein und stellt die Forschungsfrage nach der Bedeutung von Vernunft und Gefühl in der Entstehung moralischer Urteile. Der Hauptteil befasst sich mit verschiedenen Aspekten von Humes Moralphilosophie, u.a. mit dem Wesen der moralischen Unterscheidung, der Rolle von Eigeninteresse und Allgemeininteresse, dem Relativismusvorwurf, dem Prinzip der Sympathie und der Bedeutung der Vernunft.
Schlüsselwörter
Moral, David Hume, Vernunft, Gefühl, Nützlichkeit, Allgemeininteresse, Relativismus, Sympathie, verständnisvoller Beobachter.
Häufig gestellte Fragen
Was ist laut David Hume der Ursprung der Moral?
Hume sieht den Ursprung der Moral primär im Gefühl, insbesondere in der Sympathie, wobei die Vernunft eine unterstützende Rolle bei der Beurteilung von Nützlichkeit spielt.
Welche Rolle spielt die Sympathie in Humes Philosophie?
Sympathie ist das Prinzip, das es uns ermöglicht, am Schicksal anderer teilzunehmen. Sie ist die Grundlage für soziale Gemeinschaft und moralische Billigung.
Wie hängen Moral und Nützlichkeit zusammen?
Moralische Urteile basieren oft auf Nützlichkeitserwägungen für das Allgemeininteresse. Handlungen, die der Gesellschaft nützen, werden als moralisch gut empfunden.
Was ist die Funktion des "verständnisvollen Beobachters"?
Der verständnisvolle Beobachter ist ein theoretisches Konstrukt, um moralische Urteile von persönlicher Voreingenommenheit zu befreien und eine objektivere Perspektive einzunehmen.
Ist Humes Moralphilosophie relativistisch?
Die Arbeit setzt sich mit dem Relativismusvorwurf auseinander und zeigt, wie Hume durch allgemeine Prinzipien der menschlichen Natur eine überindividuelle Moral begründet.
Kann die Vernunft allein moralische Urteile fällen?
Nein, für Hume ist die Vernunft allein „Sklavin der Affekte“. Sie kann zwar Fakten klären, aber der moralische Impuls (Billigung oder Missbilligung) stammt immer aus dem Gefühl.
- Quote paper
- Laura Ortloff (Author), 2015, Der Ursprung der Moral nach der Philosphie von David Hume. Die Rolle der Vernunft und der Gefühlsmoral, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373954