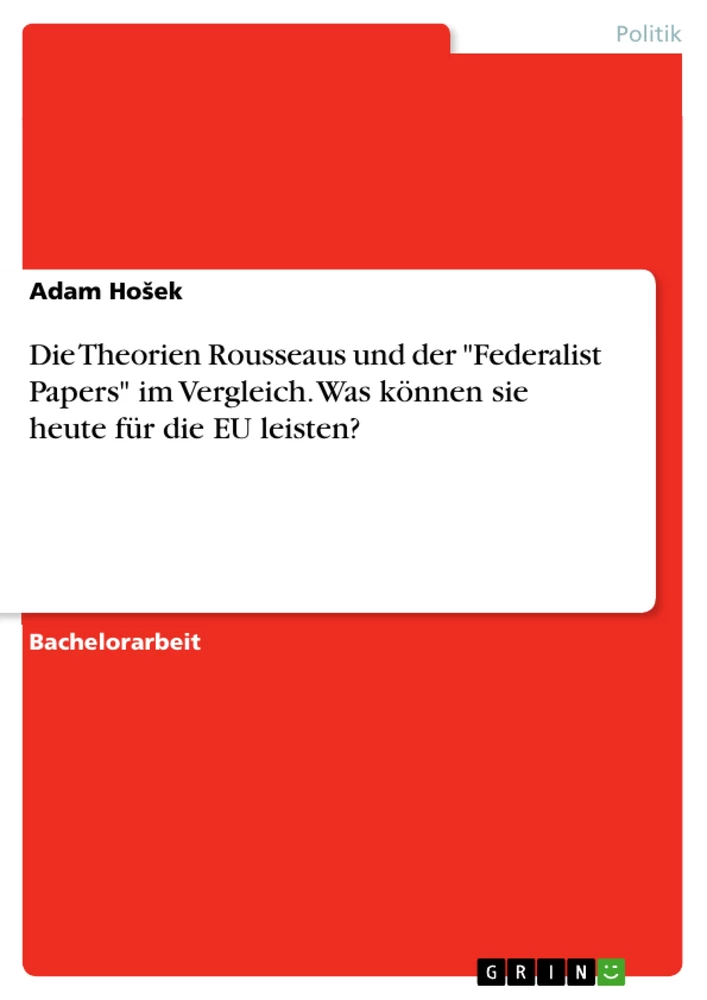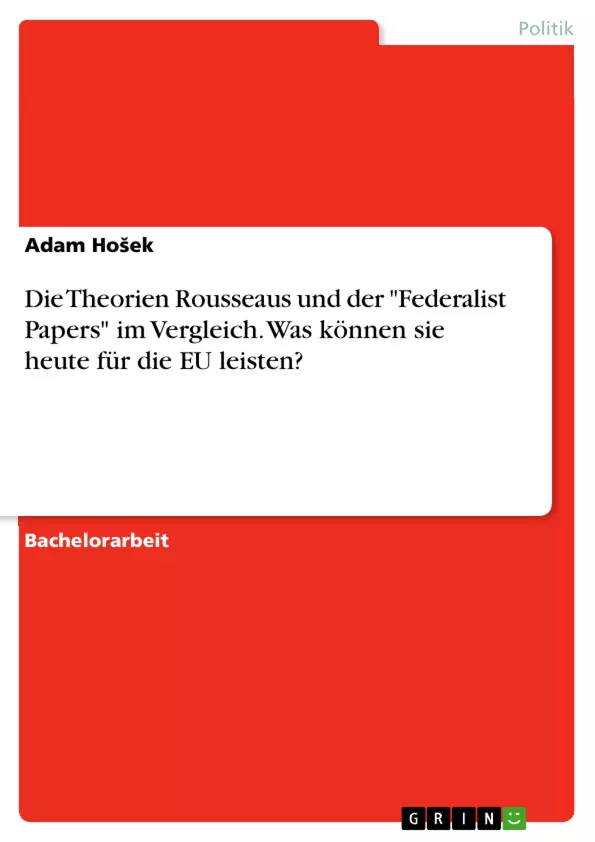Aus dem rechtspopulistischen und/oder europa-skeptischen Spektrum muss sich die EU vermehrt der Frage stellen lassen, ob sie nicht schlicht zu verschiedene Nationalitäten mit ihren spezifischen Kulturen beherbergen würde. Vereinfacht dargestellt ist es eine Frage nach der erforderlichen Homogenität der Gesellschaft - oder ob die Heterogenität die Größe eines Staates einschränkt. Vor diesem Hintergrund sollen in dieser Arbeit zuerst zwei verschiedene Perspektiven von Demokratie und Republik als Staatsverständnis und deren damit einhergehende Konzeptionen des Bürgers und der Ausdehnung der Herrschaft dargestellt werden.
Der erste Teil hat Jean-Jacques Rousseau zum Gegenstand, wobei hier insbesondere auf die Elemente des Naturzustandes, des Allgemeinwohls, der Republik und der Erziehung zum tugendhaften Bürger eingegangen wird. Der zweite Schwerpunkt nimmt die Federalist Papers zur Thematik. Hier gilt es, das spezifische Menschen- und Gesellschaftsbild herauszuarbeiten, auf das Demokratieverständnis zu verweisen, das Republikverständnis und die Repräsentationsnotwendigkeit darzustellen, sowie die Gewaltenteilung in den Fokus zu nehmen.
Im dritten Schritt geht es um eine Gegenüberstellung der beiden Positionen von Rousseau und den Theoremen der Federalist Papers und der Herausarbeitung spezifischer Merkmale, sowohl differenzierend als auch verbindend. Zum Vierten wird der Versuch unternommen in wie fern die dargelegten historischen Positionen im gegenwärtigen europäischen Einheitsprozess einen Transfer leisten können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Jean-Jacques Rousseau
- Rousseaus zeitgenössisches Gesellschaftsbild
- Naturzustand
- Die Eigenschaften des Menschen
- Austritt aus dem Naturzustand - über die sittlich/politische Ungleichheit und die Freiheit
- Der Gesellschaftsvertrag- ein staatstheoretisches Ideal
- Der Allgemeinwille
- Transformation des Freiheitsverständnisses
- Gesetze - der Bürger als Autor und Adressat der Gesetze
- Die Konstruktion der Tugend
- Die "Éducation" zum tugendhaften Bürger
- Politische Anthropologie - Vorbilder für erzieherische Tätigkeiten
- Erziehung
- Unterricht
- Sport - Körperliche Erziehung und Spiele
- Von Festen, Symbolen und dem "Gründungsmythos"
- Die Republik
- Repräsentation
- Die Einteilung in verschiedene Regierungen
- Die Demokratie: ideale Regierungsform der Republik
- Die Größe für sich
- Die Homogenität der Gesellschaft
- Die "Federalist Papers"
- Das Menschenbild und Gesellschaftsverständnis
- Die Faktionen und ihre Wirkung
- Das Demokratieverständnis der Federalist Papers
- Das Republikverständnis und die Notwendigkeit der Repräsentation
- Die Gewaltenteilung
- Die Größe an sich und die Heterogenität der Gesellschaft
- Vergleich zwischen Rousseau und den Federalist Papers
- Rousseau, die Federalist Papers und die EU
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Republikanismus und seiner Relevanz für die EU. Sie analysiert die Theorien von Jean-Jacques Rousseau und den "Federalist Papers" und untersucht, inwiefern diese für die EU relevant sind.
- Das republikanische Staatsverständnis
- Die Rolle des Bürgers in der Republik
- Die Bedeutung von Repräsentation und Gewaltenteilung
- Die Herausforderungen der EU im Lichte republikanischer Theorie
- Die Frage nach der Legitimität und Zukunft der EU
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik des Republikanismus und die EU ein. Es beleuchtet die historische Entwicklung des europäischen Integrationsprozesses und stellt die Frage nach der Staatsform der EU.
Das zweite Kapitel widmet sich den politischen Theorien von Jean-Jacques Rousseau. Es analysiert seine Konzepte von Naturzustand, Gesellschaftsvertrag, Allgemeinwille und Republik. Besonderes Augenmerk wird auf Rousseaus Vorstellungen von Bildung und Erziehung zum tugendhaften Bürger gelegt.
Das dritte Kapitel untersucht die "Federalist Papers" und die darin vertretenen republikanischen Ideen. Es beleuchtet das Menschenbild, die Bedeutung von Faktionen und die Rolle der Repräsentation und Gewaltenteilung in der Republik.
Das vierte Kapitel vergleicht die Theorien von Rousseau und den "Federalist Papers". Es analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Ansichten über die Republik und die Rolle des Bürgers.
Das fünfte Kapitel setzt sich mit der Frage auseinander, inwiefern die Theorien von Rousseau und den "Federalist Papers" für die EU relevant sind. Es untersucht die Herausforderungen der EU im Lichte republikanischer Theorie und diskutiert die Frage nach der Legitimität und Zukunft der EU.
Schlüsselwörter
Republikanismus, EU, Jean-Jacques Rousseau, "Federalist Papers", Bürger, Staatsform, Repräsentation, Gewaltenteilung, Legitimität, Demokratie, Bildung, Erziehung, Gesellschaft, Integration, Europa
- Citation du texte
- Adam Hošek (Auteur), 2014, Die Theorien Rousseaus und der "Federalist Papers" im Vergleich. Was können sie heute für die EU leisten?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373976