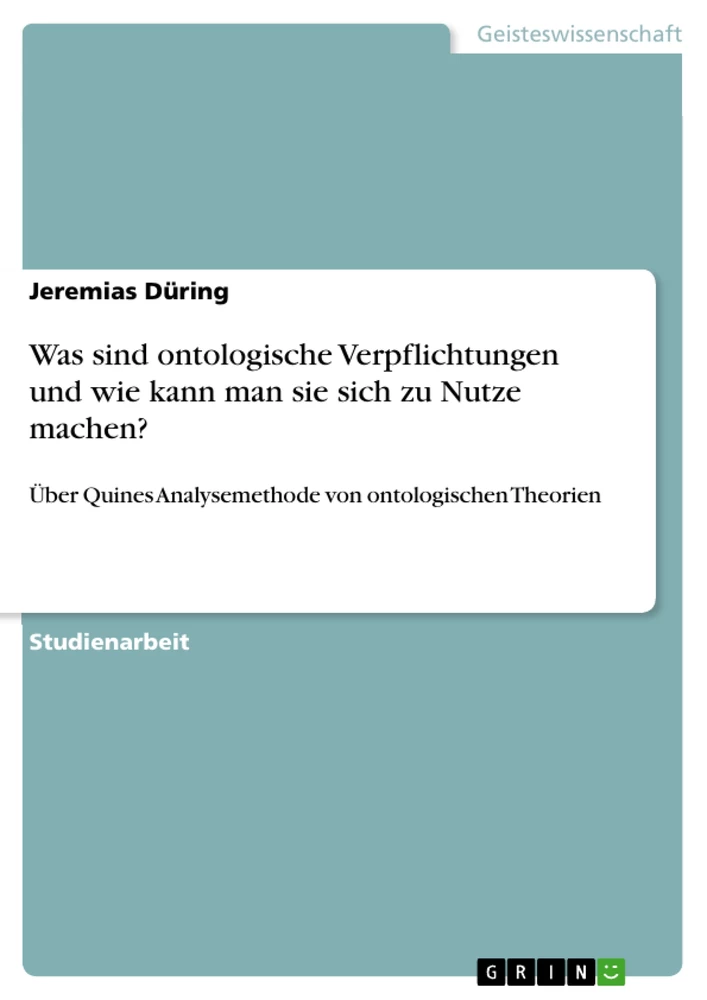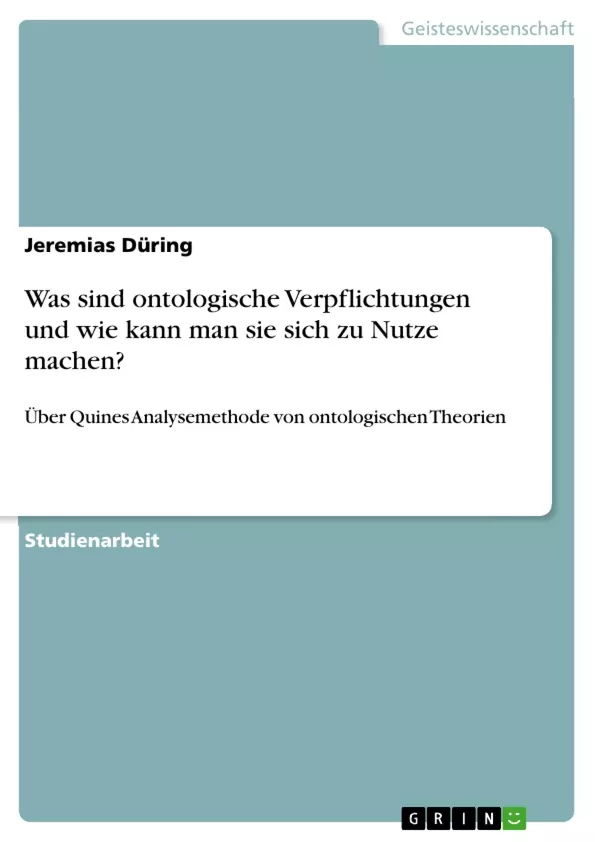Diese Arbeit soll zum Einen aufzeigen, wie Quine den Begriff der ontologischen Verpflichtung erklärt. Um diesen Zusammenhang verständlich zu machen, werde ich im folgenden Kapitel den Argumentationsgang im Bezug auf die negativen Existenzaussagen rekonstruieren. Danach werde ich mich dem zweiten Teil meiner Fragestellung zuwenden. Anhand eines Beispiels aus der sogenannten Universaliendebatte werde ich zeigen, wie sich die logische Analyse der ontologischen Verpflichtungen als philosophisches Entscheidungswerkzeug nutzen lässt. Abschließend werde ich mich mit einigen Schwierigkeiten befassen und bewerten, inwieweit sich Quines Methode als Entscheidungshilfe eignet.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts stürzte die Ontologie durch die Schriften der Logischen Empiristen in eine schwere Krise. Ihnen zufolge seien ontologische Fragen empirisch unlösbar und damit belanglos. Dieser vernichtenden Behauptung zum Trotz entwickelte der amerikanische Philosoph Willard Van Orman Quine in seinem Aufsatz "On What There Is" von 1948 ein neues Verständnis von Ontologie. Diese soll nun nicht mehr die Welt, sondern vielmehr unsere Theorien über die Welt zum Gegenstand haben.
Als Ausgangspunkt für seine Argumentation dient Quine die vermeintlich einfache Frage: Was gibt es? Die zunächst naheliegende Antwort sei sogar noch kürzer als die Frage selbst: Es gibt Alles. Wer dies sagt, äußert im Grunde nur eine Tautologie. Er sagt nichts anderes, als dass es die Dinge gibt, die es gibt. Deshalb ist eine genauere Untersuchung des Problems dringend erforderlich. Zahlreiche Einzelfälle, bei denen man sich auch nach Jahrhunderten des philosophischen Disputes nicht einig wird, behindern eine zufriedenstellende Beantwortung der Ausgangsfrage. Einer dieser Einzelfälle ist das Problem der negativen Existenzaussagen. Durch eine ausführliche Erörterung dieses Problems leistet Quine die Vorarbeit, um auf den für sein Ontologieverständnis entscheidenden Begriff der ontologischen Verpflichtung zu stoßen. Als zweiten Schritt entwirft er eine Methode zur logischen Analyse jener Verpflichtungen, die ein probates Mittel sei, um zwischen Theorien über die Welt abwägen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Problem: Platons Bart
- 2.1 Widerlegung des Platonischen und Meinongschen Ansatzes
- 2.2 Quines Lösung
- 3. Die ontologische Verpflichtung
- 4. Anwendungsbeispiel: Universalienstreit
- 5. Bewertung der Quineschen Methode
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Willard Van Orman Quines Ansatz zur Ontologie, insbesondere seinen Begriff der ontologischen Verpflichtung und dessen Anwendung. Sie rekonstruiert Quines Argumentation zur Behandlung negativer Existenzaussagen und zeigt anhand eines Beispiels aus der Universalien-Debatte die praktische Anwendung seiner Methode auf. Die Arbeit bewertet abschließend die Stärken und Schwächen von Quines Ansatz als Instrument philosophischer Entscheidungsfindung.
- Quines Kritik an traditionellen ontologischen Ansätzen
- Der Begriff der ontologischen Verpflichtung bei Quine
- Anwendung von Quines Methode auf den Universalienstreit
- Bewertung der analytischen Leistungsfähigkeit von Quines Methode
- Die Frage nach dem Nutzen ontologischer Annahmen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Problematik der Ontologie im 20. Jahrhundert ein, insbesondere die Kritik der logischen Empiristen. Sie stellt Quines neuen ontologischen Ansatz vor, der sich nicht mit dem Sein der Welt, sondern mit unseren Theorien darüber befasst. Die zentrale Frage "Was gibt es?" wird als Ausgangspunkt für die Argumentation eingeführt und die Schwierigkeit ihrer Beantwortung anhand des Problems negativer Existenzaussagen erläutert. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau: Rekonstruktion von Quines Argumentation zu negativen Existenzaussagen, Anwendung seiner Methode auf die Universalien-Debatte und abschließende Bewertung.
2. Das Problem: Platons Bart: Dieses Kapitel behandelt Quines Auseinandersetzung mit dem Problem des Nicht-Seienden, das er "Platons Bart" nennt. Quine diskutiert mit zwei fiktiven Gegnern, McX (der einen platonischen Standpunkt vertritt) und Wyman (der die Meinongsche Theorie verwendet), um die Schwierigkeiten traditioneller Ansätze aufzuzeigen. Die Debatte konzentriert sich auf die Behandlung von negativen Existenzaussagen (z.B. "Pegasus existiert nicht") und die Probleme leerer Namen. Quine kritisiert die Verwechslung von Idee und Gegenstand sowie die unkontrollierbare Vermehrung von Entitäten, die aus der Annahme nicht-aktueller Möglichkeiten resultiert.
2.1 Widerlegung des Platonischen und Meinongschen Ansatzes: Dieser Abschnitt detailliert die Widerlegung der platonischen und meinongschen Positionen durch Quine. Er kritisiert McXs Argumentation, die auf der Annahme einer "Idee" von Pegasus beruht, als Verwechslung von Bedeutung und Referenz. Die Meinongsche Unterscheidung von Existenz und Subsistenz wird als problematisch dargestellt, da sie zu einem "übervölkerten Universum" an Möglichkeiten führt, das keine klaren Unterscheidungskriterien zulässt und somit die Identifizierung von Entitäten unmöglich macht. Quine betont den Grundsatz "no entity without identity".
Schlüsselwörter
Ontologie, Willard Van Orman Quine, ontologische Verpflichtung, negative Existenzaussagen, Platons Bart, Meinong, Universalienstreit, logische Analyse, analytische Philosophie.
Häufig gestellte Fragen zu: Quines Ansatz zur Ontologie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Willard Van Orman Quines Ansatz zur Ontologie, insbesondere seinen Begriff der ontologischen Verpflichtung und dessen Anwendung auf die Behandlung negativer Existenzaussagen. Sie analysiert Quines Kritik an traditionellen ontologischen Ansätzen und bewertet die Stärken und Schwächen seiner Methode.
Welche Problematik wird im Zusammenhang mit "Platons Bart" behandelt?
Das Kapitel "Platons Bart" befasst sich mit Quines Auseinandersetzung mit dem Problem des Nicht-Seienden. Quine kritisiert die traditionellen Ansätze von Platon und Meinong, die mit der Behandlung negativer Existenzaussagen (z.B. "Pegasus existiert nicht") Schwierigkeiten haben. Er zeigt die Probleme der Verwechslung von Idee und Gegenstand sowie die unkontrollierbare Vermehrung von Entitäten auf, die aus der Annahme nicht-aktueller Möglichkeiten resultiert.
Wie widerlegt Quine die platonische und meinongsche Position?
Quine widerlegt die platonische Position, indem er die Verwechslung von Bedeutung und Referenz kritisiert. Die Meinongsche Unterscheidung von Existenz und Subsistenz wird als problematisch dargestellt, da sie zu einem "übervölkerten Universum" an Möglichkeiten führt, das keine klaren Unterscheidungskriterien zulässt. Quine betont den Grundsatz "no entity without identity".
Was versteht Quine unter ontologischer Verpflichtung?
Die Arbeit erläutert Quines Begriff der ontologischen Verpflichtung im Detail, jedoch wird im gegebenen Text nicht explizit definiert, was genau Quine darunter versteht. Die Arbeit konzentriert sich auf die Anwendung und die Kritik an diesem Konzept.
Wie wird Quines Methode auf den Universalienstreit angewendet?
Der Text erwähnt die Anwendung von Quines Methode auf den Universalienstreit als Anwendungsbeispiel, jedoch fehlt im gegebenen Auszug eine detaillierte Beschreibung dieser Anwendung.
Welche Schlüsselwörter sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Ontologie, Willard Van Orman Quine, ontologische Verpflichtung, negative Existenzaussagen, Platons Bart, Meinong, Universalienstreit, logische Analyse, analytische Philosophie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Das Problem: Platons Bart (mit Unterkapitel 2.1 Widerlegung des Platonischen und Meinongschen Ansatzes und 2.2 Quines Lösung), Die ontologische Verpflichtung, Anwendungsbeispiel: Universalienstreit, Bewertung der Quineschen Methode und Fazit.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit rekonstruiert Quines Argumentation zur Behandlung negativer Existenzaussagen und zeigt anhand eines Beispiels aus der Universalien-Debatte die praktische Anwendung seiner Methode. Sie bewertet abschließend die Stärken und Schwächen von Quines Ansatz als Instrument philosophischer Entscheidungsfindung.
- Quote paper
- Jeremias Düring (Author), 2015, Was sind ontologische Verpflichtungen und wie kann man sie sich zu Nutze machen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374078