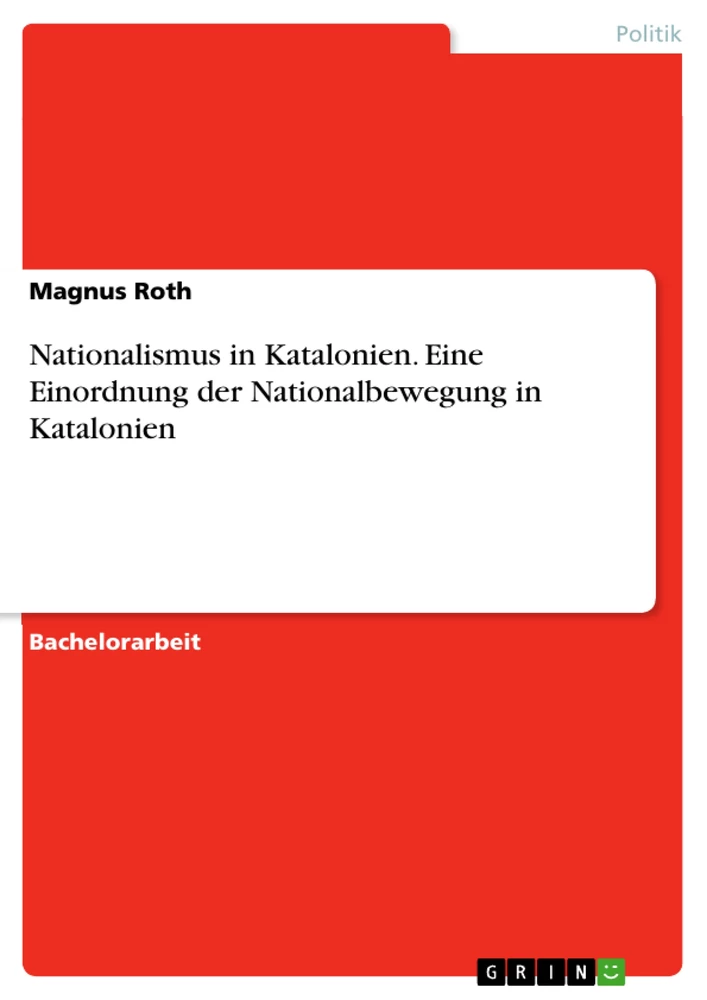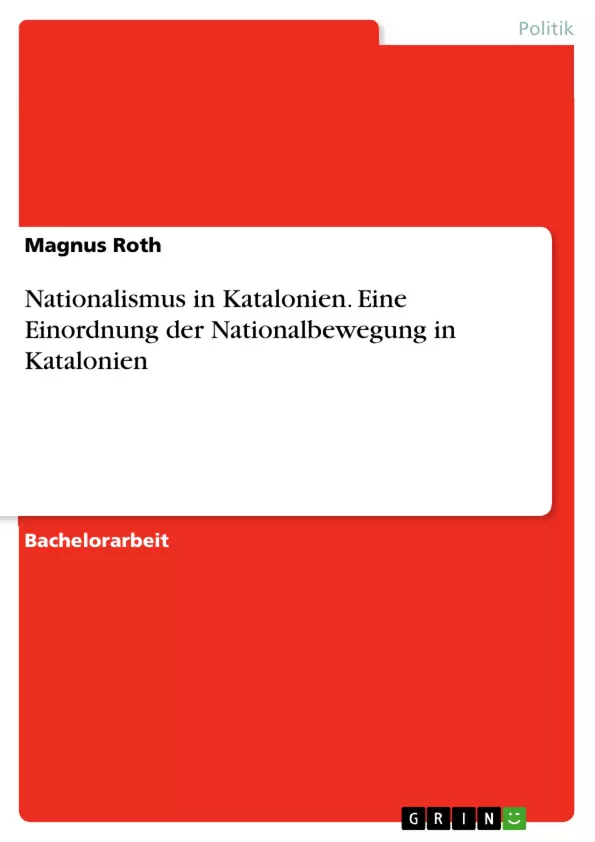Am 09. November 2014 wurde in Katalonien ein Referendum über die Unabhänigkeit der Autonomen Gemeinschaft von Spanien durchgeführt, jedoch nicht von der katalanischen Regierung organisiert und auch nicht offiziell, sondern als symbolische Abstimmung. Doch wie kommt es, dass fast zwei Millionen Bürger an einem inoffiziellen Referendum teilgenommen haben? Woher kommt die Intention, das bisherige spanische Staatsgebilde in Frage zu stellen und für einen unabhängigen Staat zu kämpfen? Sind diese Intentionen auf ökonomischer, kultureller oder historischer Basis begründet? Insbesondere die Instrumentalisierung des 11. September 1714, des sogenannten „La Diada“ steht in diesem Kontext im Vordergrund. Doch was ist der Grund, weshalb ein Tag einer militärischen Niederlage gefeiert wird? Das sind die Fragen, die in dieser Arbeit beantwortet werden sollen.
Dabei werden immer wieder mehrere Narrative diskutiert und als Erklärungsversuche herangezogen. Einer fokussiert sich auf die höhere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Kataloniens gegenüber dem übrigen Spanien. Ein weiterer, in diesem Kontext, ist die wirtschaftliche Benachteiligung Barcelonas durch Madrid. Bei dem dritten Erklärungsversuch ist die Betonung auf eine Besonderheit der katalanischen Sprache und Kultur und ihren damit verbundenen Anspruch auf Eigenstaatlichkeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Ansatz und Forschungsperspektive
- Annäherung an Nation, Nationalismus und Nationalstaat
- Forschungsperspektiven und Forschungsdiskurs
- Subjektivistische Definition
- Objektivistische Definition
- Konstruktivistische Definition
- Zwischenposition
- Die Nation ein volatiles Konstrukt
- Untersuchungsdesign
- Modifizierung des Designs
- Katalanischer Nationalismus
- Territoriale Erfassung Kataloniens
- Parteiengefüge in Katalonien
- Der Streit um das Autonomiestatut
- Ökonomisches Verhältnis in Katalonien
- Katalanische Sprache und dessen Bedeutung
- Katalonien Nationalismus und die öffentliche Meinung
- Massenmobilisierungen und ANC in Katalonien
- Katalonien und die internationale Integration
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem katalanischen Nationalismus und dessen Einfluss auf die politische und gesellschaftliche Entwicklung Kataloniens. Sie untersucht die historischen und soziokulturellen Faktoren, die zur Entstehung und Entwicklung des katalanischen Nationalismus geführt haben. Darüber hinaus werden die politischen Strategien und Akteure des katalanischen Nationalismus analysiert, sowie dessen Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Katalonien und Spanien.
- Die Entstehung und Entwicklung des katalanischen Nationalismus
- Die Rolle des katalanischen Nationalismus in der spanischen Politik
- Die Auswirkungen des katalanischen Nationalismus auf die katalanische Gesellschaft
- Die Beziehungen zwischen Katalonien und Spanien im Kontext des katalanischen Nationalismus
- Die Zukunft des katalanischen Nationalismus
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Forschungsgegenstand und die Zielsetzung der Arbeit dar. Sie bietet eine kurze Einführung in den katalanischen Nationalismus und seine Relevanz im heutigen Spanien.
- Theoretischer Ansatz und Forschungsperspektive: Dieses Kapitel erläutert den theoretischen Rahmen der Arbeit und die gewählte Forschungsperspektive. Es werden verschiedene Definitionen von Nation, Nationalismus und Nationalstaat diskutiert und die relevanten Forschungsdiskurse vorgestellt.
- Untersuchungsdesign: Das Kapitel beschreibt das gewählte Untersuchungsdesign und die Methoden, die für die Analyse des katalanischen Nationalismus eingesetzt werden.
- Katalanischer Nationalismus: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse des katalanischen Nationalismus. Es werden die historischen Wurzeln, die soziokulturellen Grundlagen und die politischen Strategien des katalanischen Nationalismus beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Katalanischer Nationalismus, Nation, Nationalstaat, Autonomie, Unabhängigkeit, Geschichte, Sprache, Kultur, Politik, Gesellschaft, Spanien, Katalonien, Referendum, Massenmobilisierung, politische Partizipation.
Häufig gestellte Fragen
Warum fordern viele Katalanen die Unabhängigkeit von Spanien?
Die Gründe liegen in der wirtschaftlichen Stärke der Region, der kulturellen Eigenständigkeit und einer historischen Identität, die sich von Madrid abgrenzt.
Was ist „La Diada“ und welche Bedeutung hat sie?
„La Diada“ am 11. September erinnert an die Niederlage von 1714 und wird heute als Symbol für den katalanischen Widerstand und Nationalstolz gefeiert.
Welche Rolle spielt die katalanische Sprache?
Die Sprache ist ein zentrales Element der katalanischen Identität und dient als Begründung für den Anspruch auf Eigenstaatlichkeit.
Wie wird die ökonomische Situation Kataloniens im Vergleich zu Spanien bewertet?
Katalonien gilt als wirtschaftlicher Motor Spaniens; viele Bürger fühlen sich durch Transferzahlungen an den Zentralstaat benachteiligt.
Was war das Referendum von 2014?
Es war eine inoffizielle, symbolische Abstimmung über die Unabhängigkeit, an der fast zwei Millionen Menschen teilnahmen.
- Quote paper
- Magnus Roth (Author), 2015, Nationalismus in Katalonien. Eine Einordnung der Nationalbewegung in Katalonien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374098