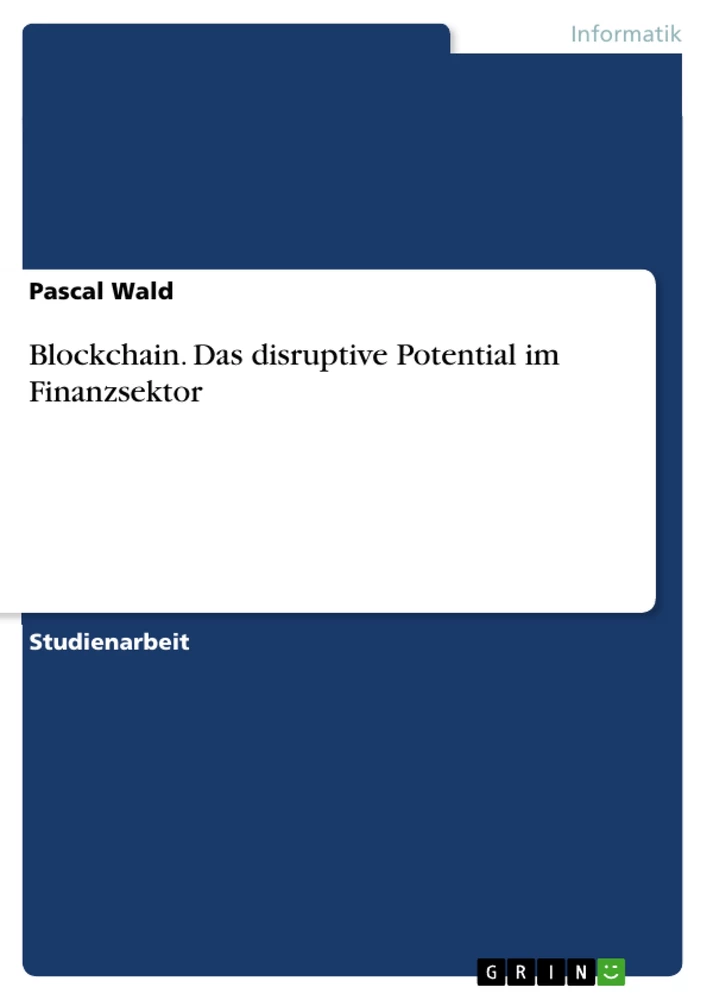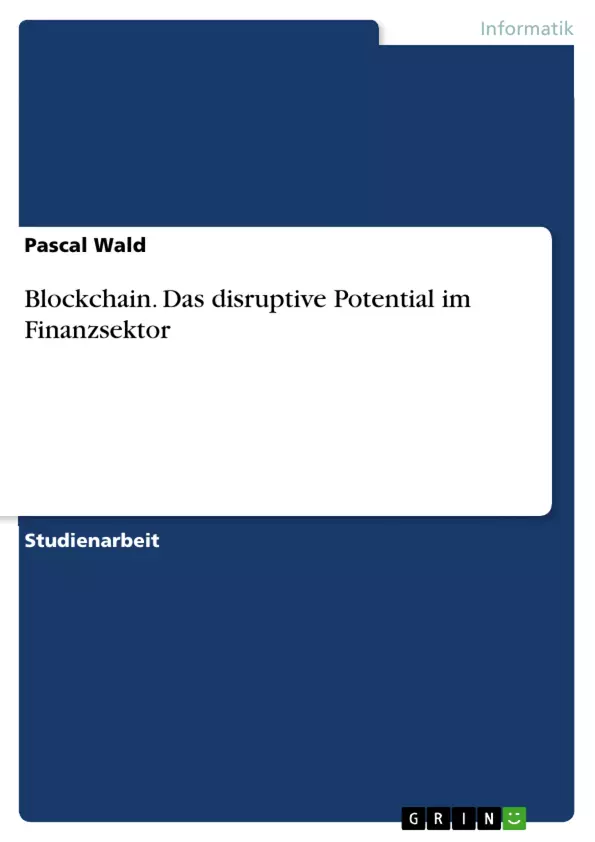Diese Arbeit nimmt es sich zur Aufgabe, einen Überblick über die wesentlichen Möglichkeiten und Grenzen der Blockchain zu geben und auf dieser Grundlage zu bewerten, welches disruptive Potential der Technologie im Bereich des Finanzsektors zugeschrieben werden kann.
Zur Erreichung dieser Zielsetzung werden zunächst begriffliche und theoretische Grundlagen beschrieben. Die Funktionsweise der Blockchain wird am Beispiel der Bitcoins erläutert, um im Folgenden auf die potentiellen Anwendungsfelder und deren Bedeutung für den Finanzsektor eingehen zu können. Zuletzt sollen Kernaussagen konkludiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hintergrund und Relevanz der Blockchain
- Vorgehensweise
- Die Blockchain-Technologie
- Blockchain im Überblick
- Consensus-Mechanismen
- Hashing
- Proof of Work (PoW)
- Ownership und Verschlüsselung
- Bedeutung von Blockchain im Finanzsektor
- Disruption durch Distributed Ledgers
- Zahlungsverkehr
- Wertpapierhandel
- Smart Contracts
- Herausforderungen und Risiken
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert das disruptive Potential der Blockchain-Technologie im Finanzsektor. Sie untersucht die Funktionsweise der Blockchain, ihre Anwendungsmöglichkeiten und die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen.
- Funktionsprinzipien der Blockchain-Technologie
- Einsatzmöglichkeiten der Blockchain im Finanzsektor
- Potenziale und Herausforderungen der Blockchain-Technologie
- Disruptive Auswirkungen der Blockchain auf den Finanzsektor
- Zukünftige Entwicklungen und Trends im Bereich der Blockchain
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert den Hintergrund und die Relevanz der Blockchain-Technologie, wobei auf die Entstehung von Bitcoin und die zunehmenden Investitionen hingewiesen wird. Es wird die Funktionsweise der Blockchain als dezentrale Datenbank und ihr disruptives Potential für den Finanzsektor hervorgehoben. Die Vorgehensweise der Arbeit wird dargelegt, wobei die Schwerpunkte auf die Erläuterung der Blockchain-Technologie, ihre Anwendungsmöglichkeiten im Finanzsektor und die Bewertung ihres disruptiven Potentials liegen.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Blockchain-Technologie. Es werden die Begriffe Blockchain und Distributed Ledger Technology (DLT) erläutert und die Funktionsweise der Blockchain anhand des Beispiels von Bitcoin dargestellt. Die Kapitel beleuchten die Prinzipien der dezentralen Datenverwaltung, die Verwendung von kryptographischen Verfahren und den Konsensmechanismus Proof of Work (PoW).
Im dritten Kapitel wird die Bedeutung der Blockchain im Finanzsektor untersucht. Es werden die disruptiven Auswirkungen der Blockchain auf den Zahlungsverkehr, den Wertpapierhandel und die Anwendung von Smart Contracts analysiert. Des Weiteren werden Herausforderungen und Risiken der Blockchain-Technologie im Finanzsektor betrachtet.
Schlüsselwörter
Blockchain, Distributed Ledger Technology (DLT), Bitcoin, Kryptowährung, Finanzsektor, Zahlungsverkehr, Wertpapierhandel, Smart Contracts, Disruption, Dezentrale Datenbank, Konsensmechanismen, Proof of Work (PoW), Hashing, Ownership, Verschlüsselung, Herausforderungen, Risiken.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Blockchain-Technologie?
Eine Blockchain ist eine dezentrale, chronologisch verkettete Datenbank (Distributed Ledger), in der Transaktionen kryptographisch abgesichert und für alle Teilnehmer nachvollziehbar gespeichert werden.
Wie funktioniert der Konsens-Mechanismus 'Proof of Work'?
Beim Proof of Work (PoW) müssen Netzwerkteilnehmer (Miner) komplexe mathematische Rätsel lösen, um neue Blöcke zu validieren, was Manipulationen extrem rechenintensiv und damit unwirtschaftlich macht.
Welchen Nutzen hat die Blockchain für den Finanzsektor?
Sie ermöglicht schnellere und kostengünstigere Zahlungsverkehrsabwicklungen, effizienteren Wertpapierhandel und die Automatisierung von Verträgen durch Smart Contracts ohne Zwischeninstanzen.
Was sind Smart Contracts?
Smart Contracts sind digitale Verträge, die auf einer Blockchain gespeichert sind und sich automatisch ausführen, sobald vordefinierte Bedingungen erfüllt sind.
Welche Risiken birgt die Blockchain-Technologie?
Herausforderungen sind der hohe Energieverbrauch (bei PoW), rechtliche Unsicherheiten, Skalierungsprobleme und die Gefahr von Sicherheitslücken in den Programmierungen der Smart Contracts.
- Arbeit zitieren
- Pascal Wald (Autor:in), 2017, Blockchain. Das disruptive Potential im Finanzsektor, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374118