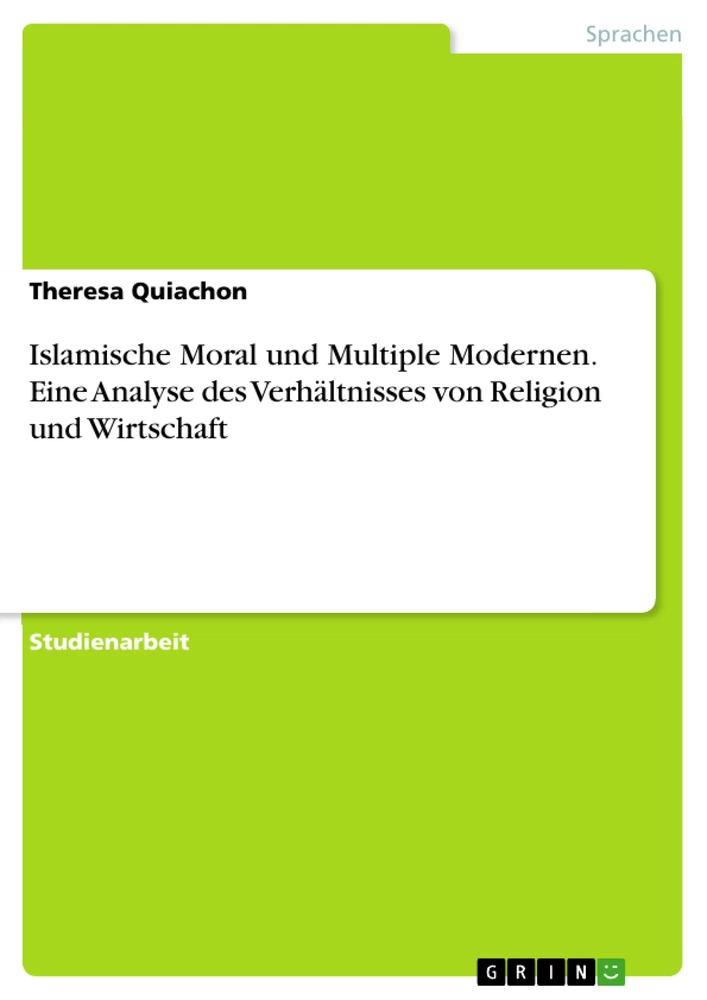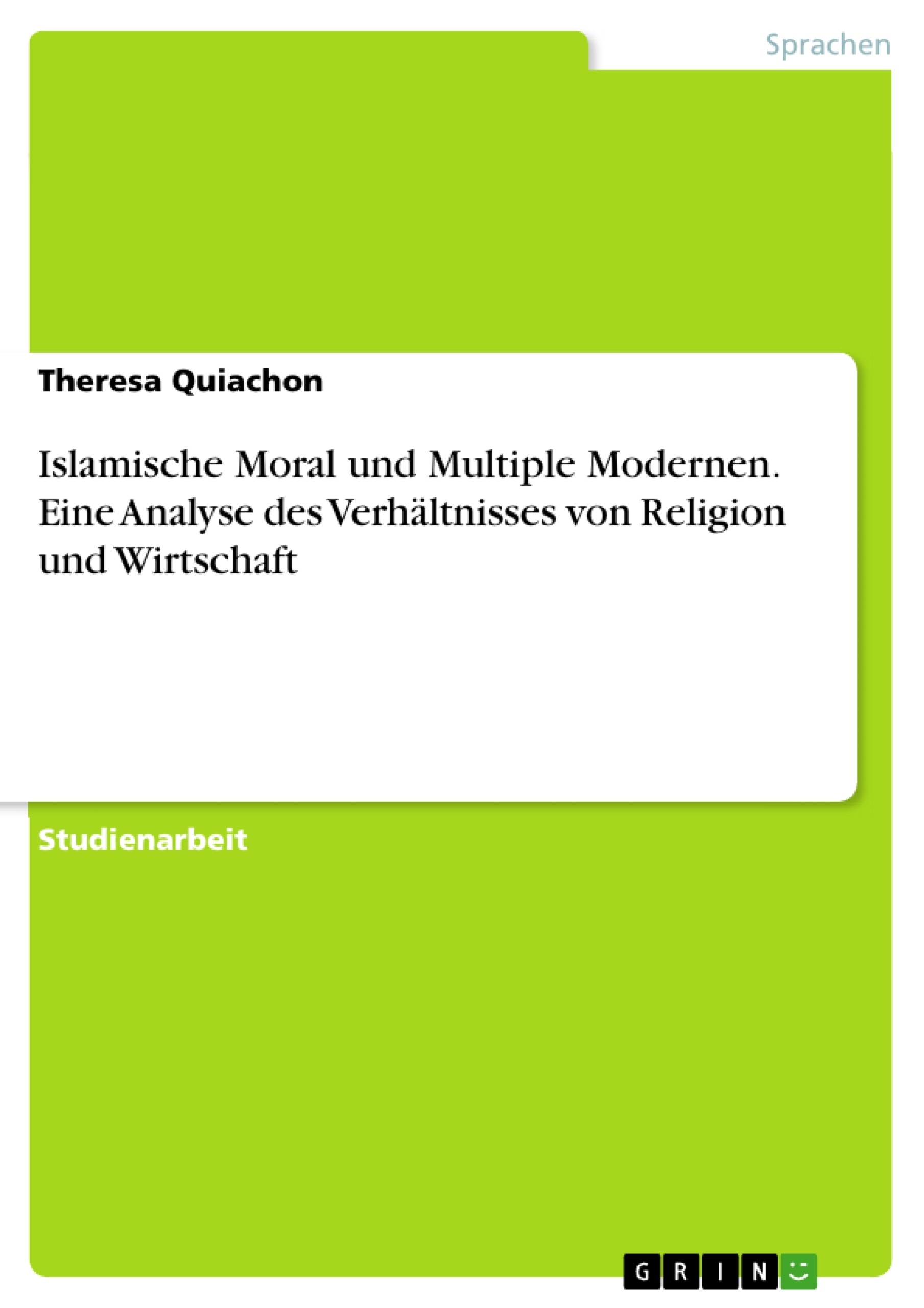In der öffentlichen Wahrnehmung sind in einer scheinbar säkularisierten Welt die Beziehungen von Religion und Wirtschaft auf Diskussionen um die Kirchensteuer und ähnliche Themen beschränkt. Ökonomie und Religion werden zumeist als weitgehend getrennte Bereiche wahrgenommen. Der akademische Diskurs hat hierzu jedoch in den letzten Jahrzehnten eine außerordentliche Fülle an Theorien entwickelt. Häufig werden hier diese Beziehungen mit Klassikern der Religionssoziologie und der Ethnologie wie Emilé Durkheim, Max Weber und Marcel Mauss in Verbindung gebracht. Sie konzentrieren sich jedoch überwiegend auf präkapitalistische Formen des Wirtschaftens.
Ihr Ausgangspunkt ist die Annahme, dass es zwischen der Moderne und Religion ein Spannungsverhältnis gibt, welches langfristig zu einem sozialen Bedeutungsverlust von Religion führt. Dafür verantwortlich gemacht werden insbesondere die mit der Modernisierung verbundenen Prozesse der Rationalisierung, Individualisierung und Ausdifferenzierung von Gesellschaften, die Weber auch mit dem Begriff der „Entzauberung der Welt“ (Weber 1919) beschreibt. Ausgehend von Europa — so die Annahme — werde sich dieses „cultural programm of modernity“ (Eisenstadt 2000) als dominierendes Model auf die restliche Welt übertragen.
Die tatsächlichen Weltwirtschaftlichen Entwicklungen haben gezeigt, dass Modernisierungsprozesse keiner evolutionistischen Einbahnstraße zur westlichen Hegemonie folgen.
Diese Seminararbeit thematisiert deshalb islamische Moralvorstellungen in der sogenannten Moderne und folgt der Fragestellung in welcher Wechselwirkung diese sich mit Ökonomie befinden. Mittels des Konzeptes Multipler Modernen nach Eisenstadt soll am Beispiel von islamischen Ökonomien das Verhältnis von Religion und Wirtschaft beleuchtet werden. Dafür wird in einem ersten Schritt die Theorie des Konzeptes in Bezug auf Eisenstadt und Casanova dargestellt. Anschließend wird ein Fallbeispiel von Kimberly Hart aus einer dörflichen Region in der Türkei herangezogen, um die Grundpfeiler der dort entwickelten moralischen Ökonomie herauszuarbeiten und unter dem Gesichtspunkt von Eisenstadts Theorie zu diskutieren. Das Phänomen Islamic Banking und islamischer Subokönomien sollen anschließend ebenfalls in diesem Kontext verortet werden. Abschließend werden in einem Fazit die Erkenntnisse in Bezug auf die Wechselwirkungen von Religion und Wirtschaft in einer sogenannten modernen Welt zusammengefasst dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Kontext - Religion, Moderne und Säkularität
- Die Säkulare Moderne
- Vielfalt in der Moderne – „Multiple Modernities“
- Islamische Ökonomien in der Moderne
- Entstehung einer islamischen Ökonomie durch den Einfluss kapitalistischer Lohnarbeit
- Analyse der Prozesse in Örselli
- Islamische Ökonomien im Transnationalen Kontext
- Fazit/Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert das Verhältnis von islamischer Moral und Wirtschaft in der sogenannten Moderne. Sie untersucht, wie islamische Moralvorstellungen in modernen Gesellschaften mit ökonomischen Strukturen interagieren. Der Fokus liegt dabei auf dem Konzept der Multiplen Modernen nach Eisenstadt, das die Annahme einer einheitlichen Modernisierung in Frage stellt und die Vielfalt von Modernisierungsprozessen betont. Die Arbeit analysiert islamische Ökonomien als Beispiel für diese Vielseitigkeit.
- Die Interaktion von islamischer Moral und Wirtschaft in modernen Gesellschaften.
- Das Konzept der Multiplen Modernen nach Eisenstadt und seine Relevanz für die Analyse von Religion und Wirtschaft.
- Islamische Ökonomien als Beispiel für die Vielfalt von Modernisierungsprozessen.
- Die Rolle von islamischen Moralvorstellungen in der Gestaltung ökonomischer Strukturen.
- Die Herausforderungen und Chancen, die sich aus dem Zusammenspiel von Religion und Wirtschaft ergeben.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas vor und führt in die Fragestellung ein. Sie zeigt, dass die Beziehung von Religion und Wirtschaft in der öffentlichen Wahrnehmung oft auf vereinfachte Perspektiven beschränkt ist, während die akademische Forschung eine vielschichtige und komplexe Interaktion beleuchtet. Die Arbeit stellt sich der Herausforderung, dieses Verhältnis im Kontext islamischer Ökonomien zu analysieren.
Der theoretische Kontext beleuchtet die Entwicklung von Theorien über Religion und Moderne. Hierbei werden die Konzepte der Säkularen Moderne und der Multiplen Modernen nach Eisenstadt und Casanova vorgestellt. Diese Theorien bilden den theoretischen Rahmen für die Untersuchung der Interaktion von islamischer Moral und Wirtschaft.
Der dritte Teil der Arbeit konzentriert sich auf die Analyse islamischer Ökonomien in der Moderne. Er untersucht die Entstehung islamischer Ökonomien im Kontext kapitalistischer Lohnarbeit und analysiert Prozesse in Örselli als Fallbeispiel. Der Einfluss von islamischen Moralvorstellungen auf die Gestaltung ökonomischer Strukturen wird hier deutlich.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Islamische Moral, Moderne, Säkularität, Multiple Modernen, Wirtschaft, Ökonomie, Religion, Islamische Ökonomien, Islamisches Banking, Ethik, Moral, Globalisierung, Postmoderne, Eisenstadt, Casanova.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet das Konzept der „Multiplen Modernen“?
Nach Shmuel Eisenstadt gibt es nicht nur einen (westlichen) Weg in die Moderne, sondern verschiedene kulturelle Programme der Modernisierung.
Wie interagiert islamische Moral mit der Wirtschaft?
Die Arbeit untersucht, wie religiöse Werte ökonomische Strukturen prägen, zum Beispiel im Islamic Banking oder in dörflichen moralischen Ökonomien.
Was ist das Fallbeispiel Örselli?
Es ist eine Studie von Kimberly Hart über eine türkische Region, die zeigt, wie sich eine moralische Ökonomie unter dem Einfluss kapitalistischer Lohnarbeit entwickelt.
Führt Modernisierung zwangsläufig zum Bedeutungsverlust von Religion?
Die Arbeit stellt die Säkularisierungsthese (Max Webers „Entzauberung“) in Frage und zeigt, dass Religion in vielen modernen Ökonomien zentral bleibt.
Welche Rolle spielt Islamic Banking im transnationalen Kontext?
Es dient als Beispiel für eine islamische Subökonomie, die moderne Finanzinstrumente mit religiösen Ethikvorgaben verbindet.
- Quote paper
- Theresa Quiachon (Author), 2017, Islamische Moral und Multiple Modernen. Eine Analyse des Verhältnisses von Religion und Wirtschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374140