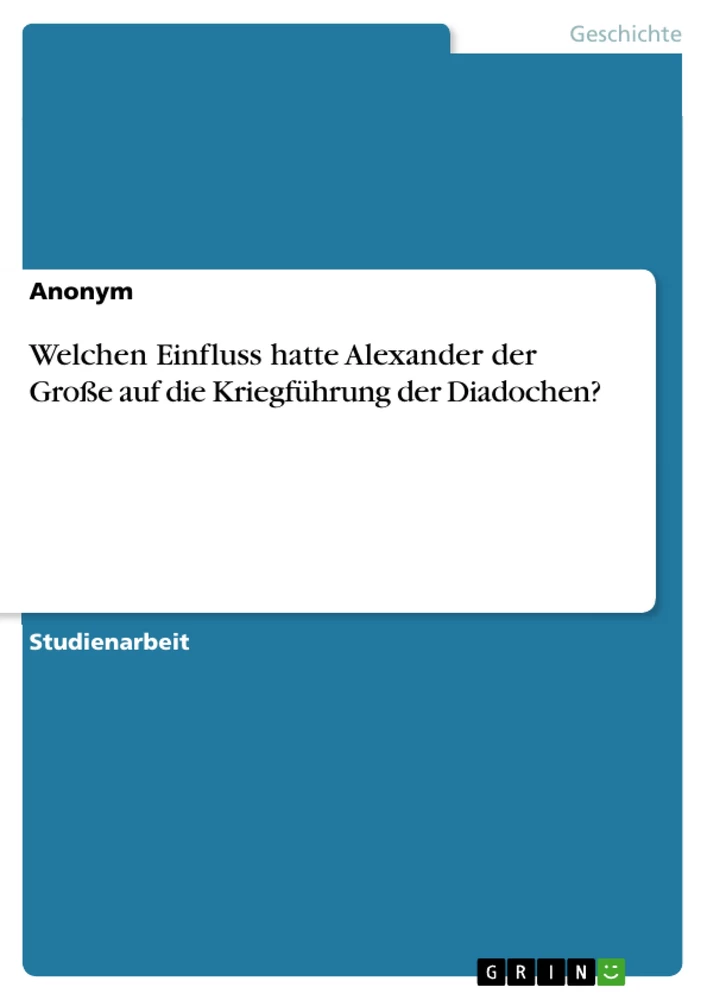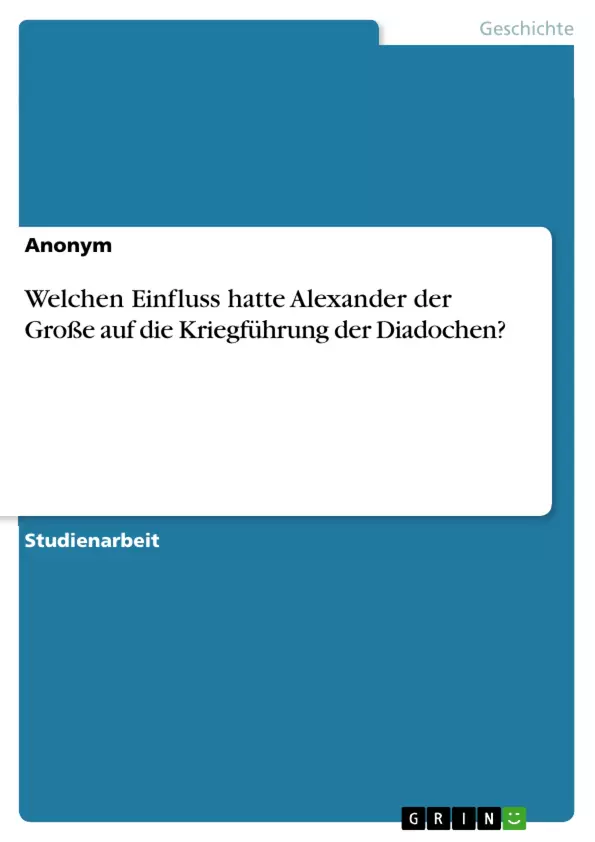Ausgehend von der existierenden Quellenlage, die von sehr unterschiedlicher Qualität ist, und dem aktuellen Forschungsstand, soll es das Ziel dieser Arbeit sein, zu untersuchen, in wieweit die Kriegsstrategie und -führung Alexanders die der nachfolgenden Diadochen bestimmt hat. Wurden sie übernommen oder abgelegt? Was hatte dies als Ursache und zur Folge? Um diese Untersuchung zu ermöglichen, muss zunächst die Kriegführung Alexanders näher betrachtet werden. Dabei spielen die Zusammensetzung und die Strategie des Heeres Alexanders die entscheidende Rolle. Anschließend werden das Heer und die Kriegführung der Diadochen vergleichend aufgeführt. Im Abschlussteil sollen die Eingangsfragen diskutiert und mögliche Ursachen bzw. Folgen aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kriegsführung Alexanders des Großen
- Allgemeines
- Zusammensetzung des Heeres Alexanders des Großen
- Kavallerie
- Infanterie
- Strategie
- Die Kriegsführung der Diadochen
- Historie
- Heereszusammensetzung und Kriegsführung der Diadochen
- Kriegsstrategie der Diadochen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der Kriegsführung Alexanders des Großen auf die der nachfolgenden Diadochen. Es wird analysiert, inwieweit Strategien und Heeresstrukturen Alexanders übernommen oder abgelegt wurden, sowie die Ursachen und Folgen dieser Entwicklungen.
- Zusammensetzung des Heeres Alexanders des Großen
- Kriegsstrategie Alexanders des Großen
- Heereszusammensetzung und Kriegsführung der Diadochen
- Vergleichende Analyse der Kriegsführung
- Ursachen und Folgen der Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Forschungsstand zur makedonischen Armee unter Alexander dem Großen und die Herausforderungen, die sich aus der spärlichen und teilweise verzerrten Quellenlage ergeben. Sie umreißt das Ziel der Arbeit: die Untersuchung des Einflusses Alexanders auf die Kriegsführung der Diadochen, und skizziert die methodische Vorgehensweise, beginnend mit der Analyse der Kriegsführung Alexanders und im Anschluss einen Vergleich mit der der Diadochen.
Kriegsführung Alexanders des Großen: Dieses Kapitel beleuchtet die außergewöhnliche Effektivität der Armee Alexanders. Es wird zwar auf die Größe des persischen Reiches als Gegenspieler eingegangen, der Fokus liegt aber auf der makedonischen Armee. Die außergewöhnliche Organisation, Ausbildung und Ausrüstung der Armee werden hervorgehoben, im Kontrast zu dem vergleichsweise kleinen Reich Makedoniens. Die Kapitel-Teile gehen auf die Reformen Philipps II., den Aufbau und die Zusammensetzung des Heeres ein.
Die Kriegsführung der Diadochen: Dieses Kapitel befasst sich mit der militärischen Situation nach Alexander dem Großen und analysiert die Heeresstrukturen und -zusammensetzungen sowie die Strategien der Diadochen. Es stellt einen Vergleich zu der Armee Alexanders dar und untersucht, inwiefern die Strategien und die Organisation des Heeres Alexanders Einfluss auf die Diadochen hatten und ob und wie sie diese übernommen oder abgelegt haben. Die beschränkte Quellenlage für diesen Zeitraum wird ebenfalls thematisiert.
Schlüsselwörter
Alexander der Große, Diadochen, Kriegsführung, Heereszusammensetzung, Strategie, Makedonische Phalanx, Kavallerie, Infanterie, Hellenismus, militärische Reformen, Quellenkritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Die Kriegsführung Alexanders des Großen und der Diadochen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der Kriegsführung Alexanders des Großen auf die der nachfolgenden Diadochen. Im Mittelpunkt stehen die Strategien und Heeresstrukturen Alexanders und deren Übernahme oder Ablehnung durch die Diadochen. Die Arbeit analysiert die Ursachen und Folgen dieser Entwicklungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Zusammensetzung des Heeres Alexanders des Großen, seine Kriegsstrategie, die Heereszusammensetzung und Kriegsführung der Diadochen, einen vergleichenden Analyse der Kriegsführung beider Epochen sowie die Ursachen und Folgen der Entwicklungen in der Kriegsführung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Kriegsführung Alexanders des Großen, ein Kapitel zur Kriegsführung der Diadochen und ein Fazit. Jedes Kapitel beinhaltet detaillierte Analysen der jeweiligen Themen.
Wie ist die Einleitung aufgebaut?
Die Einleitung beschreibt den aktuellen Forschungsstand zur makedonischen Armee unter Alexander dem Großen und die Herausforderungen aufgrund der spärlichen und teilweise verzerrten Quellenlage. Sie definiert das Ziel der Arbeit – die Untersuchung des Einflusses Alexanders auf die Kriegsführung der Diadochen – und skizziert die methodische Vorgehensweise (Analyse der Kriegsführung Alexanders und Vergleich mit der der Diadochen).
Was wird im Kapitel über die Kriegsführung Alexanders des Großen behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet die außergewöhnliche Effektivität der Armee Alexanders. Der Fokus liegt auf der makedonischen Armee, ihrer Organisation, Ausbildung und Ausrüstung im Kontext des vergleichsweise kleinen Reiches Makedoniens und im Gegensatz zum riesigen Persischen Reich. Es werden die Reformen Philipps II., der Aufbau und die Zusammensetzung des Heeres behandelt.
Worüber handelt das Kapitel über die Kriegsführung der Diadochen?
Dieses Kapitel befasst sich mit der militärischen Situation nach Alexander dem Großen. Es analysiert die Heeresstrukturen und -zusammensetzungen sowie die Strategien der Diadochen im Vergleich zur Armee Alexanders. Es untersucht den Einfluss Alexanders auf die Diadochen, die Übernahme oder Ablehnung seiner Strategien und Organisation und thematisiert die beschränkte Quellenlage für diesen Zeitraum.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Alexander der Große, Diadochen, Kriegsführung, Heereszusammensetzung, Strategie, Makedonische Phalanx, Kavallerie, Infanterie, Hellenismus, militärische Reformen, Quellenkritik.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit erwähnt explizit die Herausforderungen aufgrund der spärlichen und teilweise verzerrten Quellenlage sowohl für die Zeit Alexanders des Großen als auch für die der Diadochen. Konkrete Quellenangaben sind nicht im gegebenen HTML-Auszug enthalten.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich für die Geschichte der antiken Kriegsführung und speziell für die makedonische Armee unter Alexander dem Großen und die der Diadochen interessiert. Sie eignet sich für Studenten und Wissenschaftler, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2017, Welchen Einfluss hatte Alexander der Große auf die Kriegführung der Diadochen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374198