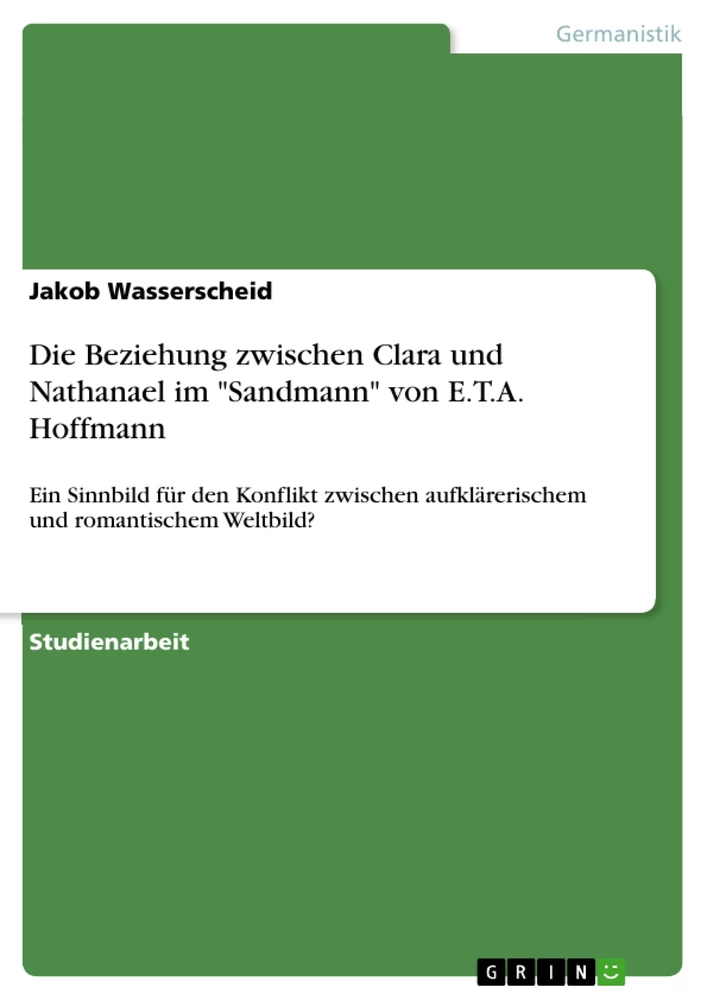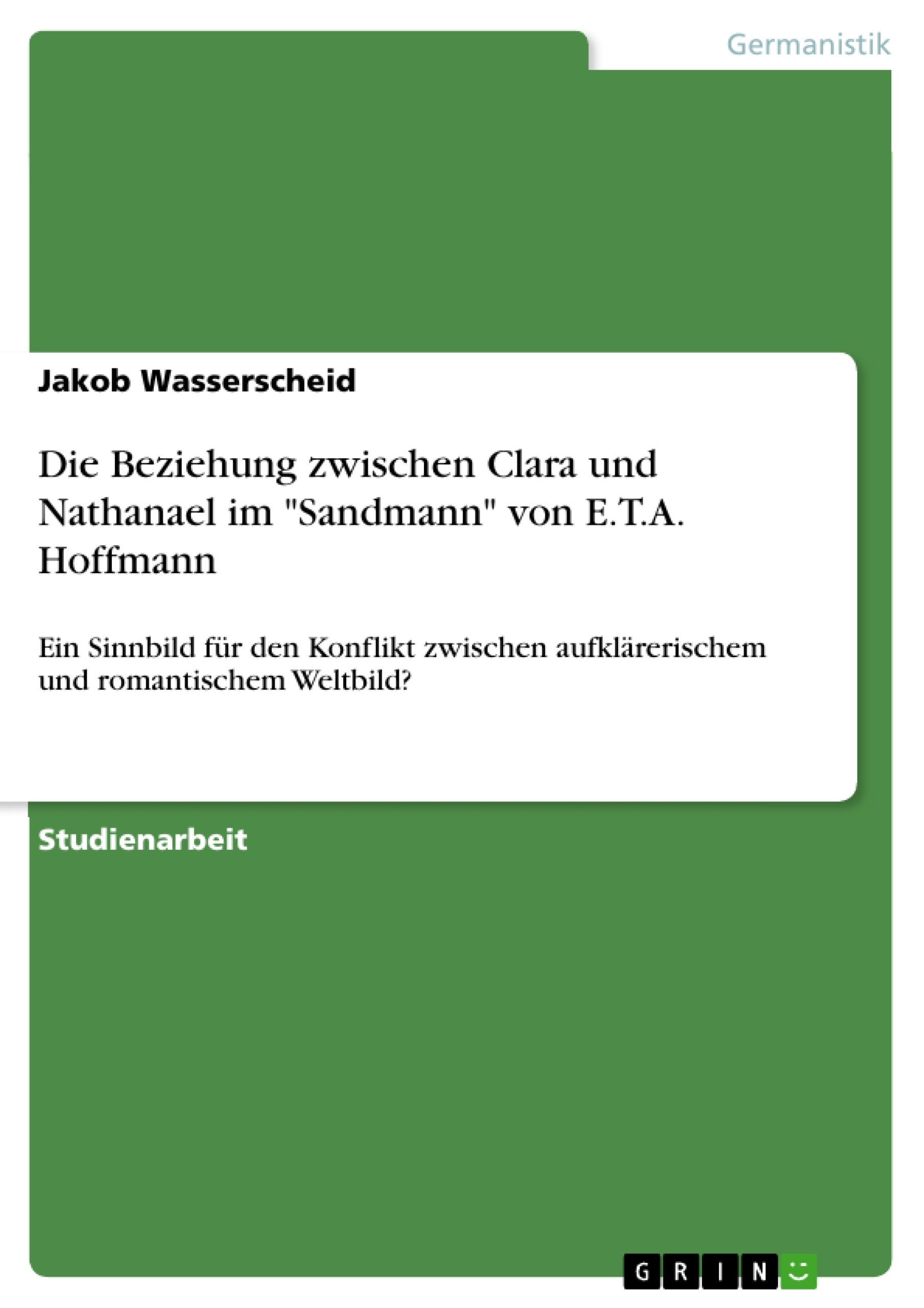Um die Fragestellung aus dem Untertitel hinreichend beantworten zu können, ist zuerst eine eindeutige Definition der verwendeten Begrifflichkeiten von Nöten. So soll in einem ersten Kapitel erläutert werden, was unter einem aufklärerischen Weltbild bzw. einem romantischen zu verstehen ist. Nur wenn in diesen Punkten Klarheit herrscht, können anschließend den Protagonisten Nähe zu der einen oder anderen Weltsicht nachgewiesen werden.
Anschließend soll ein Kapitel folgen, auf dem der Schwerpunkt der Hausarbeit lastet. Hierin soll eine Personenanalyse zum einen für Clara, zum anderen für Nathanael unter besonderer Berücksichtigung epochentypischer Verhaltens- und Denkweisen angestellt werden. Wichtig erscheint es mir hierbei nahe am Text zu arbeiten und Aussagen über Charakter und Eigenschaften der Protagonisten, durch Textstellen zu belegen.
Darauffolgend soll in geringem Umfang der Versuch angestellt werden, anhand Hoffmanns Darstellung der Liebesbeziehung, sowie den von ihm gesetzten Figurenentwicklungen Schlussfolgerungen über die verschiedenen Weltbilder der Aufklärung bzw. Romantik zu ziehen.
Letztendlich sollen die gesammelten Erkenntnisse im Hinblick auf die Fragestellung in einem Fazit zusammengefasst werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Definition der gegenübergestellten Weltbilder
- Aufklärung
- Romantik
- Personenanalyse unter besonderer Berücksichtigung epochentypischer Verhaltens- und Denkweisen
- Clara
- Nathanael
- Schlussfolgerungen aus den Figurenentwicklungen über die Denkansätze der Aufklärung bzw. der Romantik
- Definition der gegenübergestellten Weltbilder
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Beziehung zwischen Clara und Nathanael in E.T.A. Hoffmanns „Der Sandmann“ und analysiert, ob diese als Sinnbild für den Konflikt zwischen aufklärerischem und romantischem Weltbild verstanden werden kann.
- Definition und Gegenüberstellung der aufklärerischen und romantischen Weltbilder
- Personenanalyse von Clara und Nathanael im Hinblick auf epochentypische Verhaltens- und Denkweisen
- Analyse der Figurenentwicklungen im Kontext der beiden Weltbilder
- Bewertung der Beziehung zwischen Clara und Nathanael als Sinnbild für den Konflikt zwischen Aufklärung und Romantik
- Zusammenfassende Interpretation der Ergebnisse im Fazit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die Forschungsfrage sowie die Methodik dar. Das erste Kapitel definiert die beiden gegenübergestellten Weltbilder, Aufklärung und Romantik, und zeigt ihre zentralen Merkmale auf. Im zweiten Kapitel erfolgt eine Personenanalyse von Clara und Nathanael, wobei ihr Verhalten und ihre Denkweisen im Kontext der jeweiligen Epoche betrachtet werden. Das dritte Kapitel zieht Schlussfolgerungen aus den Figurenentwicklungen und untersucht, ob diese die Denkansätze der Aufklärung und Romantik widerspiegeln.
Schlüsselwörter
Aufklärung, Romantik, „Der Sandmann“, E.T.A. Hoffmann, Clara, Nathanael, Weltbild, Personenanalyse, Figurenentwicklung, Konflikt, Sinnbild.
- Citar trabajo
- Jakob Wasserscheid (Autor), 2017, Die Beziehung zwischen Clara und Nathanael im "Sandmann" von E.T.A. Hoffmann, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374262