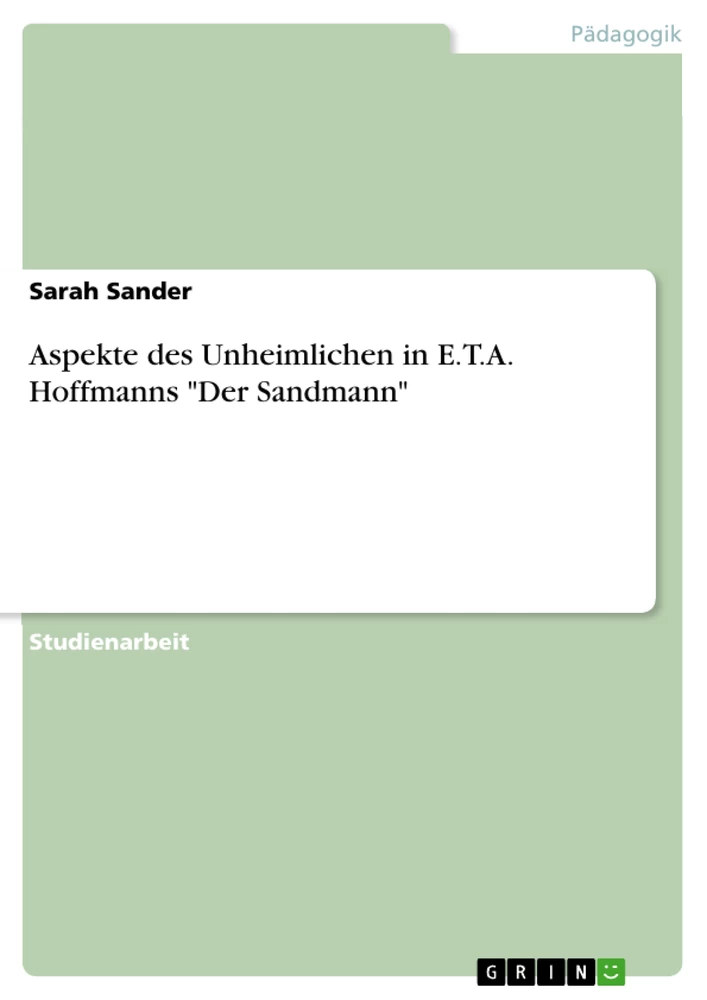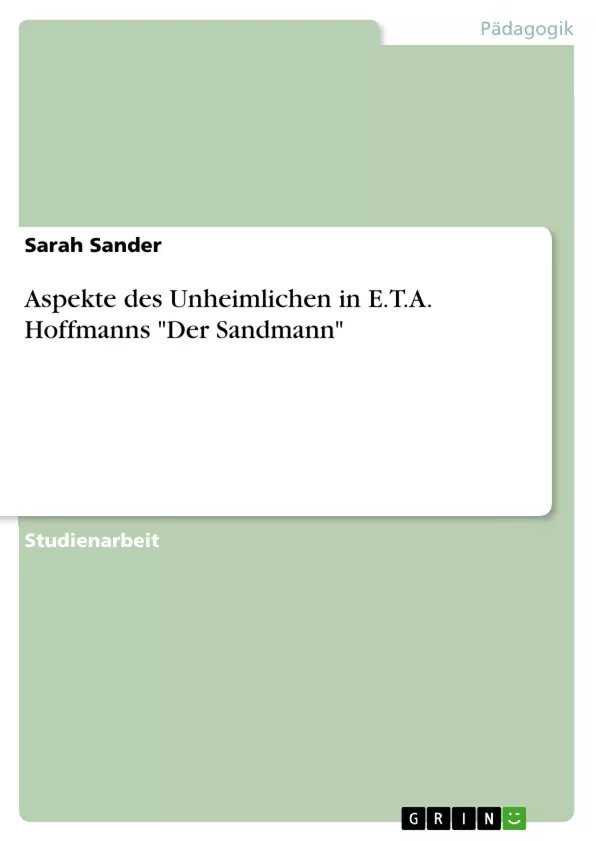Das Unheimliche löst im Menschen eine gewisse Neugier und Faszination aus. So lässt sich bei Kindern beobachten, „dass sie oft eine gewisse Vorliebe für Gespenstergeschichten zeigen: der Horror ist ein Kitzel.“ Dies wird durch das Interesse vieler Menschen an Schauermärchen, Psychothrillern und Horrorfilmen bestätigt. Sigmund Freud beschäftigt sich im Jahr 1919 mit dem Phänomen des Unheimlichen, welches heutzutage als „ein unbestimmtes Gefühl der Angst, des Grauens hervorrufend“ bezeichnet wird. Er beschreibt in seinem Aufsatz das Unheimliche als etwas Fremdes: „Das deutsche Wort ‚unheimlich‘ ist offenbar der Gegensatz zu heimlich, heimisch, vertraut und der Schluß liegt nahe, es sei etwas eben darum schreckhaft, weil es nicht bekannt und vertraut ist.“ Die Aussage des Psychiaters Ernst Jentsch unterstützt diese These, indem er mit „der Unheimlichkeit eines Dinges oder Vorkommnisses ein Mangel an Orientirung [sic!] verknüpft.“ Beide Wissenschaftler beziehen sich in ihren Veröffentlichungen auf literarische Werke der Romantik in denen das Unheimliche als Motiv kursiert. Das Unheimliche ist also ein literarisches Motiv, welches insbesondere in den Diskursen der Romantik konstitutiv ist und in vielen Werken verhandelt wird. Im Folgenden wird dieses Motiv beispielhaft anhand E. T. A. Hoffmanns „Der Sandmann“ untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Sandmann als Schreckensfigur
- Das Unheimliche an Olimpia
- Unheimlichkeitserzeugung mit Hilfe des Augenmotivs
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Aspekte des Unheimlichen in E. T. A. Hoffmanns Erzählung „Der Sandmann“. Sie analysiert, wie Hoffmann die Unheimlichkeit in der Geschichte erzeugt und welche Rolle die verschiedenen Elemente der Erzählung, wie z. B. der Sandmann, Olimpia und das Augenmotiv, dabei spielen. Darüber hinaus wird die Frage gestellt, inwieweit „Der Sandmann“ als Gruselgeschichte bezeichnet werden kann.
- Die Entstehung und Entwicklung des Unheimlichen in der Literatur
- Die Rolle des Sandmanns als Schreckensfigur
- Die Unheimlichkeit des Automaten Olimpia
- Die Bedeutung des Augenmotivs in der Geschichte
- Die Frage nach der Einordnung von „Der Sandmann“ als Gruselgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Unheimlichen ein und stellt die Relevanz des Themas in der Literatur und im Alltag dar. Sie erläutert die Definition des Unheimlichen nach Freud und Jentsch und stellt den Zusammenhang zwischen dem Unheimlichen und der Romantik her. Abschließend wird der Fokus auf E. T. A. Hoffmann und seine Erzählung „Der Sandmann“ gelegt.
Das zweite Kapitel analysiert die Figur des Sandmanns als Schreckensfigur. Es wird die traditionelle Vorstellung des Sandmanns als Gutenachtgeschichte gegenübergestellt mit der von Nathanael erlebten Version des Sandmanns als bösem Mann, der Kindern die Augen ausreißt. Die Darstellung des Sandmanns im Briefwechsel zwischen Nathanael, Lothar und Clara wird untersucht, um die Wirkung des Sandmanns auf Nathanael zu verdeutlichen.
Im dritten Kapitel wird die Unheimlichkeit der Figur Olimpia untersucht. Es wird analysiert, wie Olimpia als Automat die Unheimlichkeit in der Geschichte verstärkt und wie Nathanaels Liebe zu Olimpia zu seinem Wahnsinn führt.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Unheimlichkeitserzeugung durch das Augenmotiv. Es wird gezeigt, wie das Augenmotiv in der Geschichte immer wieder auftaucht und welche Bedeutung es für die Entwicklung der Geschichte hat. Das Augenmotiv wird im Zusammenhang mit dem Sandmann, Olimpia und Nathanaels Wahnsinn analysiert.
Das fünfte Kapitel, das Fazit, fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und beantwortet die Frage, inwieweit „Der Sandmann“ als Gruselgeschichte bezeichnet werden kann. Es wird die Bedeutung des Unheimlichen in der Geschichte hervorgehoben und die Rolle der verschiedenen Elemente der Erzählung für die Wirkung des Unheimlichen erläutert.
Schlüsselwörter
Unheimliches, E. T. A. Hoffmann, „Der Sandmann“, Gruselgeschichte, Sandmann, Olimpia, Augenmotiv, Automat, Wahnsinn, Romantik, Freud, Jentsch, Literaturanalyse
- Arbeit zitieren
- Sarah Sander (Autor:in), 2014, Aspekte des Unheimlichen in E.T.A. Hoffmanns "Der Sandmann", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374272