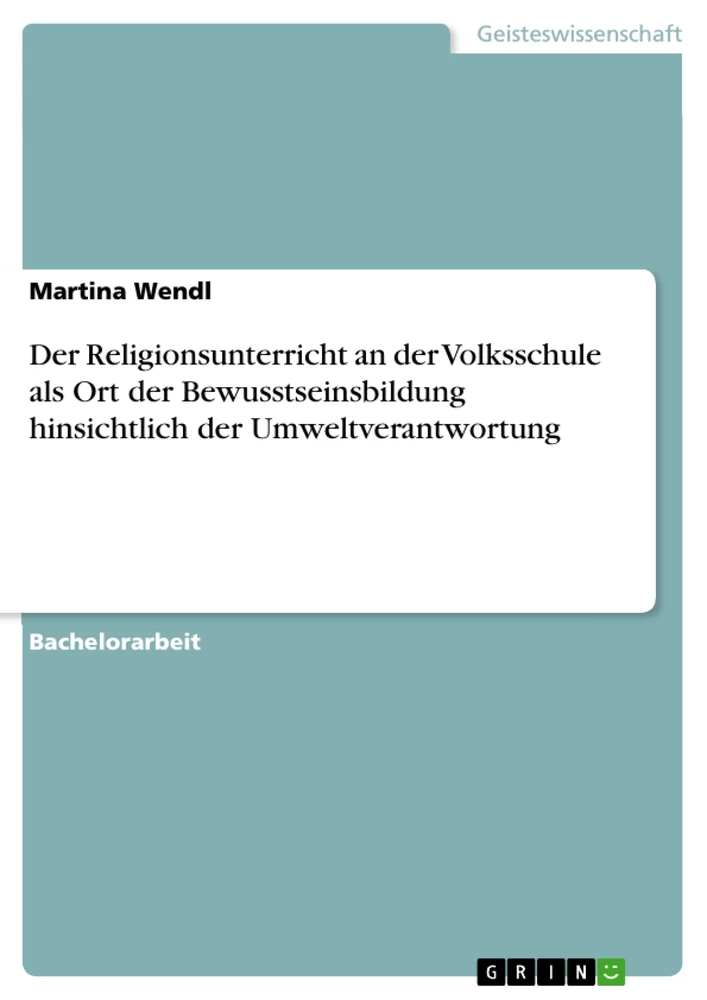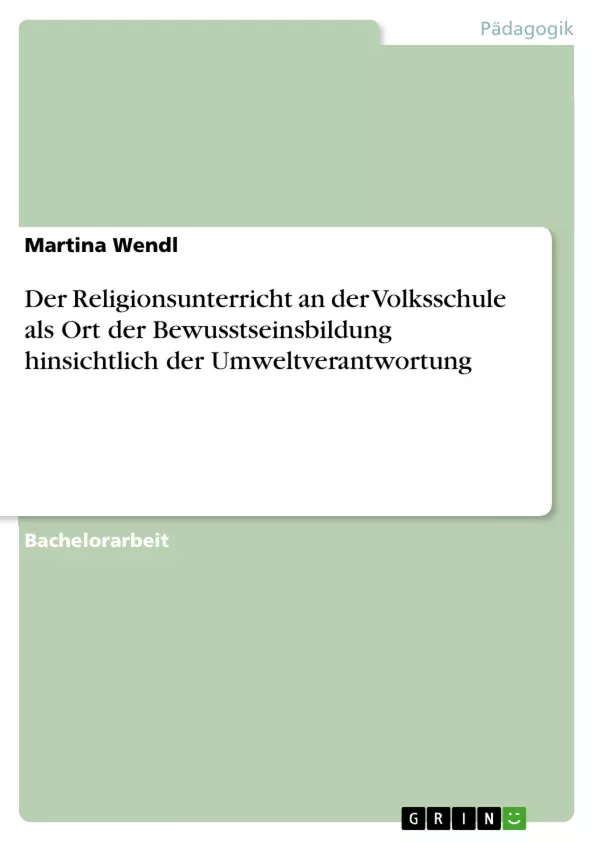Kaum ein anderes theologisches Thema erfreut sich derart großer allgemeiner Aufmerksamkeit wie jenes der "Schöpfung". In Anbetracht der globalen ökologischen Krise, der menschlichen Ausbeutung natürlicher Lebensgrundlagen und Ressourchen zu Lasten nachfolgender Generationen, findet diese biblische Thematik immer öfter Eingang in gegenwärtige rechtliche und politische Diskussionen. Was es nun bedeutet, von der Welt der Schöfpfung Gottes zu reden, ist Gegenstand vorliegender Bachelorarbeit. Neben der Berufung auf die biblische Rede von der Schöfpung werden ethische Grundlagen für ein umweltverantwortliches Handeln erörtert. Es werden die unterschiedlichen konfessionellen Zugänge zur Schöpfungsthematik dargestellt als auch das ökumenische Verständnis von Schöpfung beleuchtet. Hierbei ist ein Konsens über den Umgang mit den ökologischen Herausforderungen unserer Zeit erkennbar.
Das Anliegen der Bewahrung der Schöpfung innerhalb des Konziliaren Prozesses findet in den Lehrplänen für den evangelischen, orthodoxen und katholischen Religionsunterricht ihren Widerhall und formuliert damit eine ständige Aufgabe des christlich-religiösen Lernens. Dem Rechnung tragend wird aufgezeigt, wie der Religionsunterricht an einer vierten Klasse Volksschule zum Ort der Bewusstseinsbildung hinschtlich der Umweltverantwortung wird. Basierend auf einer schöpfungsorientierten Didaktik wird der religionspädagogische Prozess vom Schöpfungsglauben hin zum Umwelthandeln dargestellt, bei dem ganzheitlich kognitive, emotionale und handlungsorientierte Elemente miteinander verknüpft werden. Zuvor wird auf die psychische und pädagogische Bewältigung der Umweltängste der jungen Menschen eingegangen und auf deren Umweltbewusstsein. Ebenso werden religionspädagogische und -psychologische Vorüberlegungen zu den Glaubensvorstellungen der Kinder und deren Schöpfungsverständnis berücksichtigt. Ein Unterrichtsentwurf wird anhand der erarbeiteten Grundlagen erstellt, durchgeführt und reflektiert.
Inhaltsverzeichnis
- Kurzzusammenfassung
- Summary
- Vorwort
- 1 Einleitung
- 2 Die Umweltkrise
- 2.1 Die Gefährdung der Natur als Grund heutiger Schöpfungstheologie
- 2.2 Die Umweltkrise als Überlebenskrise
- 2.3 Die Diskrepanz zwischen Umweltbewusstsein und Umweltverhalten
- 2.4 Die Berufung auf die biblische Rede von der Schöpfung als Reaktion auf die Umweltkrise
- 2.5 Die Reaktion auf die Umweltkrise in ausgewählten ökumenischen Stellungnahmen
- 3 Verantwortliches Handeln: Theologische und ethische Grundlagen
- 3.1 Ist der Herrschaftsauftrag (dominum terrae) eine Legitimation für die Zerstörung der Natur?
- 3.2 Die Frage der Mitschuld des Christentums
- 3.3 Vier Ansätze umweltethischer Begründungsmodelle
- 3.3.1 Der anthropozentrische Ansatz
- 3.3.2 Der pathozentrische Ansatz
- 3.3.3 Der biozentrische Ansatz
- 3.3.4 Der physiozentrische (auch ökozentrische oder holistische) Ansatz
- 3.3.5 Die Vorteile und Nachteile der vorgenannten Ansätze
- 3.3.6 Die Mischformen
- 3.4 Ethische Orientierungen umweltgerechten Handelns
- 3.5 Die Verantwortung als Konzept der ökologischen Ethik
- 3.5.1 Der Begriff Verantwortung
- 3.5.2 Die grundlegenden Kriterien ethischer Entscheidungsfindung und Verantwortung
- 3.5.3 Die Verantwortungsethik als Abgrenzung zwischen konkurrierenden Gütern
- 4 Die nachhaltige Entwicklung als ethisch-politischer Leitbegriff
- 4.1 Die nachhaltige Entwicklung als Notwendigkeit für einen globalen Schutz der Umwelt
- 4.2 Die Retinität als ethisches Leitprinzip nachhaltiger Entwicklung
- 4.3 Die Kriterien einer christlichen Ethik der Nachhaltigkeit
- 4.4 Schlussfolgerungen
- 5 Konfessionelle Zugänge in der evangelischen und orthodoxen Theologie zur Schöpfungsthematik
- 5.1 Die Schöpfung in der evangelischen Theologie
- 5.1.1 Die Schöpfung bei Martin Luther
- 5.1.2 Die Schöpfung als Schauplatz der Herrlichkeit Gottes - Johannes Calvin
- 5.1.3 Die neulutherische Lehre von den Schöpfungsordnungen
- 5.2 Die Schöpfung in der orthodoxen Theologie
- 5.1 Die Schöpfung in der evangelischen Theologie
- 6 Die ökumenische Schöpfungstheologie
- 6.1 Der Sinn ökumenischer Schöpfungstheologie
- 6.2 Die sieben Dimensionen eines ökumenischen Verständnisses von Schöpfung
- 6.2.1 Die Schöpfung als Beziehungsgeschehen
- 6.2.2 Die Schönheit der Natur – Schöpfung und Bejahung des Natürlichen
- 6.2.3 Das Mitleiden mit der Natur - Schöpfung und Kreuz
- 6.2.4 Die Zukunft der Natur - Schöpfung aus dem Nichts
- 6.2.5 Die Würde der Natur - Schöpfung und Selbstbegrenzung
- 6.2.6 Ehrfurcht vor dem Leben – Schöpfung und menschliche Tugend
- 6.2.7 Engagement für die Natur in der Zivilgesellschaft - Schöpfung und politische Kultur
- 7 Zusammenfassung
- 8 Der Beitrag des Religionsunterrichts an der Volksschule zur Bewusstseinsbildung hinsichtlich der Umweltverantwortung
- 8.1 Die Bewahrung der Schöpfung als ökumenische Dimension des Religionsunterrichts
- 8.1.1 Die ökumenische Dimension in Dokumenten
- 8.1.2 Die ökumenische Dimension in den Lehrplänen für Volksschulen
- 8.2 Die Grundlagen für einen Unterrichtsentwurf zum Thema „Die Schöpfung bewahren“
- 8.2.1 Vorüberlegungen in Bezug auf Volksschulkinder im Kontext der Umweltkrise
- 8.2.2 Religionspädagogische und religionspsychologische Vorbemerkungen
- 8.2.3 Die Aspekte einer schöpfungsorientierten Didaktik
- 8.2.4 Der Unterrichtsentwurf
- 8.2.5 Das Resumee
- 8.1 Die Bewahrung der Schöpfung als ökumenische Dimension des Religionsunterrichts
- 9 Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Bewusstseinsbildung hinsichtlich der Umweltverantwortung im Religionsunterricht an der Volksschule. Ziel ist es, die Bedeutung der Schöpfung für den christlichen Glauben und die ethische Verpflichtung zum Schutz der Umwelt aufzuzeigen. Dabei werden sowohl die theologischen und ethischen Grundlagen als auch die konkreten Möglichkeiten des Religionsunterrichts in der Volksschule beleuchtet.
- Die Umweltkrise und ihre Auswirkungen auf die Schöpfung
- Theologische und ethische Grundlagen der Umweltverantwortung
- Die nachhaltige Entwicklung als ethisch-politischer Leitbegriff
- Die Rolle des Religionsunterrichts in der Bewusstseinsbildung
- Konkrete Unterrichtsbeispiele und -ideen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz der Thematik und die Zielsetzung der Arbeit darlegt. Anschließend wird die Umweltkrise in ihren verschiedenen Facetten beleuchtet, wobei die Gefährdung der Natur als Grund heutiger Schöpfungstheologie sowie die Diskrepanz zwischen Umweltbewusstsein und Umweltverhalten im Mittelpunkt stehen. Im dritten Kapitel werden die theologischen und ethischen Grundlagen des verantwortungsvollen Handelns im Kontext der Umweltkrise untersucht. Hierbei wird die Frage der Mitschuld des Christentums ebenso thematisiert wie verschiedene Ansätze umweltethischer Begründungsmodelle. Das vierte Kapitel widmet sich der nachhaltigen Entwicklung als ethisch-politischem Leitbegriff und untersucht die Kriterien einer christlichen Ethik der Nachhaltigkeit. Kapitel fünf und sechs befassen sich mit den konfessionellen Zugängen in der evangelischen und orthodoxen Theologie zur Schöpfungsthematik sowie mit der ökumenischen Schöpfungstheologie. Im siebten Kapitel wird die Rolle des Religionsunterrichts an der Volksschule im Kontext der Bewusstseinsbildung hinsichtlich der Umweltverantwortung beleuchtet, wobei die ökumenische Dimension des Religionsunterrichts und die Grundlagen für einen Unterrichtsentwurf zum Thema „Die Schöpfung bewahren“ im Fokus stehen. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung und einem Literaturverzeichnis.
Schlüsselwörter
Schöpfung, Umweltverantwortung, Religionsunterricht, Volksschule, Bewusstseinsbildung, Ökumenische Theologie, Nachhaltige Entwicklung, Ethische Orientierungen, Unterrichtsentwurf, Didaktik.
Häufig gestellte Fragen
Wie fördert Religionsunterricht das Umweltbewusstsein?
Die Arbeit zeigt auf, wie der Schöpfungsglaube als Basis für ethisches Handeln dient und Schüler dazu anregt, Verantwortung für die Bewahrung der Natur zu übernehmen.
Was ist der "Herrschaftsauftrag" (dominium terrae)?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob der biblische Auftrag, sich die Erde untertan zu machen, eine Rechtfertigung für die Zerstörung der Natur war oder als Auftrag zur fürsorglichen Verwaltung zu verstehen ist.
Welche umweltethischen Ansätze werden behandelt?
Es werden anthropozentrische, pathozentrische, biozentrische und physiozentrische (ökozentrische) Modelle sowie deren Vor- und Nachteile erläutert.
Was bedeutet ökumenische Schöpfungstheologie?
Sie beschreibt den konfessionsübergreifenden Konsens (evangelisch, katholisch, orthodox) über den Schutz der Umwelt als gemeinsame christliche Aufgabe.
Wie sieht ein Unterrichtsentwurf zum Thema Schöpfung aus?
Die Bachelorarbeit enthält einen konkreten Entwurf für eine 4. Klasse Volksschule, der kognitive, emotionale und handlungsorientierte Elemente verknüpft.
- Arbeit zitieren
- Martina Wendl (Autor:in), 2014, Der Religionsunterricht an der Volksschule als Ort der Bewusstseinsbildung hinsichtlich der Umweltverantwortung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374328