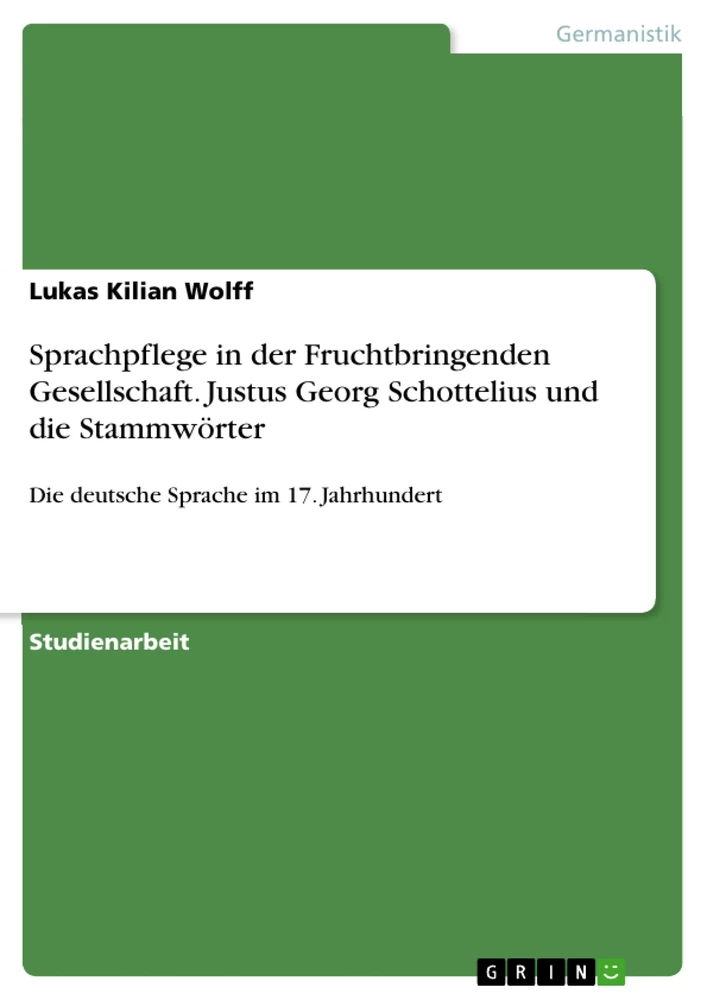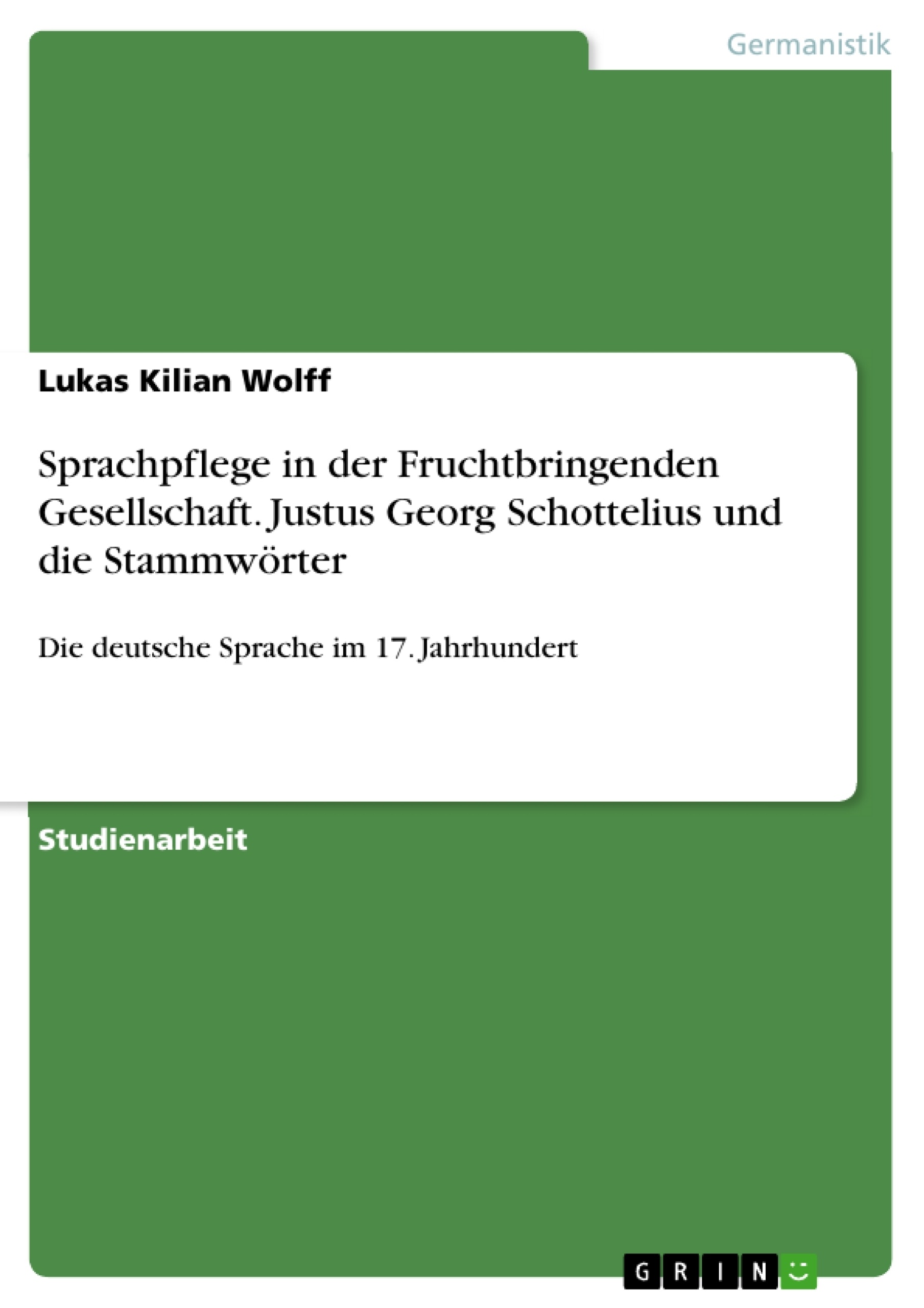Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Sprachpflege in der Fruchtbringenden Gesellschaft und soll einen kurzen Überblick über sie geben. Dazu werde ich auf die Sprachsituation des Deutschen im 17. Jahrhundert, den Begriff der „Sprachpflege“ und seine Geschichte eingehen, woraus die Notwendigkeit der damals als „Spracharbeit“ betitelten Bemühungen um die Sprache sowie die angestrebten Zielsetzungen der Fruchtbringenden Gesellschaft deutlich werden sollen. Anschließend wird explizit auf die Sprachpflege in der Gesellschaft eingegangen, wobei der erste Teil allgemeine Verdienste und Leistungen der Gesellschaft um die Sprachpflege thematisiert. Wie die Arbeit eines einzelnen Mitgliedes der Gesellschaft aussah, soll abschließend im zweiten Teil am Beispiel von Justus Georg Schottelius Beitrag zu den Stammwörtern dargestellt werden.
Obgleich die Fruchtbringende Gesellschaft besonders nach der gut erschlossenen Köthener Periode als eine adlige Gesellschaft mit politischen und konfessionellen Motiven betrachtet wurde, dessen literarische Leistungen als Gemeinschaftserzeugnis von sehr geringem Ausmaß waren, haben ihre sprachpflegerischen Tätigkeiten bemerkenswerte Auswirkungen auf die Entwicklung der deutschen Sprache genommen und einen bleibenden Verdienst um die Kulturentwicklung geleistet. Noch heute ist das Ausmaß ihrer Arbeit in der deutschen Standardsprache bemerkbar, welche es ohne sie wahrscheinlich nicht in dieser Form gäbe. Ein Beispiel dafür wäre das von ihnen eingeführte Interpunktionssystem oder Wörter wie „Jahrhundert“, welche ihre lateinischen Vorgänger, in diesem Falle „Säkulum“, nahezu verdrängt haben.
Welche Konsequenzen die Sprachpflege der Fruchtbringenden Gesellschaft noch hatte, was sie dazu veranlasste und wie die Arbeit konkret ausgesehen hat, soll in dieser Hausarbeit dargelegt werden, wobei zunächst der historische Kontext erläutert wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der historische Kontext
- Die deutsche Sprache im 17. Jahrhundert
- Der Begriff und die Geschichte der Sprachpflege
- Die Sprachpflege in der Fruchtbringenden Gesellschaft
- Verdienste und Leistungen der Gesellschaft
- Exemplarisch: Justus Georg Schottelius und die Stammwörter
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Rolle der Fruchtbringenden Gesellschaft bei der Sprachpflege im 17. Jahrhundert und bietet einen kurzen Überblick über deren Bemühungen. Sie befasst sich mit der Sprachsituation des Deutschen im 17. Jahrhundert, dem Begriff der „Sprachpflege“ und seiner Geschichte sowie den Zielen der Gesellschaft. Die Arbeit betrachtet die Verdienste und Leistungen der Gesellschaft für die Sprachpflege und zeigt am Beispiel von Justus Georg Schottelius, wie ein einzelnes Mitglied der Gesellschaft zur Sprachpflege beitrug.
- Die Sprachsituation des Deutschen im 17. Jahrhundert
- Der Begriff und die Geschichte der Sprachpflege
- Die Verdienste und Leistungen der Fruchtbringenden Gesellschaft
- Die Sprachpflege in der Fruchtbringenden Gesellschaft am Beispiel von Justus Georg Schottelius
- Der Einfluss der Fruchtbringenden Gesellschaft auf die Entwicklung der deutschen Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Thematik der Hausarbeit vor und bietet einen kurzen Überblick über deren Inhalt. Sie erklärt die Bedeutung der Sprachpflege im 17. Jahrhundert und erläutert die Ziele der Fruchtbringenden Gesellschaft.
Der historische Kontext
Dieses Kapitel beleuchtet die Sprachsituation des Deutschen im 17. Jahrhundert und beschreibt den historischen Kontext der Sprachpflege. Es beleuchtet die kulturelle und politische Situation des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und zeigt die Herausforderungen auf, denen sich die deutsche Sprache zu dieser Zeit gegenübersah.
Die deutsche Sprache im 17. Jahrhundert
Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Sprachsituation des Deutschen im 17. Jahrhundert. Es wird die Bedeutung der Dialekte, der Gelehrtensprache Latein, der Adelssprache Französisch und die fehlende Standardisierung des Deutschen erläutert.
Der Begriff und die Geschichte der Sprachpflege
Das Kapitel befasst sich mit dem Begriff der Sprachpflege und seiner historischen Entwicklung. Es vergleicht das heutige Verständnis von Sprachpflege mit dem Verständnis des 17. Jahrhunderts und beleuchtet die Entstehung und Entwicklung der Sprachpflege in Deutschland.
Die Sprachpflege in der Fruchtbringenden Gesellschaft
Dieses Kapitel analysiert die Aktivitäten der Fruchtbringenden Gesellschaft im Bereich der Sprachpflege. Es erläutert die Verdienste und Leistungen der Gesellschaft und zeigt, wie sie zum Ausbau und zur Standardisierung der deutschen Sprache beigetragen hat.
Verdienste und Leistungen der Gesellschaft
Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Verdienste und Leistungen der Fruchtbringenden Gesellschaft. Es wird gezeigt, wie die Gesellschaft zur Förderung der deutschen Sprache und Literatur beigetragen hat und wie sie Einfluss auf die Entwicklung der deutschen Standardsprache nahm.
Exemplarisch: Justus Georg Schottelius und die Stammwörter
Dieser Teil der Arbeit konzentriert sich auf die Arbeit eines einzelnen Mitglieds der Gesellschaft, Justus Georg Schottelius, und seinen Beitrag zur Entwicklung der Stammwörter.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Sprachpflege, Fruchtbringende Gesellschaft, Deutsches im 17. Jahrhundert, Sprachsituation, Standardisierung, Hochsprache, Stammwörter, Justus Georg Schottelius, Sprachreinigung, Sprachgeschichte, Kulturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Aufgabe der Fruchtbringenden Gesellschaft?
Die Fruchtbringende Gesellschaft widmete sich im 17. Jahrhundert der „Spracharbeit“ bzw. Sprachpflege, um die deutsche Sprache auszubauen, zu standardisieren und von Fremdeinflüssen zu reinigen.
Wie war die Sprachsituation im Deutschland des 17. Jahrhunderts?
Die Sprache war geprägt von Dialekten, Latein als Gelehrtensprache und Französisch als Adelssprache. Es fehlte eine einheitliche deutsche Standardsprache.
Welchen Einfluss hatte Justus Georg Schottelius auf die deutsche Sprache?
Schottelius war ein bedeutendes Mitglied der Gesellschaft und leistete wesentliche Beiträge zur Lehre von den Stammwörtern, was zur Systematisierung der deutschen Grammatik beitrug.
Welche heutigen Begriffe gehen auf die Sprachpflege dieser Zeit zurück?
Ein bekanntes Beispiel ist das Wort „Jahrhundert“, das den lateinischen Begriff „Säkulum“ verdrängte. Auch die Einführung eines systematischen Interpunktionssystems gehört zu den Verdiensten.
War die Fruchtbringende Gesellschaft rein literarisch orientiert?
Nein, sie war eine adlige Gesellschaft, die auch politische und konfessionelle Motive verfolgte, wobei ihr bleibendes Erbe vor allem in der Kulturentwicklung und Sprachnormierung liegt.
- Quote paper
- Lukas Kilian Wolff (Author), 2017, Sprachpflege in der Fruchtbringenden Gesellschaft. Justus Georg Schottelius und die Stammwörter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374420