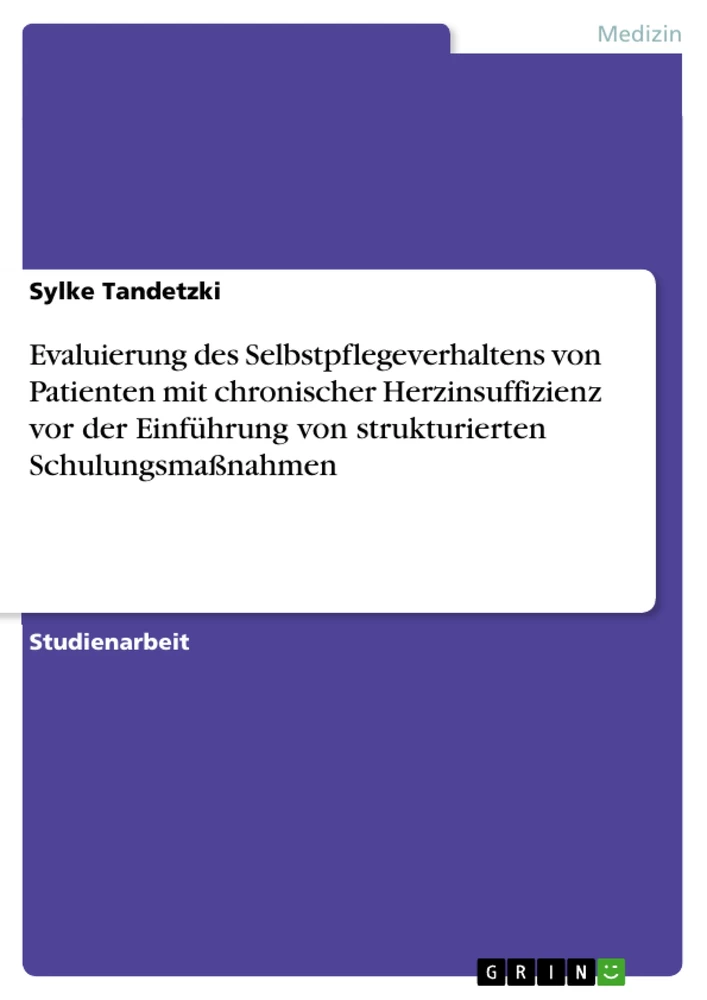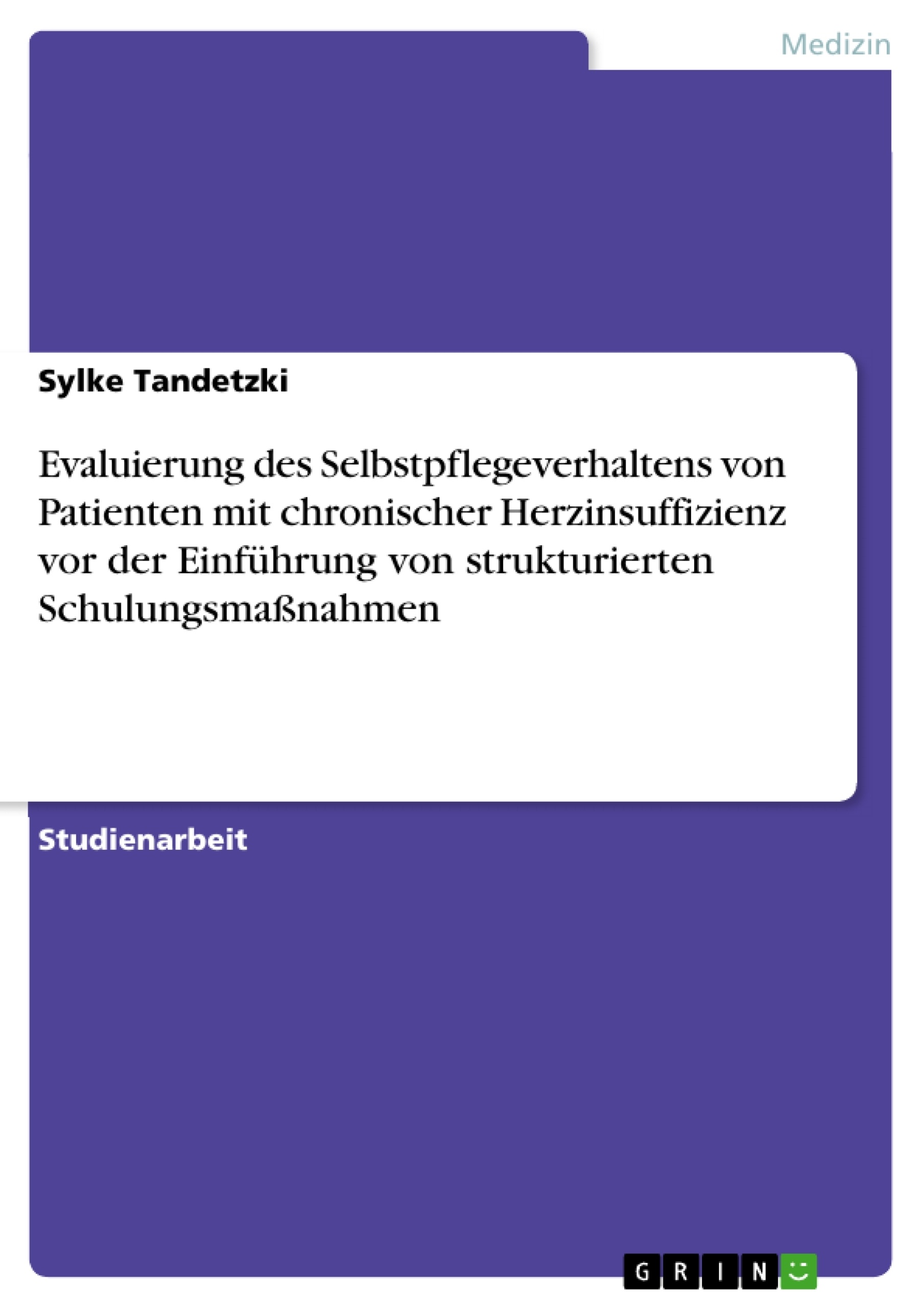Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Thematik der Selbstpflege bei Herzinsuffizienz. Das hat folgenden Hintergrund:
Eine wesentliche Herausforderung stellt für die Behandlung der Herzinsuffizienz die Verhinderung des Fortschreitens der Erkrankung dar. Dabei müssen präventi-ve Maßnahmen zur Vermeidung der Dekompensation ergriffen werden, die Le-bensqualität der Betroffenen soll gesteigert und die Letalität vermindert werden. Um diese Ziele zu erreichen, sind Selbstmanagementprogramme für die betroffene Patientengruppe von enormer Bedeutung.
In der Nationalen VersorgungsLeitlinie Chronische Herzinsuffizienz heißt es: „Durch Empfehlung und Hinweise zum Nutzen von Information und Schulung der Patienten, insbesondere zu täglicher Gewichtskontrolle und zur Medikation sollen die Therapietreue verbessert und der Ressourceneinsatz effizienter gestaltet werden.“ Weiterhin ist an anderer Stelle zu lesen: „…soll die Rate an vermeidbaren Krankenhauseinweisungen auf dem Boden von kardialen Exacerbationen gesenkt werden.“ (Bundesärztekammer et al. 2013)
Anhand dieser Beispiele ist erkennbar, dass durch die Übernahme von Verantwortung durch die Betroffenen selbst im Umgang mit ihrer Erkrankung die Rehospita-lisierungsrate gesenkt werden kann und dadurch die Lebensqualität der Patienten erhöht wird. Diese Übernahme von Verantwortung kann aber nur erfolgen, wenn der Patient sich mit seiner Erkrankung auseinandersetzt, entsprechende Schulungs- und Beratungsangebote zur Verfügung stehen und evaluiert wird, inwieweit bereits selbstpflegende Maßnahmen durch den Patienten ergriffen wurden.
Auf der kardiologischen Station einer Klinik im Süden von Sachsen Anhalt wurde die Selbstpflege von an Herzinsuffizienz Erkrankten von Oktober bis Dezember 2015 gemessen. Folgende Fragestellung soll in dieser Arbeit erforscht werden:
Welche Ergebnisse hat die Messung der Selbstpflege vor der Implementierung von Schulungsmaßnahmen geliefert und was kann man daraus ableiten?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Methodisches Vorgehen
- 3. Herzinsuffizienz
- 3.1 Definition der Herzinsuffizienz
- 3.2 Epidemiologie und Prognose der Herzinsuffizienz
- 3.3 Diagnostik und Therapie der Herzinsuffizienz
- 4. Herzinsuffizienz unter dem Aspekt der Chronizität
- 4.1 Chronische Erkrankungen - verschiedene Definitionen
- 4.2 Herzinsuffizienz als chronische Erkrankung
- 4.3 Die chronische Erkrankung der Herzinsuffizienz in Bezug auf Case Management
- 5. Die Selbstpflegedefizit-Theorie nach Orem
- 5.1. Was ist Selbstpflege
- 5.2 Der Zusammenhang zwischen Selbstpflegeverhalten und Herzinsuffizienz
- 6. Ergebnisse
- 6.1 Alters- und Geschlechterverteilung
- 6.2 Ergebnisse in Bezug auf Fragen zu Verhaltensregeln
- 6.3 Ergebnisse in Bezug auf die Selbsteinschätzung des Gesundheitszustandes
- 7. Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert das Selbstpflegeverhalten von Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz vor der Einführung von strukturierten Schulungsmaßnahmen. Die Analyse zielt darauf ab, einen umfassenden Überblick über die bestehende Selbstpflegepraxis zu liefern und daraus Handlungsempfehlungen für die Implementierung gezielter Schulungsprogramme abzuleiten.
- Die Rolle der Selbstpflege bei der Bewältigung chronischer Herzinsuffizienz
- Die Bedeutung von Selbstmanagementprogrammen zur Verbesserung der Lebensqualität und Reduzierung der Hospitalisierungsraten
- Die Analyse des Selbstpflegeverhaltens von Patienten mit Herzinsuffizienz anhand von quantitativen Daten
- Die Entwicklung von Empfehlungen für die Gestaltung von Schulungsmaßnahmen zur Förderung der Selbstpflege
- Die Untersuchung der Relevanz von Selbstpflege für die Effizienz des Gesundheitssystems
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Relevanz der Herzinsuffizienz als chronische Erkrankung und die Herausforderungen in der Behandlung und Versorgung der betroffenen Patienten. Die Studie untersucht das Selbstpflegeverhalten von Patienten mit Herzinsuffizienz, um Erkenntnisse für die Entwicklung von gezielten Schulungsmaßnahmen zu gewinnen.
Das Kapitel "Methodisches Vorgehen" beschreibt die quantitative Querschnittstudie, die zur Datenerhebung eingesetzt wurde. Die Studie analysiert das Selbstpflegeverhalten der Patienten im Hinblick auf ihre Erkrankung.
Das Kapitel "Herzinsuffizienz" definiert den Begriff der Herzinsuffizienz, beleuchtet ihre epidemiologische Relevanz und prognostische Aspekte, sowie diagnostische und therapeutische Möglichkeiten.
Das Kapitel "Herzinsuffizienz unter dem Aspekt der Chronizität" betrachtet die Herzinsuffizienz als chronische Erkrankung und erörtert verschiedene Definitionen chronischer Erkrankungen.
Die Selbstpflegedefizit-Theorie nach Orem wird im Kapitel "Die Selbstpflegedefizit-Theorie nach Orem" vorgestellt. Die Theorie beleuchtet den Zusammenhang zwischen Selbstpflegeverhalten und Herzinsuffizienz.
Die Kapitel "Ergebnisse" präsentiert die Ergebnisse der Studie, die die Alters- und Geschlechterverteilung der Befragten, sowie das Selbstpflegeverhalten in Bezug auf Verhaltensregeln und Selbsteinschätzung des Gesundheitszustandes analysieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Selbstpflege, chronische Herzinsuffizienz, quantitative Querschnittstudie, Selbstmanagementprogramme, Schulungsmaßnahmen, Lebensqualität, Hospitalisierungsraten, und Rehospitalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Selbstpflege bei Herzinsuffizienz so wichtig?
Gute Selbstpflege, wie tägliche Gewichtskontrolle und Therapietreue, kann die Rehospitalisierungsrate senken und die Lebensqualität deutlich erhöhen.
Was ist die Grundlage der Selbstpflegedefizit-Theorie nach Orem?
Die Theorie besagt, dass Pflegebedürftigkeit entsteht, wenn die Selbstpflegekompetenz des Patienten nicht ausreicht, um seinen Bedarf zu decken.
Was war das Ziel der Untersuchung in der sächsischen Klinik?
Es wurde evaluiert, wie Patienten ihr Selbstpflegeverhalten vor der Einführung spezieller Schulungsmaßnahmen selbst einschätzen.
Welche Faktoren beeinflussen die Therapietreue laut der Leitlinien?
Gezielte Informationen und strukturierte Schulungen sind essenziell, um Patienten zu befähigen, Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen.
Was sind typische präventive Maßnahmen für Herzinsuffizienz-Patienten?
Dazu gehören die regelmäßige Medikation, die Überwachung des Körpergewichts zur Vermeidung von Dekompensationen und ein angepasster Lebensstil.
- Quote paper
- Sylke Tandetzki (Author), 2017, Evaluierung des Selbstpflegeverhaltens von Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz vor der Einführung von strukturierten Schulungsmaßnahmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374690