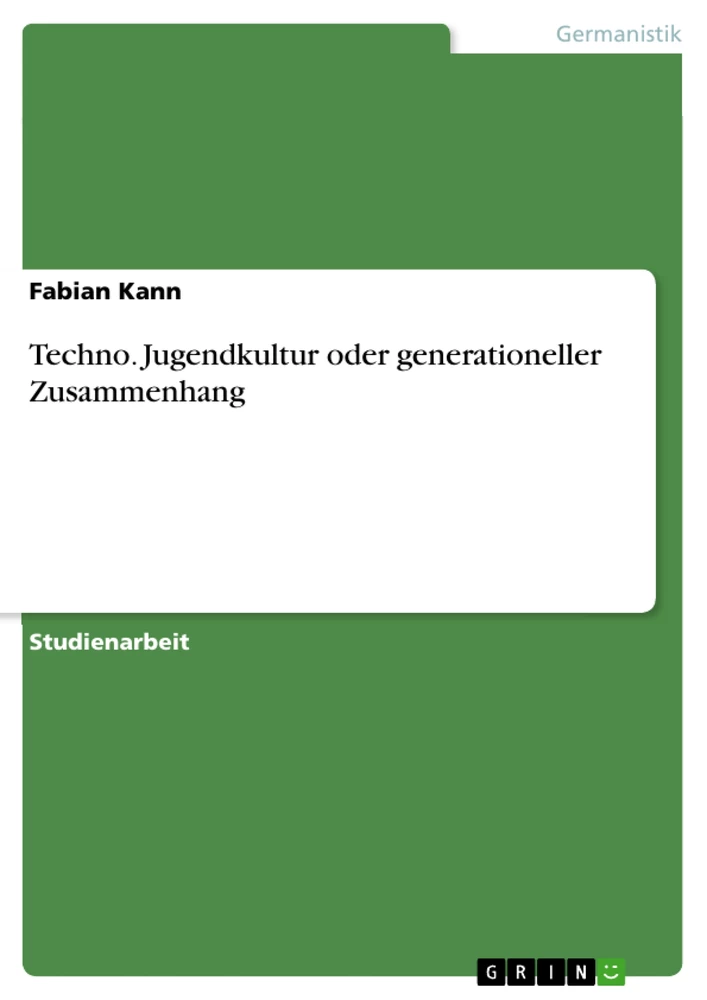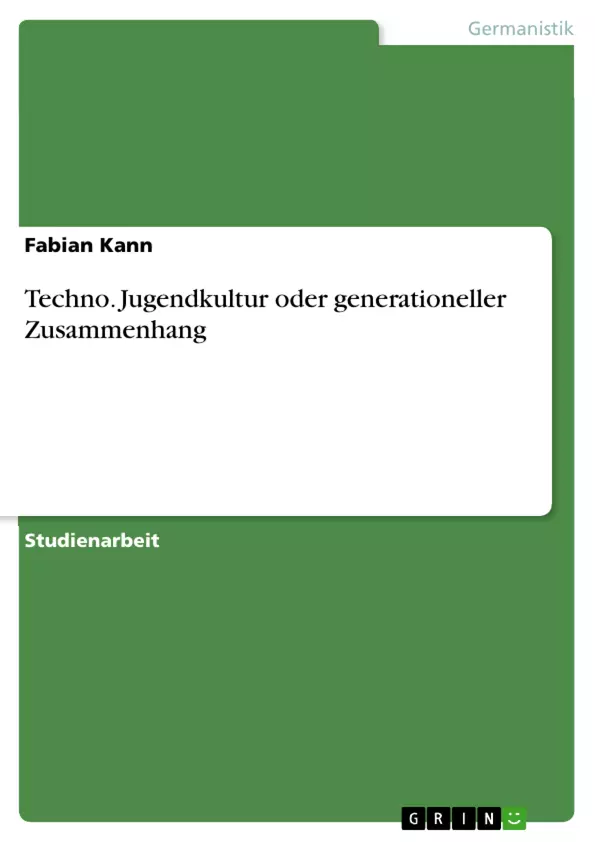In der heutigen Zeit wird der Generationsbegriff immer mehr zum Modebegriff. In der Generierung von Generationen durch die Medien geht es weniger um die von Mannheim definierte Generationenabfolgen, sondern um die Zuschreibung bestimmter gemeinsamer Merkmale einer sozialen Gruppe. In welchem Maße diese Merkmale mit einem generationsspezifischen Zusammenhang übereinstimmen, muss einzeln beurteilt werden.
Zu Beginn dieser Arbeit soll der Generationsbegriff soziologisch erläutert werden, um eine wissenschaftliche Basis für die spätere Auseinandersetzung mit der Thematik zu erhalten. Im Anschluss daran sollen, durch eine Charakterisierung der Generation Techno, die wesentlichen Merkmale und Identifikationsfaktoren erfasst werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Generationsbegriff
- 2.1 Versuch einer Definition
- 2.2 Familiäre Generation
- 2.3 Gesellschaftliche Generation
- 3. Generation Techno
- 3.1 Charakterisierung der Generation Techno
- 3.1.1 Zusammengehörigkeitsgefühl / Unity
- 3.1.2 Distinktion
- 3.1.3 Politik, Autonomie und die Love Parade
- 3.1.4 Realitätsflucht und Hedonismus oder Botschaft
- 4. Analyse der Romanvorlage
- 4.1 Narrative Strategien
- 4.1.1 Ein sinnstiftender Endpunkt
- 4.1.2 Die Einengung auf relevante Ereignisse
- 4.1.3 Die narrative Ordnung der Ereignisse
- 4.1.4 Die Herstellung von Kausalverbindungen
- 4.2 Generation Techno oder Jugendkultur Techno?
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Jugendkultur „Generation Techno" und untersucht, ob sie als eigenständige Generation betrachtet werden kann oder lediglich eine Jugendkultur darstellt. Die Arbeit analysiert den Generationsbegriff soziologisch und zeichnet ein Bild der Generation Techno anhand ihrer Merkmale und Identifikationsfaktoren. Dabei wird die Romanvorlage „Generation XTC. Techno & Ekstase“ von Friedhelm Böpple und Ralf Knüfer als Diskussionsbasis genutzt.
- Analyse des Generationsbegriffs
- Charakterisierung der Generation Techno
- Untersuchung der Merkmale und Identifikationsfaktoren der Generation Techno
- Bewertung der Einordnung der Generation Techno als eigenständige Generation oder Jugendkultur
- Relevanz der Romanvorlage „Generation XTC. Techno & Ekstase“ für die Untersuchung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert den Generationsbegriff im soziologischen Kontext und definiert verschiedene Arten von Generationen, wie die familiäre, die gesellschaftliche und die chronologische Generation. Im zweiten Kapitel wird die Generation Techno charakterisiert, ihre Merkmale und Identifikationsfaktoren werden beschrieben. Dabei werden Themen wie Zusammengehörigkeitsgefühl, Distinktion, Politik, Autonomie, die Love Parade sowie die Frage nach Realitätsflucht oder Botschaft beleuchtet. Das dritte Kapitel widmet sich der Analyse der Romanvorlage „Generation XTC. Techno & Ekstase“, wobei die narrativen Strategien des Buches, wie die Herstellung eines sinnstiftenden Endpunktes, die Einengung auf relevante Ereignisse, die narrative Ordnung der Ereignisse und die Herstellung von Kausalverbindungen, untersucht werden. Zum Schluss wird diskutiert, ob die Generation Techno als eigene Generation oder als Jugendkultur betrachtet werden kann.
Schlüsselwörter
Generationsbegriff, Generation Techno, Jugendkultur, Techno-Kultur, Romanvorlage, Narrative Strategien, Zusammengehörigkeitsgefühl, Distinktion, Politik, Autonomie, Love Parade, Realitätsflucht, Hedonismus, Botschaft.
Häufig gestellte Fragen
Ist Techno eine eigenständige Generation oder nur eine Jugendkultur?
Die Arbeit analysiert, ob die "Generation Techno" durch gemeinsame Merkmale und Erfahrungen einen soziologischen Generationszusammenhang bildet oder lediglich eine zeitlich begrenzte Subkultur darstellt.
Was sind die Identifikationsfaktoren der Techno-Kultur?
Zentrale Faktoren sind das Gefühl der Zusammengehörigkeit (Unity), Distinktion von der Elterngeneration, Hedonismus und die Flucht aus der Alltagsrealität.
Welche Rolle spielt die Love Parade in diesem Kontext?
Die Love Parade wird als Symbol für die Sichtbarkeit, Autonomie und die (vorgebliche) politische Botschaft der Techno-Bewegung untersucht.
Was ist die Romanvorlage „Generation XTC“?
Das Buch von Böpple und Knüfer dient als Diskussionsbasis, um die narrativen Strategien und die Selbstdarstellung der Techno-Szene in den 90er Jahren zu verstehen.
Wie definiert die Soziologie den Begriff "Generation"?
Nach Karl Mannheim ist eine Generation eine Gruppe von Menschen, die durch gemeinsame historische Erlebnisse und soziale Merkmale in einer prägenden Lebensphase verbunden sind.
- Quote paper
- Fabian Kann (Author), 2017, Techno. Jugendkultur oder generationeller Zusammenhang, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374706