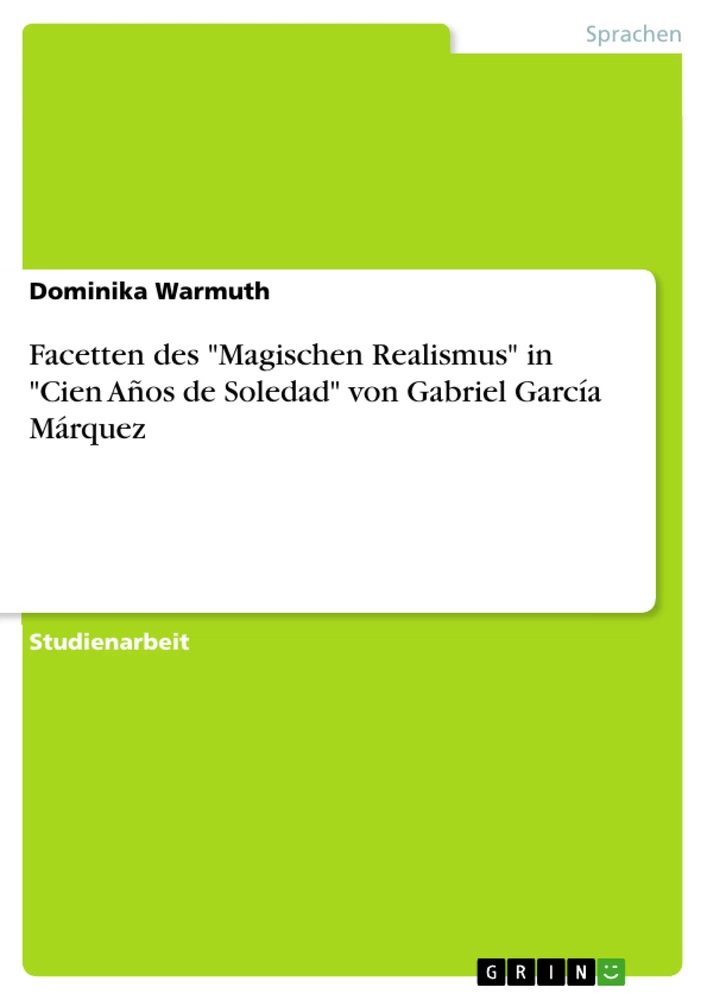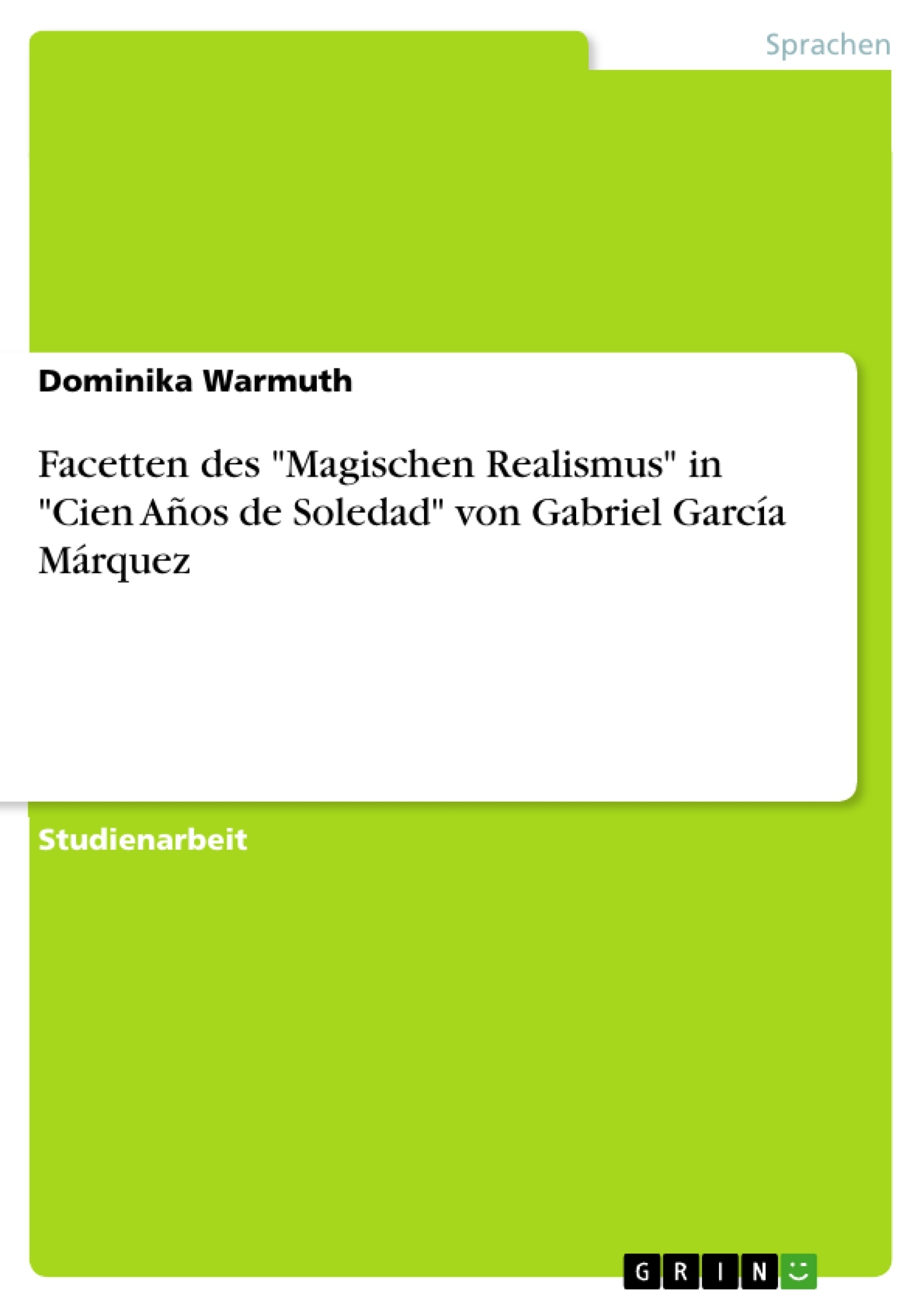Die vorliegende Arbeit behandelt die verschiedenen Facetten des magischen Realismus anhand des Romans "Cien años de soledad". Die Frage, inwieweit dieses ein magisch realistisches Werk sei, soll am Ende dieser Arbeit schlüssig beantwortet werden. Außerdem soll die Entstehung des Begriffes geklärt und sein Weg von Europa nach Lateinamerika anschaulich gemacht werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Entstehung des Begriffs „Magischer Realismus“
- II.I Magischer Realismus in Lateinamerika
- III. Die Charakteristika des magischen Realismus
- IV. Aspekte des magischen Realismus in Cien años de Soledad
- IV.I Analyse der Figuren
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, verschiedene Facetten des magischen Realismus anhand des Romans „Cien años de soledad“ von Gabriel García Márquez zu beleuchten. Die Arbeit befasst sich mit der Entstehung des Begriffs „Magischer Realismus“, seiner Verbreitung von Europa nach Lateinamerika und seinen charakteristischen Merkmalen. Des Weiteren werden ausgewählte Figuren im Roman analysiert, um ihre Bedeutung für den magischen Realismus zu beleuchten.
- Die Entstehung des Begriffs „Magischer Realismus“
- Die Verbreitung des magischen Realismus in Lateinamerika
- Die Charakteristika des magischen Realismus
- Die Analyse von Figuren im Roman „Cien años de soledad“
- Die Bedeutung der Figuren für den magischen Realismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des magischen Realismus ein und stellt den Roman „Cien años de soledad“ von Gabriel García Márquez als zentrale Untersuchungsobjekt vor. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Entstehung des Begriffs „Magischer Realismus“, der 1923 von Franz Roh im Kontext der Malerei geprägt wurde. Es wird auch auf die Bedeutung des Begriffs in der lateinamerikanischen Literatur eingegangen. Das dritte Kapitel analysiert die Charakteristika des magischen Realismus und beleuchtet seine Besonderheiten im Roman „Cien años de soledad“. Das vierte Kapitel widmet sich der Analyse ausgewählter Figuren und deren Bedeutung für den magischen Realismus.
Schlüsselwörter
Magischer Realismus, Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, Lateinamerika, Franz Roh, Massimo Bontempelli, Arturo Uslar Pietri, Miguel Ángel Asturias, Figuren, Analyse, Interpretation
Häufig gestellte Fragen
Was ist Magischer Realismus?
Es ist ein literarischer Stil, bei dem magische oder phantastische Elemente als selbstverständlicher Teil einer realistischen Welt dargestellt werden.
Wie zeigt sich der Magische Realismus in "Cien Años de Soledad"?
Im Roman von Gabriel García Márquez verschmelzen Historie, Mythos und Übernatürliches (wie schwebende Menschen oder Geister) zu einer untrennbaren Realität im fiktiven Ort Macondo.
Woher stammt der Begriff "Magischer Realismus"?
Der Begriff wurde ursprünglich 1923 vom deutschen Kunstkritiker Franz Roh geprägt, um eine neue Richtung in der Malerei zu beschreiben, bevor er seinen Weg in die lateinamerikanische Literatur fand.
Wer sind wichtige Vertreter des Magischen Realismus in Lateinamerika?
Neben Gabriel García Márquez zählen Arturo Uslar Pietri, Miguel Ángel Asturias und Jorge Luis Borges zu den prägenden Autoren dieser Strömung.
Warum ist die Analyse der Figuren für diesen Stil wichtig?
Die Figuren im Roman (wie die Familie Buendía) nehmen das Magische ohne Erstaunen hin, was ein Kernmerkmal des magischen Realismus ist und deren psychologische Tiefe unterstreicht.
- Arbeit zitieren
- Dominika Warmuth (Autor:in), 2017, Facetten des "Magischen Realismus" in "Cien Años de Soledad" von Gabriel García Márquez, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374722