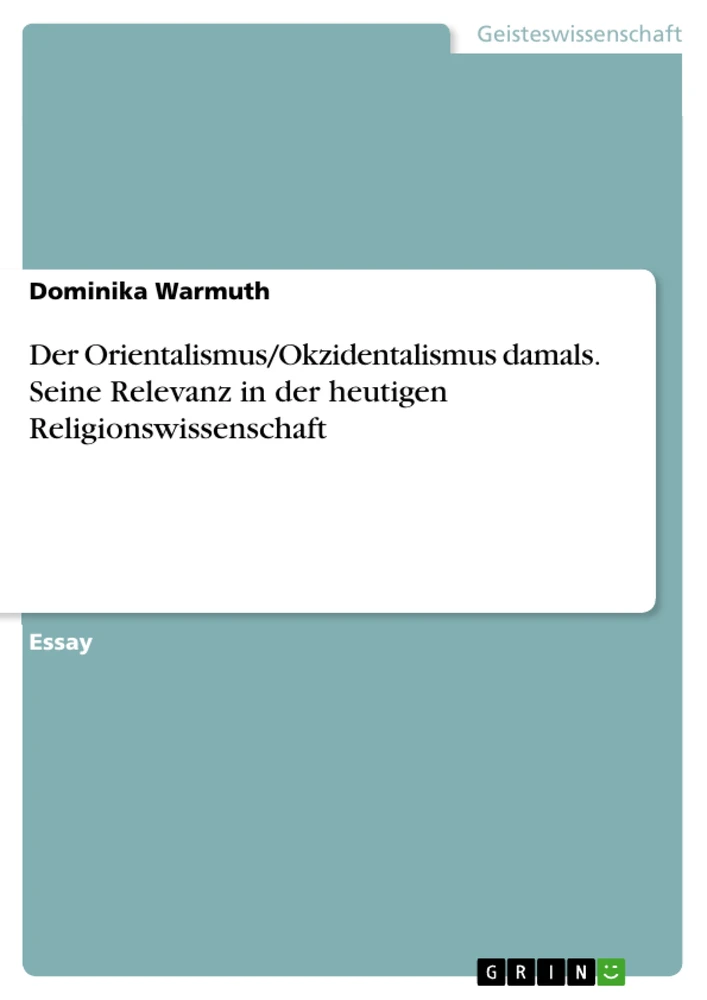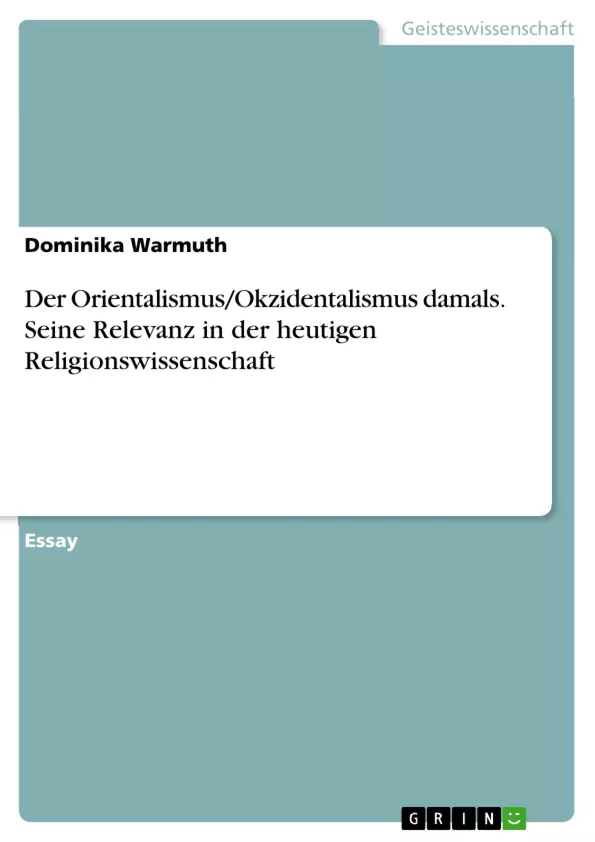Auf der Suche nach Informationen zum Thema Orientalismus/Okzidentalismus stößt man immer wieder auf das Werk „Orientalism“ des US-amerikanischen Literaturtheoretikers und –kritikers Edward W. Said. Es versteht sich schnell, dass der Begriff Orientalismus entscheidend von Said geprägt und durch sein Werk sogar im Kontext ebendieses Diskurses geschaffen wurde. Sein Werk fasst die im Westen geführte Debatte über den sogenannten Orient zusammen. Dessen Grundlage ist die Trennung zwischen Orient und Okzident, die offenbar auf der Suche nach Identitätsbildung und vorherrschenden Machtinteressen entstanden ist.
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Relevanz die Debatte um Orientalismus/Okzidentalismus für die religionswissenschaftliche Darstellung von Religionen hat. Als Grundlage für die Beantwortung dieser Frage habe ich „Orientalism“ besonders einbezogen. Somit befasse ich mich zunächst mit der Definition und Entstehung der Begriffe Orientalismus und Okzidentalismus in der Religionswissenschaft und anschließend mit dem Autor des Werkes „Orientalism“ sowie dem Werk selbst. Anschließend möchte ich eine vorherrschende Meinung zum Orient und zum Islam in Deutschland anhand kurzer Beispiele darstellen. Darauf folgt ein Kapitel, in dem ich mich mit der gravierenden veränderten westlichen Meinung zum Osten seit den Anschlägen des 11. September 2001 befasse. Die Frage der Relevanz der Debatte um die beiden Phänomene wird im Laufe der Kapitel beantwortet. Im Fazit gehe ich jedoch nochmals darauf ein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Aufnahme von Theorien der Gender-Studies in die Religionswiss.
- Der aktuelle Forschungsstand
- Kritik an der Kategorie „Gender“
- Das Problemfeld Forschung
- Das Beispiel der Abtreibungsproblematik
- Die Relevanz
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Relevanz der Debatte um Orientalismus/Okzidentalismus für die religionswissenschaftliche Darstellung von Religionen. Dabei wird insbesondere auf das Werk "Orientalism" von Edward W. Said zurückgegriffen, um die Entstehung und Definition der Begriffe Orientalismus und Okzidentalismus in der Religionswissenschaft zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet auch die vorherrschende Meinung zum Orient und zum Islam in Deutschland anhand von Beispielen und untersucht die Veränderungen in der westlichen Wahrnehmung des Ostens nach den Anschlägen vom 11. September 2001.
- Die Entstehung und Definition von Orientalismus und Okzidentalismus in der Religionswissenschaft
- Die Rolle von Edward W. Saids Werk "Orientalism" in der Debatte um Orientalismus/Okzidentalismus
- Die vorherrschende Meinung zum Orient und zum Islam in Deutschland
- Die veränderte westliche Wahrnehmung des Ostens nach den Anschlägen vom 11. September 2001
- Die Relevanz der Debatte um Orientalismus/Okzidentalismus für die religionswissenschaftliche Darstellung von Religionen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik des Orientalismus/Okzidentalismus und die Relevanz des Werkes "Orientalism" von Edward W. Said ein. Sie beschreibt die grundlegende Trennung zwischen Orient und Okzident und stellt die Frage nach deren Relevanz für die religionswissenschaftliche Darstellung von Religionen. Die Arbeit stellt dar, wie sie sich mit der Definition und Entstehung der Begriffe Orientalismus und Okzidentalismus befasst, bevor sie sich mit Edward W. Said und seinem Werk "Orientalism" auseinandersetzt. Anschließend wird die vorherrschende Meinung zum Orient und zum Islam in Deutschland anhand von Beispielen dargestellt.
Die Aufnahme von Theorien der Gender-Studies in der Religionswiss.
Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Gender-Studies und ihre Bedeutung für die religionswissenschaftliche Forschung. Es wird die historische Entwicklung von feministischen Theorien und die Kritik an der Ungleichbehandlung von Frauen und Männern dargestellt. Die Entstehung des Begriffs „Gender“ und seine Unterscheidung vom Begriff „Sex“ wird erläutert. Die Forschungsziele der Gender-Studies, die Analyse der Konstruktionsprozesse der Geschlechteridentität und die Kritik am Androzentrismus werden beleuchtet. Das Kapitel diskutiert die Bedeutung von Genderforschung für die Religionswissenschaft, die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels und die kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte der traditionellen Erforschung von Religionen.
Der aktuelle Forschungsstand
Das Kapitel analysiert die aktuelle Forschungslandschaft und die Einbeziehung von Gender-Studies in die Religionswissenschaft. Es stellt fest, dass Frauen in religionswissenschaftlichen Texten häufig nicht als selbstständige religiöse Subjekte dargestellt werden, sondern in Beziehung zum Mann gesetzt werden. Die androzentrische Forschungssituation und die mangelnde Berücksichtigung von weiblichen Perspektiven werden kritisiert. Die Bedeutung eines fokussierten Blicks auf das Geschlechterverhältnis in der religionswissenschaftlichen Forschung wird betont.
Kritik an der Kategorie „Gender“
In diesem Kapitel werden verschiedene Kritiken an der Einbeziehung von Gendertheorien in die Religionswissenschaft diskutiert. Es wird betont, dass ein Paradigmenwechsel notwendig ist, um religiöse Traditionen und die Ergebnisse der Forschung aus beiden Geschlechterperspektiven zu betrachten. Gender-Forschung soll mit der Religionswissenschaft in Beziehung gesetzt und die Analysekategorien Rasse, Klasse, Schicht oder Alter in die Untersuchungen einbezogen werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Orientalismus, Okzidentalismus, Gender-Studies, Religionswissenschaft, Androzentrismus, Islam, Orient, Deutschland, Edward W. Said, "Orientalism", Feministische Theorien, Geschlechteridentität, Paradigmenwechsel, Forschungsstand, Kritik, westliche Wahrnehmung, Anschläge vom 11. September 2001.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern von Edward Saids "Orientalism"?
Said beschreibt die westliche Konstruktion des "Orients" als Instrument der Identitätsbildung und Machtausübung des Okzidents.
Wie beeinflusste der 11. September die Orientalismus-Debatte?
Nach den Anschlägen veränderte sich die westliche Wahrnehmung des Ostens und des Islams massiv, was die Relevanz der Debatte in der Religionswissenschaft verstärkte.
Welche Rolle spielen Gender-Studies in der Religionswissenschaft?
Sie kritisieren den Androzentrismus (Männerfokussierung) der traditionellen Forschung und fordern eine Analyse der Geschlechterverhältnisse in Religionen.
Was bedeutet "Androzentrismus" in der Forschung?
Es beschreibt eine Forschungssituation, in der Frauen nicht als selbstständige Subjekte, sondern nur in Beziehung zu Männern betrachtet werden.
Was ist der Unterschied zwischen "Gender" und "Sex"?
Gender bezeichnet das soziale Geschlecht (Konstruktion), während Sex das biologische Geschlecht beschreibt.
- Quote paper
- Dominika Warmuth (Author), 2017, Der Orientalismus/Okzidentalismus damals. Seine Relevanz in der heutigen Religionswissenschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374725