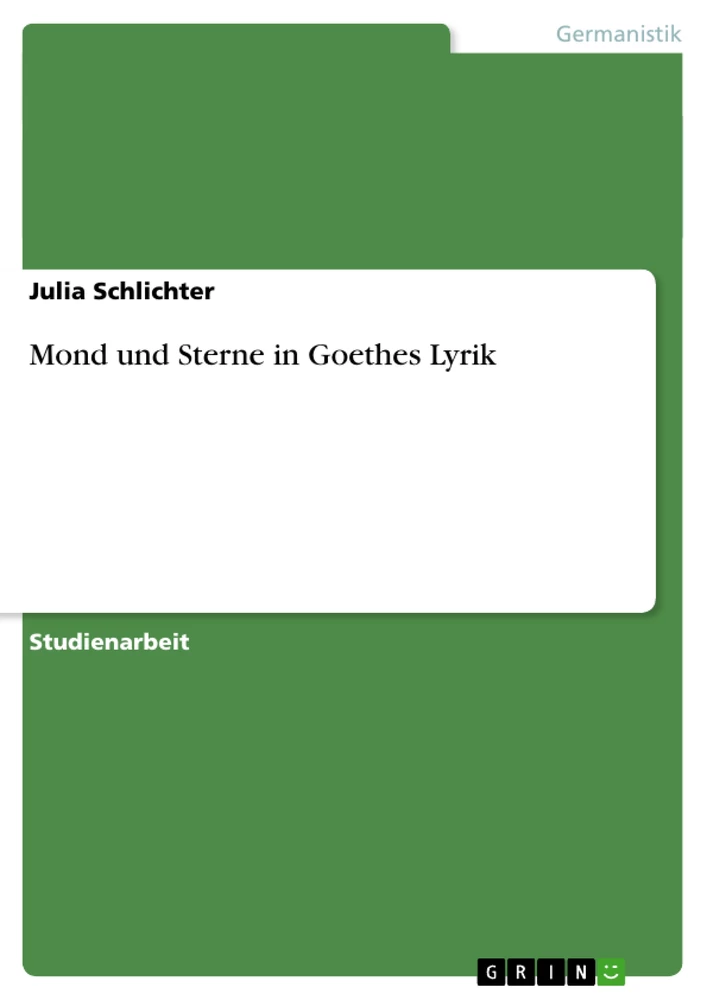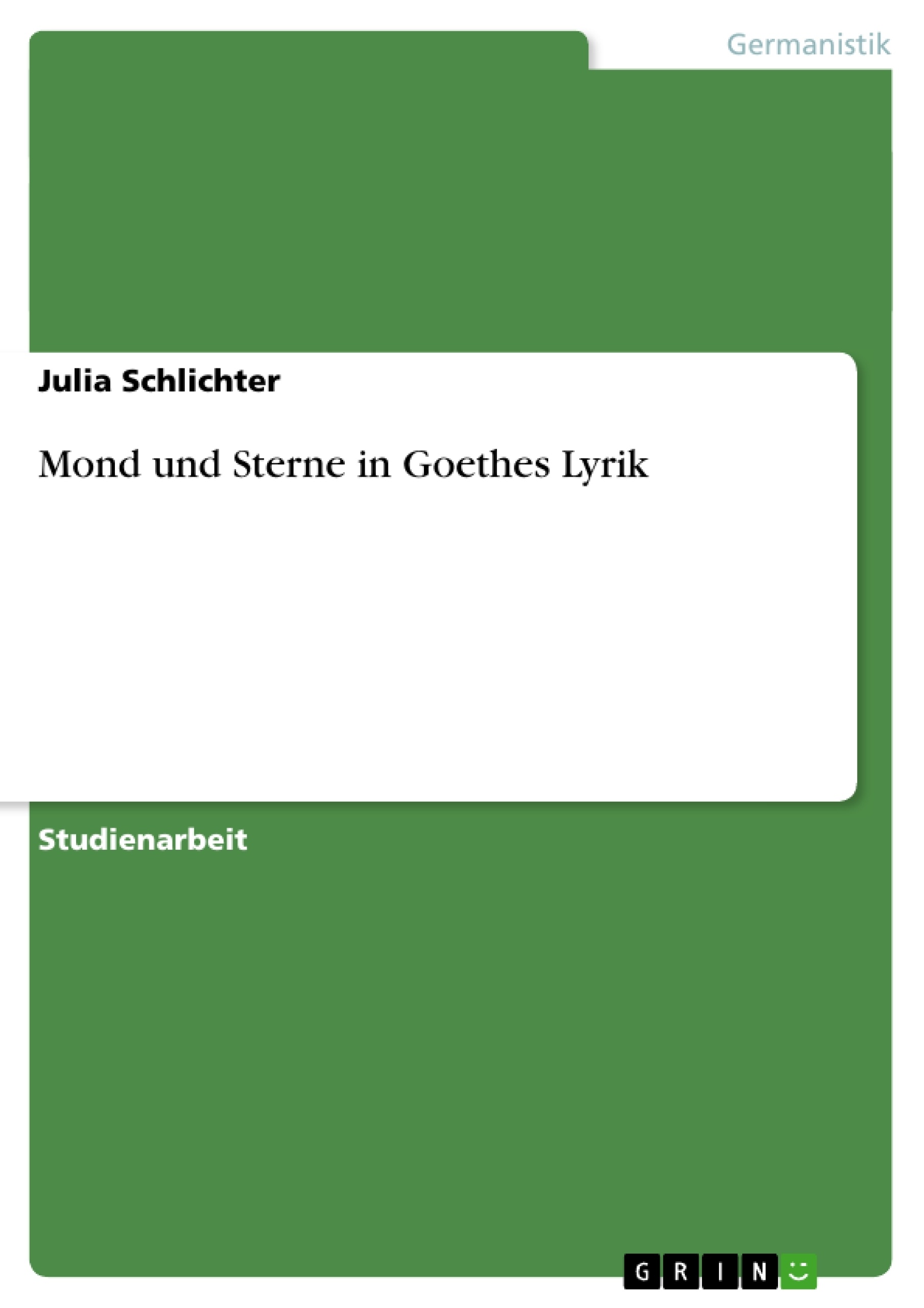Zwischen 1776 und 1778 schrieb Johann Wolfgang von Goethe ein Gedicht, welches später in zwei weiteren Variationen erscheinen sollte. An den Mond ist ein lyrisches Werk seiner ersten Weimarer Jahre. Eine der beiden darauf folgenden Fassungen schrieb er selbst nieder, sie wurde 1789 in den Schriften veröffentlicht, die andere stammt von Charlotte von Stein. In der hier vorliegenden Arbeit sollen drei verschiedene Aufsätze, welche sich jeweils mit dem Gedicht – auch teilweise in seinen drei Varianten – in unterschiedlicher Weise auseinandersetzen, untersucht werden. Dabei gilt es, verschiedenartige wie auch ähnliche Positionen der Autoren zu vergleichen und nachzuvollziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Wolfgang Schadewaldt:
- „Mond und Sterne in Goethes Lyrik – ein Beitrag zu Goethes erlebtem Platonismus“
- ,,Musikalität der Sprache”
- Das ,,innere melodische Fortströmen der Empfindungen”
- Das sympathetische Einssein mit der Natur
- Emil Staiger:
- Goethe. Frühe Weimarer Lyrik“
- Goethes Mondlied: Geklärte und ungeklärte Fragen
- „Des Menschen Seele gleicht dem Wasser”
- ,,Der Mensch taucht auf”
- Helmut Arntzen:
- ,,An den Mond”
- Bekannte und neue Fragen
- Akzentuierungen
- ,,Bewegung” als Quintessenz des Gedichts
- Zusammenfassung - Ein Vergleich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, drei verschiedene Aufsätze zu untersuchen, die sich mit Johann Wolfgang von Goethes Gedicht „An den Mond“ auseinandersetzen. Im Fokus stehen dabei die unterschiedlichen Perspektiven der Autoren und die Analyse ihrer jeweiligen Argumente. Durch den Vergleich der Ansätze soll ein tieferes Verständnis des Gedichtes und seiner Bedeutung im Kontext der Weimarer Lyrik gewonnen werden.
- Die „Musikalität der Sprache“ in Goethes Gedicht
- Die Rolle des „inneren melodischen Fortströmens der Empfindungen”
- Das Motiv des „sympathetischen Einsseins des menschlichen Innern mit der Natur”
- Der Einfluss der Natur auf die Seelenlandschaft des lyrischen Ichs
- Die Bedeutung der verschiedenen Gedichtfassungen
Zusammenfassung der Kapitel
Der Aufsatz von Wolfgang Schadewaldt analysiert Goethes „An den Mond“ im Kontext seiner frühen Lyrik und betont die Bedeutung des Motivs von Mond und Sternen für Goethes erlebten Platonismus. Schadewaldt analysiert insbesondere die „Musikalität der Sprache“ und das „innere melodische Fortströmen der Empfindungen” im Gedicht.
Der Aufsatz von Emil Staiger beleuchtet Goethes Mondlied in Bezug auf die zentrale These „Des Menschen Seele gleicht dem Wasser“. Staiger untersucht die verschiedenen Phasen der Seelischen Entwicklung des lyrischen Ichs und die Bedeutung der Natur in diesem Prozess.
Helmut Arntzen widmet sich dem Gedicht „An den Mond“ aus einer neuen Perspektive und untersucht die „Bewegung” als zentrale Quintessenz des Gedichts. Er beleuchtet die verschiedenen Akzentuierungen und die Bedeutung der verschiedenen Gedichtfassungen.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Themen „An den Mond“, „Johann Wolfgang von Goethe“, „Weimarer Lyrik“, „Musikalität der Sprache“, „inneres melodisches Fortströmen der Empfindungen“, „Natur“, „Seelenlandschaft“, „Platonismus“, „Gedichtanalyse“, „Textvergleich“, „verschiedene Fassungen“.
- Citar trabajo
- Julia Schlichter (Autor), 2003, Mond und Sterne in Goethes Lyrik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37481