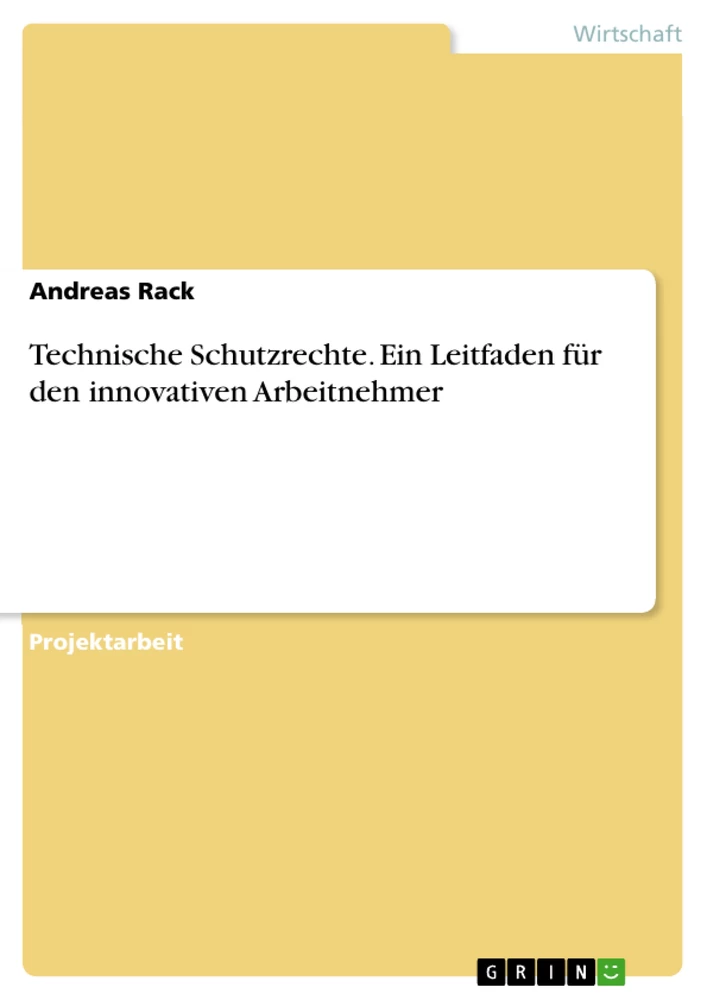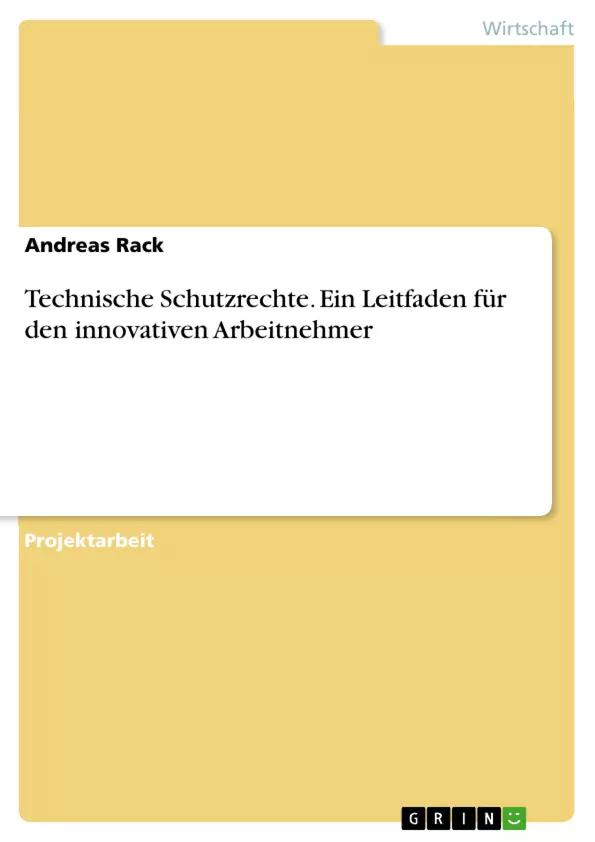Im Jahre 2016 gingen insgesamt 67.898 Patente-, 14.024 Gebrauchsmuster-, 72.807 Marken- und 54.588 Designanmeldungen beim Deutschen Patent- und Markenamt ein. Dabei liegt der prozentuale Anteil von Privatanmeldern für das Jahr 2016 lediglich bei 5,7%. Es ist der Frage nachzugehen, aus welchen Gründen der Großteil der Anmeldungen von Unternehmen und Institutionen stammt. Dies kann vor allem durch das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen bzw. durch das Arbeitnehmererfin-dungsgesetz (ArbnErfG) begründet werden. Zunächst ist es notwendig, dass theoretische Grundlagen geschaffen werden.
Hierzu wird zuerst der Begriff „Erfindung“ vorgestellt. Im Anschluss daran werden die verschiedenen Schutzrechte in Deutschland erläutert. Im nächsten Schritt erfolgt die Darstellung der Charakteristika der Patente und Gebrauchsmuster und es wird eine Unterscheidung aufgrund der gesetzlichen Grundlagen vorgenommen.
Mit diesem Wissen ist es anschließend möglich, sich ausführlich mit dem Arbeitnehmererfindungsgesetz befassen zu können.
Als Produkt dieser Projektarbeit wird ein Leitfaden zur Vorgehensweise eines vermeintlichen Erfinders angestrebt, der sich im Dienstverhältnis befindet.
Der Leitfaden beinhaltet eine schriftliche Ausarbeitung zum Thema „Technische Schutzrechte“ sowie einen Ablaufplan zur übersichtlicheren Darstellung des komplexen und bedeutenden Themengebietes. Denn schon wie der ehemalige Präsident des Deutschen Patent- und Markenamtes Erich Häußer sagte: "Wer nicht erfindet, verschwindet. Wer nicht patentiert, verliert". Ist der Arbeitnehmer über seine Rechte und Pflichten im Klaren, profitiert auch der Arbeitgeber davon. Denn nur wenn der ideenreiche Angestellte weißt, dass er beispielsweise eine Erfindung zu melden hat, wird er dies auch tun.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition der Begrifflichkeit „Erfindung“
- Technische Schutzrechte in Deutschland
- Einordnung der technischen Schutzrechte
- Das Patent
- Das Gebrauchsmuster
- Gegenüberstellung von Patent und Gebrauchsmuster
- Schutzrechts-Recherche
- Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbnErfG)
- Anwendungsbereich
- Differenzierung der Erfindungen
- Gebundene Erfindung (Diensterfindung)
- Definition
- Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers bzw. -gebers
- Freie Erfindung
- Definition
- Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers bzw. -gebers
- Technischer Verbesserungsvorschlag
- Definition
- Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers bzw. -gebers
- Erfinder und Anmelder
- Erfinder
- Anmelder
- Zusammenfassung
- Vergütung
- Gesetzliche Grundlage
- Bestimmen der Vergütung
- Der Ablaufplan
- Erstellung des Ablaufplans
- Nutzen des Ablaufplans
- Abschließende Worte
- Fazit
- Ergänzende Informationen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Thematik der technischen Schutzrechte im Kontext des Arbeitnehmererfindungsgesetzes (ArbnErfG). Ziel ist es, einen Leitfaden für vermeintliche Erfinder im Dienstverhältnis zu erstellen, der eine verständliche Darstellung der relevanten rechtlichen Grundlagen bietet.
- Definition und Abgrenzung der Begrifflichkeit "Erfindung" im rechtlichen Kontext
- Darstellung der technischen Schutzrechte in Deutschland, insbesondere Patent und Gebrauchsmuster
- Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers und Arbeitgebers im Zusammenhang mit Arbeitnehmererfindungen
- Analyse des Arbeitnehmererfindungsgesetzes und seiner Anwendung in der Praxis
- Erstellung eines übersichtlichen Ablaufplans, der die relevanten Schritte zur Anmeldung einer Erfindung im Arbeitsverhältnis verdeutlicht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Definition des Begriffs "Erfindung" und stellt die verschiedenen technischen Schutzrechte in Deutschland vor, insbesondere das Patent und das Gebrauchsmuster.
Kapitel 4 und 5 beleuchten das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbnErfG) und dessen Anwendung auf gebundene (Diensterfindungen) und freie Erfindungen.
In Kapitel 6 und 7 werden die Rechte und Pflichten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern im Zusammenhang mit technischen Verbesserungsvorschlägen sowie freien und gebundenen Erfindungen behandelt.
Kapitel 8 befasst sich mit den Themen Erfinder und Anmelder sowie den relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen.
Kapitel 9 und 10 befassen sich mit den Aspekten der Vergütung für Arbeitnehmererfindungen und der Erstellung eines Ablaufplans zur übersichtlichen Darstellung der relevanten Schritte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themengebieten "Technische Schutzrechte", "Arbeitnehmererfindungsgesetz", "Patent", "Gebrauchsmuster", "Erfindung", "Anmelder", "Vergütung" und "Ablaufplan".
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einem Patent und einem Gebrauchsmuster?
Patente bieten einen längeren Schutz (bis 20 Jahre) und werden geprüft, während Gebrauchsmuster ungeprüfte Schutzrechte mit kürzerer Laufzeit (bis 10 Jahre) sind.
Was regelt das Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG)?
Es regelt die Rechte und Pflichten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern bezüglich Erfindungen, die während eines Arbeitsverhältnisses gemacht werden.
Was ist eine Diensterfindung (gebundene Erfindung)?
Eine Diensterfindung ist eine Erfindung, die aus der dem Arbeitnehmer obliegenden Tätigkeit entstanden ist oder maßgeblich auf Erfahrungen des Betriebes beruht.
Hat ein Arbeitnehmer Anspruch auf Vergütung für seine Erfindung?
Ja, wenn der Arbeitgeber eine Diensterfindung in Anspruch nimmt, hat der Arbeitnehmer einen gesetzlichen Anspruch auf eine angemessene Vergütung.
Was muss ein Arbeitnehmer tun, wenn er eine Erfindung macht?
Er ist verpflichtet, dem Arbeitgeber die Erfindung unverzüglich gesondert in Textform zu melden und dabei die Entstehung und die Erfindung selbst zu beschreiben.
- Arbeit zitieren
- Andreas Rack (Autor:in), 2017, Technische Schutzrechte. Ein Leitfaden für den innovativen Arbeitnehmer, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374826