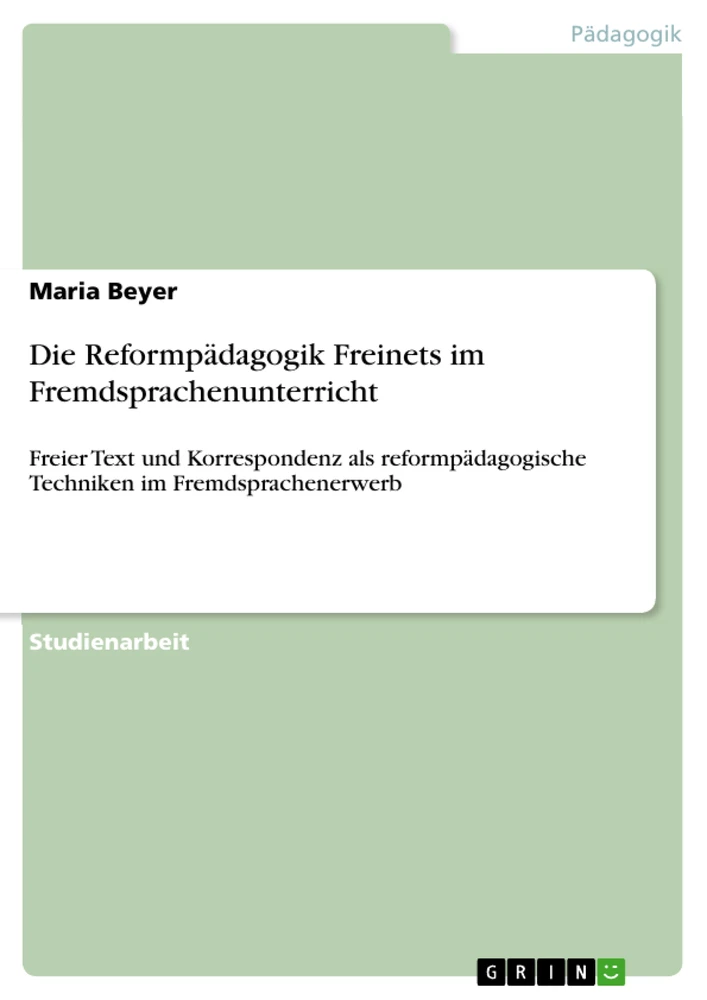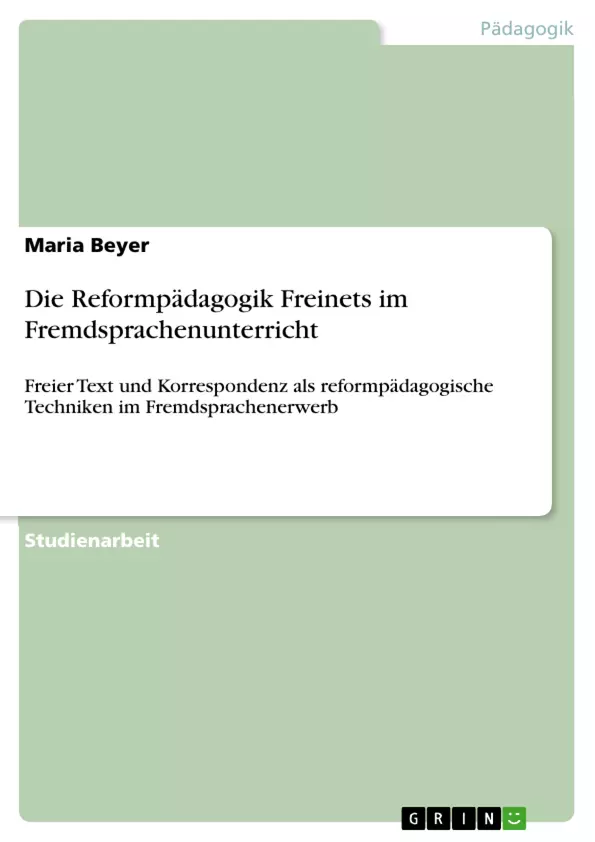Ausgehend von den traumatischen Erfahrungen der eigenen Schulzeit, basierend auf unverständlichen Lehrwerken und „körperlichen Züchtigungen“, forderte der am 15. Oktober 1896 in den französischen Seealpen geborene Sohn einer Bauernfamilie, Célestin Freinet, eine radikale Reformierung der traditionellen Schule. Entgegen deren standardisiertem Nützlichkeitsstreben entwirft Freinet eine Schule des Volkes, die die Verschiedenheit der Persönlichkeitsentfaltung des Schülers als Ressource ins Zentrum pädagogischer Handlung stellt. Neben schulischer Orientierung an der umgebenden Lebenswelt der Schüler und deren natürlicher Bedürfnisbefriedigung erfolgt dabei eine lehrerunabhängige Eigenständigkeit auf Initiative der Lernenden.
Die fundamentale Reform Freinets „Pädagogik vom Kinde aus“ lässt sich dabei vom Prinzip „le tâtonnement experimental“ (übersetzt „Das tastende Versuchen) leiten, welches anschließend an einen Abriss der nationalen Reformbestrebungen ausgeführt wird. Nachfolgend wird sich in der Vorstellung von Freinets „L’Ecole moderne“ (übersetzt „Die moderne Schule) auf die zentralen und thematisch für die Hausarbeit relevanten Grundsätze beschränkt. Im Rahmen der eigenen Recherche zum Thema der Freinet-Pädagogik stellte sich die Frage, inwieweit sich die anregend empfundenen Unterrichtstechniken des „freien Textes“ und der Korrespondenz auf den Kontext des deutschen Fremdsprachenunterrichts außerhalb des Rahmens der Regelschulzeit übertragen ließen, welche im Hauptteil der Hausarbeit anhand der greifenden didaktisch-methodischen Prinzipien Erläuterung finden. Im anschließenden Fazit wird auf die Rentabilität des Pädagogikmodells in Bezug auf die eigenen Schlussfolgerungen der Lehrpraxis eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Ansprüche der Reformpädagogik Freinets
- „Pädagogik vom Kinde aus“
- Nationale Reformbestrebungen
- „L'Ecole moderne“ - Die moderne Schule
- „Le tâtonnement experimental“ - Das tastende Versuchen
- Unterrichtspraktiken im Fremdsprachenunterricht
- Freier Text
- Korrespondenz
- Schlussfolgerungen für die Lehrpraxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Reformpädagogik Freinets, mit besonderem Fokus auf die Anwendung der Methoden „Freier Text“ und „Korrespondenz“ im Kontext des Fremdsprachenunterrichts. Ziel ist es, die Relevanz dieser reformpädagogischen Techniken für die Förderung des Fremdsprachenerwerbs zu beleuchten und praktische Implikationen für die Lehrpraxis abzuleiten.
- Die Reformpädagogik Freinets und ihre Prinzipien
- Die Bedeutung von Selbstständigkeit und Eigeninitiative im Fremdsprachenlernen
- Der freie Text als Werkzeug für die Entwicklung von Sprachkompetenz und Kreativität
- Die Rolle der Korrespondenz im Fremdsprachenunterricht zur Vertiefung der Sprachkenntnisse und zur Entwicklung interkultureller Kompetenz
- Praktische Implikationen für die Lehrpraxis im Fremdsprachenunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Ansprüche der Reformpädagogik Freinets: Dieses Kapitel führt in die Grundprinzipien der Reformpädagogik Freinets ein und beleuchtet die Kritik Freinets an der traditionellen Schulform. Es werden zentrale Elemente seiner „Pädagogik vom Kinde aus“ wie Selbstständigkeit, Eigeninitiative und die Orientierung an den Bedürfnissen der Lernenden hervorgehoben.
- Kapitel 2: „Pädagogik vom Kinde aus“: Dieses Kapitel untersucht die historischen Wurzeln der Reformpädagogik, insbesondere die nationalen Reformbestrebungen und die Entwicklung des Konzepts der „L'Ecole moderne“. Die Bedeutung von Persönlichkeitsentfaltung und die Abkehr von autoritären Strukturen stehen im Vordergrund.
- Kapitel 3: „Le tâtonnement experimental“ - Das tastende Versuchen: Hier wird das Kernprinzip des „Tastenden Versuchens“ in der Reformpädagogik Freinets erläutert und seine Bedeutung für die selbstgesteuerte, experimentelle Lernweise betont.
- Kapitel 4: Unterrichtspraktiken im Fremdsprachenunterricht: Dieses Kapitel widmet sich den Unterrichtstechniken „Freier Text“ und „Korrespondenz“ innerhalb der Reformpädagogik Freinets und zeigt, wie diese im Kontext des Fremdsprachenunterrichts eingesetzt werden können. Es werden konkrete Beispiele und didaktische Prinzipien erläutert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Reformpädagogik Freinets, „Pädagogik vom Kinde aus“, „Le tâtonnement experimental“, freier Text, Korrespondenz, Fremdsprachenunterricht, Selbstständigkeit, Eigeninitiative, Sprachkompetenz, interkulturelle Kompetenz, Lehrpraxis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern der Freinet-Pädagogik?
Die Freinet-Pädagogik ist eine „Pädagogik vom Kinde aus“. Sie betont die Selbstständigkeit, Eigeninitiative und die Orientierung an der Lebenswelt der Schüler anstatt starrer Lehrpläne.
Was bedeutet „le tâtonnement expérimental“?
Es bedeutet „das tastende Versuchen“. Schüler sollen durch Ausprobieren und eigene Erfahrungen lernen, anstatt Wissen nur passiv zu konsumieren.
Wie wird der „freie Text“ im Fremdsprachenunterricht genutzt?
Schüler verfassen Texte zu Themen, die sie persönlich bewegen. Dies fördert die sprachliche Kreativität und Kompetenz, da die Sprache als Werkzeug zur Kommunikation eigener Gedanken erlebt wird.
Welche Rolle spielt die Korrespondenz in dieser Pädagogik?
Der Austausch mit Schülern aus anderen Regionen oder Ländern (z.B. durch Briefe oder digitale Medien) schafft authentische Kommunikationssituationen und fördert die interkulturelle Kompetenz.
Ist Freinet-Pädagogik in der Regelschule anwendbar?
Ja, Techniken wie der freie Text oder die Korrespondenz lassen sich auch im deutschen Fremdsprachenunterricht integrieren, um die Lernmotivation und Eigenständigkeit der Schüler zu erhöhen.
- Arbeit zitieren
- Maria Beyer (Autor:in), 2017, Die Reformpädagogik Freinets im Fremdsprachenunterricht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374833