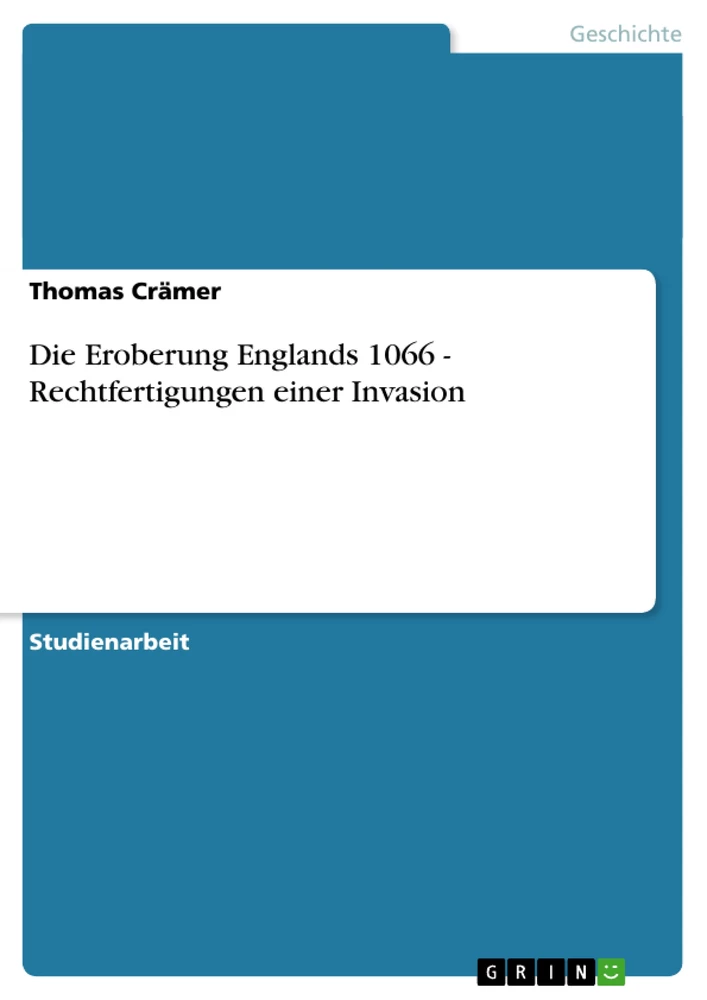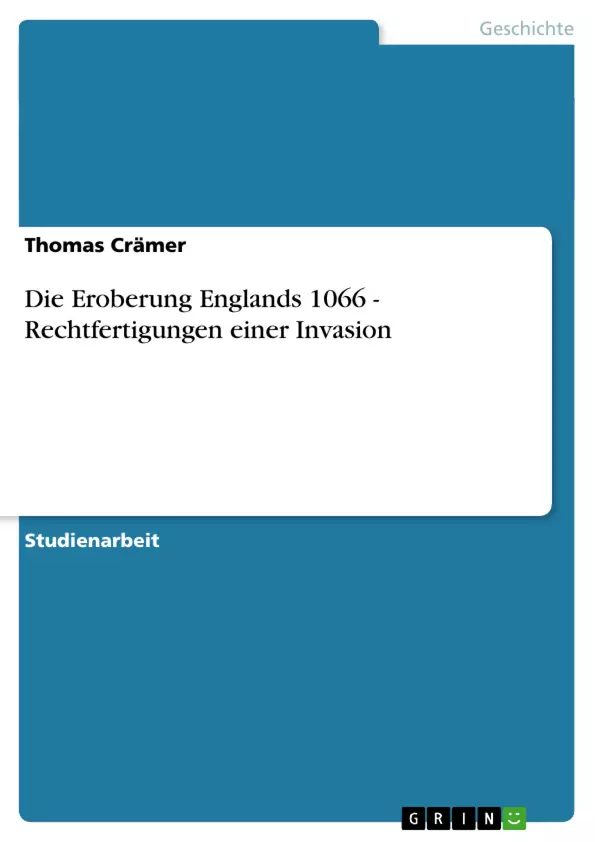Einleitung
In der vorliegenden Arbeit soll aufgezeigt werden, welche Gründe Herzog Wilhelm II. zur Legitimierung seiner Invasionsziele der britischen Inseln heranzog. Die Bedeutung dieser Frage ist zentral, da es, ohne ausreichende Begründung und Rechtfertigung, Wilhelm dem Eroberer vermutlich nicht gelungen wäre, eine derartig effiziente Herrschaft in England zu installieren, falls seine Beweggründe nicht als moralisch richtig von Gesellschaft und Kirche angesehen worden wären. Zuerst soll gezeigt werden, welche anderen Möglichkeiten der Erbfolge es in England nach dem Tode Edward des Bekenners gab und wie Harald Godwinson von Wessex zum Monarchen gekrönt wurde. Ich beziehe mich in meiner Arbeit auf eine Darstellung von Richard Allen Brown1, nach der ich auch die nach meiner Meinung zentralen Quellen2 zu dieser Frage zitiere. Weiterhin wird eine umfassende Überblicksdarstellung von Kurt- Ulrich Jäschke3 Verwendung finden, die sich eingehend mit dem Problem der Legitimierung des normannischen Herrschaftsanspruches befaßt. Abschließend nehme ich Szenen aus dem Teppich von Bayeux als Beispiel für die quellenkritische Methode. Ich gehe der Frage nach, auf welche Weise und mit welchen Mitteln, der Teppich den Herrschaftsanspruch Wilhelms legitimiert. Der Teppich wird deshalb gewählt, weil er, neben den bekannten schriftlichen Quellen, zu den am schwersten zu interpretierenden Quellen gehört.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die normannische Invasion von 1066
- 2.1 Erbfolgeregelungen
- 2.2 Rechtfertigungen der Invasion
- 3. Herrschaftslegitimation in einer Quelle: Beispiel des Teppichs von Bayeux
- 4. Bilanz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Legitimierungsstrategien Herzog Wilhelms II. bei der Eroberung Englands 1066. Es wird analysiert, welche Gründe Wilhelm für seine Invasion anführte und wie diese von Gesellschaft und Kirche aufgenommen wurden. Die Bedeutung der Rechtfertigung für den Erfolg der normannischen Herrschaft wird hervorgehoben.
- Mögliche Erbfolgeregelungen nach dem Tod Edwards des Bekenners
- Wilhelms Rechtfertigung seiner Invasion basierend auf Verwandtschaft und Treueeid
- Analyse der Herrschaftslegitimation im Bayeux-Teppich
- Quellenkritik und Vergleich verschiedener Quellen zur Legitimation
- Die Rolle des Papstes bei der Legitimierung der normannischen Eroberung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert die zentrale Fragestellung der Arbeit: die Legitimierungsstrategien Herzog Wilhelms II. bei der Eroberung Englands. Sie betont die Bedeutung einer moralischen Rechtfertigung für den Erfolg der Eroberung und kündigt die methodische Vorgehensweise an: Zuerst werden alternative Erbfolgeregelungen und Haralds Krönung beleuchtet, basierend auf der Darstellung von Richard Allen Brown. Anschließend wird die Legitimation des normannischen Herrschaftsanspruchs umfassender anhand von Kurt-Ulrich Jäschke betrachtet. Schließlich wird der Bayeux-Teppich als quellenkritisches Beispiel für die Legitimation Wilhelms herangezogen.
2. Die normannische Invasion von 1066: Dieses Kapitel untersucht die normannische Invasion von 1066, beginnend mit einer Analyse der verschiedenen Ansprüche auf die englische Krone nach dem Tod Edwards des Bekenners. Es werden die Ansprüche Edgars Ethelings, Wilhelms und Haralds Godwinson im Detail dargestellt, wobei die verwandtschaftlichen Beziehungen und die Rolle von Zusicherungen Edwards des Bekenners beleuchtet werden. Der Abschnitt behandelt die unterschiedlichen Interpretationen der letzten Worte Edwards und deren Auswirkungen auf die Legitimität Haralds. Die Quellenlage wird kritisch betrachtet, insbesondere die unterschiedlichen Perspektiven der englischen und normannischen Quellen. Anschließend werden Wilhelms Rechtfertigungsstrategien im Detail analysiert: seine Verwandtschaft zu Edward, der Treueeid Haralds, sowie die Rolle der normannischen Geschichtsschreibung bei der Konstruktion der Legitimität.
3. Herrschaftslegitimation in einer Quelle: Beispiel des Teppichs von Bayeux: Dieses Kapitel analysiert den Bayeux-Teppich als Quelle zur Legitimation Wilhelms. Es werden vier Schlüsselbilder des Teppichs herangezogen, um die Darstellung des Eides Haralds und die darauffolgende Krönung Haralds zu untersuchen. Der Teppich wird als Instrument der Herrschaftslegitimation für ein breiteres Publikum interpretiert, wobei die Inschriften und die narrative Struktur betont werden. Die Darstellung des Kometen von 1066 wird als Symbol für das schlechte Omen der Herrschaft Haralds interpretiert. Der Teppich wird mit den schriftlichen Quellen verglichen und die unterschiedliche Gewichtung des religiösen Aspekts wird herausgestellt. Die eindeutige Behauptung der Legitimität der normannischen Eroberung wird im Kontext der damaligen Zeit analysiert.
Schlüsselwörter
Normannische Invasion, England 1066, Herzog Wilhelm II., Harald Godwinson, Erbfolge, Legitimation, Herrschaftsanspruch, Bayeux-Teppich, Quellenkritik, William of Jumièges, William of Poitiers, Vita Edwardi Regis, Treueeid, Papst Alexander II.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Normannische Invasion von 1066 und Legitimation der Herrschaft Wilhelms II.
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Legitimierungsstrategien Herzog Wilhelms II. bei der Eroberung Englands im Jahr 1066. Im Fokus steht die Analyse der Gründe, die Wilhelm für seine Invasion anführte, wie diese von Gesellschaft und Kirche aufgenommen wurden und welche Bedeutung die Rechtfertigung für den Erfolg der normannischen Herrschaft hatte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte der normannischen Eroberung, darunter mögliche Erbfolgeregelungen nach dem Tod Edwards des Bekenners, Wilhelms Rechtfertigung seiner Invasion (Verwandtschaft und Treueeid), die Analyse der Herrschaftslegitimation im Bayeux-Teppich, Quellenkritik und Vergleich verschiedener Quellen zur Legitimation, sowie die Rolle des Papstes bei der Legitimierung der normannischen Eroberung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung, die normannische Invasion von 1066, Herrschaftslegitimation am Beispiel des Bayeux-Teppichs und eine Bilanz. Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung vor und beschreibt die methodische Vorgehensweise. Kapitel zwei analysiert die verschiedenen Ansprüche auf die englische Krone und Wilhelms Rechtfertigungsstrategien. Kapitel drei untersucht den Bayeux-Teppich als Quelle für die Legitimation Wilhelms. Das abschließende Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie wird der Bayeux-Teppich in der Arbeit verwendet?
Der Bayeux-Teppich wird als primäre Quelle zur Analyse der Legitimation Wilhelms herangezogen. Die Arbeit untersucht ausgewählte Bilder des Teppichs, um die Darstellung des Eides Haralds, dessen Krönung und die damit verbundene Legitimation zu beleuchten. Der Teppich wird als Instrument der Herrschaftslegitimation für ein breiteres Publikum interpretiert, wobei die Inschriften und die narrative Struktur berücksichtigt werden.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene Quellen, darunter die Schriften von Richard Allen Brown und Kurt-Ulrich Jäschke. Sie analysiert kritisch englische und normannische Quellen, um die unterschiedlichen Perspektiven auf die Ereignisse von 1066 darzustellen. Der Bayeux-Teppich wird als visuelle Quelle herangezogen und mit schriftlichen Quellen verglichen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Normannische Invasion, England 1066, Herzog Wilhelm II., Harald Godwinson, Erbfolge, Legitimation, Herrschaftsanspruch, Bayeux-Teppich, Quellenkritik, William of Jumièges, William of Poitiers, Vita Edwardi Regis, Treueeid, Papst Alexander II.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine quellenkritische Methode, indem sie verschiedene Quellen (schriftliche und visuelle) vergleicht und deren Perspektiven und mögliche Verzerrungen analysiert. Sie konzentriert sich auf die Analyse der Legitimierungsstrategien Wilhelms und deren Wirkung auf die Akzeptanz der normannischen Herrschaft.
- Quote paper
- Thomas Crämer (Author), 2005, Die Eroberung Englands 1066 - Rechtfertigungen einer Invasion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37496