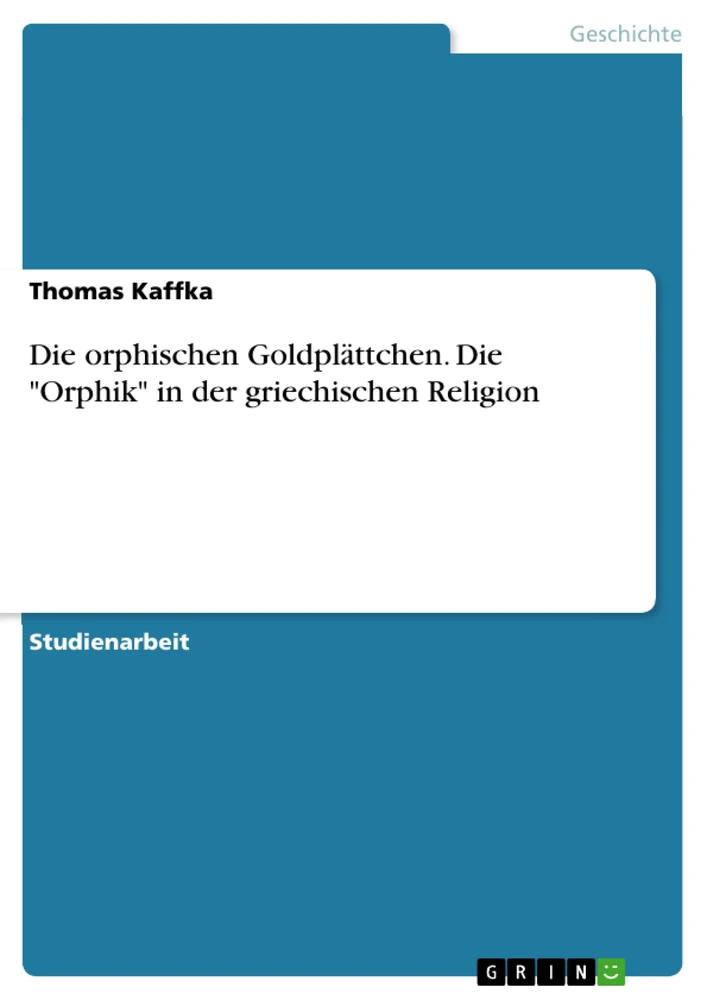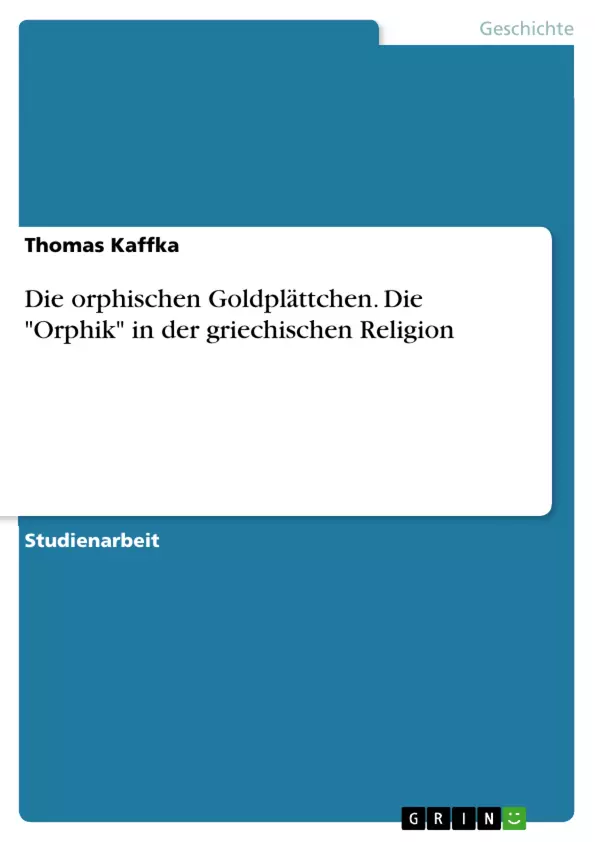Die vorliegende Arbeit wird sich im Kern mit den sog. „orphischen“ Goldplättchen befassen. Dabei wirft schon der Name einiges an Problemen auf, da bis heute noch nicht einhellig entschieden scheint, was überhaupt „orphisch“ ist.
Um sich also nicht zu sehr in vagen Vermutungen zu bewegen, soll hier darauf verzichtet werden, ein vollständiges Bild der orphischen Überlieferung zu skizzieren. Stattdessen wird in einem ersten Schritt der systematische Aufbau einiger ausgewählter Goldplättchen forciert, um in einem nächsten Schritt daran herauszuarbeiten, was eben diese Plättchen aussagen oder in Aussicht stellen und wie sie im Kontext des griechischen Standards zu bewerten sind. Hierbei sei bereits angemerkt, dass im Rahmen der Arbeit der Schwerpunkt auf einer Betrachtung der sog. B-Plättchen liegt und somit lediglich ein mögliches Bild rekonstruiert werden kann; dadurch soll jedoch nicht der Eindruck vermittelt werden, bei der „Orphik“ handle es sich um ein monolithisches Gebilde, das keine Variation kenne. Wie schon die heterogene Vielfalt an Goldplättchen zeigt, scheint dies ein Trugschluss zu sein, den es auszuräumen gilt. Daher sei noch einmal betont, dass diese Arbeit lediglich ein mögliches Bild ihres Kontexts erarbeiten kann und im konkreten Fall geschieht dies hier aufgrund der Basis der B-Plättchen. Grundsätzliche Aufgabe der vorliegenden Arbeit soll sein, die wenigen Teile des Puzzles zusammenzutragen, um ein Bild der Goldplättchen und ihres Kontextes darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- II.1. Was ist „orphisch“ an den Goldplättchen?
- II.2. Systematischer Aufbau der Goldplättchen
- II.3. Der Versuch einer „orphischen“ Eschatologie
- II.4. Die „Orphiká“
- II.4.1. Wer sind die „Orphiká“?
- II.4.2. Die Abgrenzung der „Orphiká“
- III. Schluss
- IV. Quellen- und Literaturverzeichnis
- IV.1. Quellen
- IV.2. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die sogenannten „orphischen“ Goldplättchen. Ziel ist es, den systematischen Aufbau der Plättchen zu analysieren und daraus abzuleiten, welche Aussagen diese machen und wie sie im Kontext der griechischen Religion zu bewerten sind. Der Fokus liegt dabei auf den B-Plättchen. Es wird eine ethische Betrachtungsweise eingenommen, da eine emische Sicht aufgrund der lückenhaften Quellenlage schwierig ist.
- Systematischer Aufbau der „orphischen“ Goldplättchen
- Die „orphische“ Eschatologie
- Der Kontext der Goldplättchen innerhalb der griechischen Kultreligion
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „orphisch“
- Rekonstruktion eines möglichen Bildes der „Orphik“ basierend auf den B-Plättchen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Arbeit befasst sich mit den „orphischen“ Goldplättchen und den damit verbundenen Problemen der Definition von „orphisch“. Sie verzichtet auf eine vollständige Rekonstruktion der orphischen Überlieferung und konzentriert sich auf die systematische Analyse ausgewählter Goldplättchen, insbesondere der B-Plättchen, um deren Aussagen und ihren Kontext innerhalb des griechischen religiösen Standards zu verstehen. Die Arbeit betont die Heterogenität der „Orphik“ und strebt die Rekonstruktion eines möglichen Bildes ihres Kontextes an, basierend auf den B-Plättchen.
II. Hauptteil: Dieser Teil präsentiert eine Systematik, die in vielen Goldplättchen, insbesondere den B-Plättchen, zu finden ist, welche sich durch die Konfrontation mit namenlosen Wächtern auszeichnen. Es wird untersucht, welche Eschatologie sich hinter den Plättchen verbirgt und wie sie sich in den Kontext der breit rezipierten griechischen Kultreligion einordnen lassen. Die Kapitel innerhalb des Hauptteils untersuchen detailliert die Frage nach der "orphischen" Natur der Plättchen, deren systematischen Aufbau und versuchen, eine "orphische" Eschatologie zu rekonstruieren, sowie die "Orphiká" selbst zu definieren und von anderen religiösen Strömungen abzugrenzen.
Schlüsselwörter
Orphische Goldplättchen, griechische Religion, Kultreligion, Eschatologie, Orphik, B-Plättchen, Systematik, Ethische Betrachtung, Interpretationsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse "orphischer" Goldplättchen
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert die sogenannten „orphischen“ Goldplättchen, insbesondere die B-Plättchen. Der Fokus liegt auf deren systematischem Aufbau, den darin enthaltenen Aussagen und ihrer Einordnung in den Kontext der griechischen Religion.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Ziel ist die Analyse des systematischen Aufbaus der Goldplättchen und die Ableitung der darin enthaltenen Aussagen. Die Arbeit untersucht, wie diese im Kontext der griechischen Religion zu bewerten sind und nimmt dabei eine ethische Betrachtungsweise ein, da eine emische Sicht aufgrund der lückenhaften Quellenlage schwierig ist.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den systematischen Aufbau der „orphischen“ Goldplättchen, die „orphische“ Eschatologie, den Kontext der Goldplättchen innerhalb der griechischen Kultreligion, die Definition und Abgrenzung des Begriffs „orphisch“ sowie die Rekonstruktion eines möglichen Bildes der „Orphik“ basierend auf den B-Plättchen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil, einen Schluss und ein Quellen- und Literaturverzeichnis. Der Hauptteil untersucht detailliert die „orphische“ Natur der Plättchen, deren systematischen Aufbau, eine mögliche „orphische“ Eschatologie und eine Definition und Abgrenzung der „Orphiká“ von anderen religiösen Strömungen.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung thematisiert die „orphischen“ Goldplättchen und die damit verbundenen Probleme der Definition von „orphisch“. Sie konzentriert sich auf die systematische Analyse ausgewählter Goldplättchen (insbesondere der B-Plättchen), um deren Aussagen und ihren Kontext innerhalb des griechischen religiösen Standards zu verstehen. Die Heterogenität der „Orphik“ wird betont und das Ziel der Rekonstruktion eines möglichen Bildes ihres Kontextes, basierend auf den B-Plättchen, formuliert.
Was beinhaltet der Hauptteil der Arbeit?
Der Hauptteil präsentiert eine Systematik, die in vielen Goldplättchen, insbesondere den B-Plättchen, zu finden ist und sich durch die Konfrontation mit namenlosen Wächtern auszeichnet. Es werden die hinter den Plättchen vermutete Eschatologie und deren Einordnung in den Kontext der griechischen Kultreligion untersucht. Die Kapitel untersuchen detailliert die Frage nach der "orphischen" Natur der Plättchen, deren systematischen Aufbau und versuchen, eine "orphische" Eschatologie zu rekonstruieren sowie die "Orphiká" zu definieren und abzugrenzen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Orphische Goldplättchen, griechische Religion, Kultreligion, Eschatologie, Orphik, B-Plättchen, Systematik, Ethische Betrachtung, Interpretationsgeschichte.
Welche Quellen werden verwendet?
Das Quellen- und Literaturverzeichnis (Kapitel IV) listet die verwendeten Quellen und Literatur auf, jedoch sind die spezifischen Quellen und Literaturangaben nicht im gegebenen Text enthalten.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine systematische Analyse der Goldplättchen, insbesondere der B-Plättchen, um deren Aussagen und ihren religiösen Kontext zu verstehen. Aufgrund der lückenhaften Quellenlage wird eine ethische statt einer emischen Betrachtungsweise eingenommen.
- Quote paper
- Thomas Kaffka (Author), 2010, Die orphischen Goldplättchen. Die "Orphik" in der griechischen Religion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375141