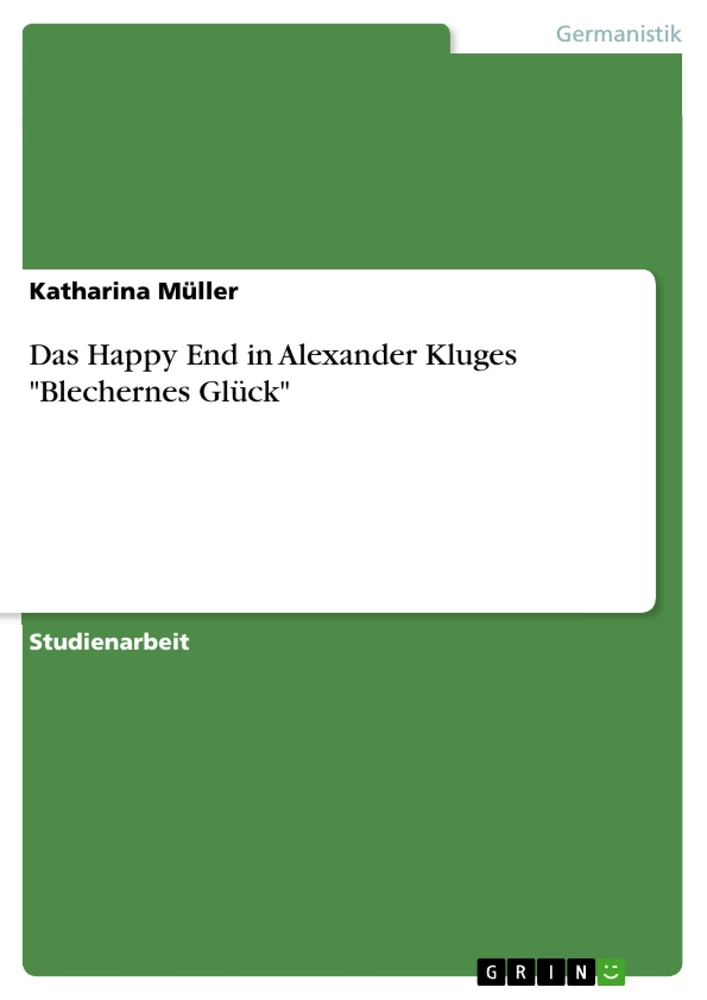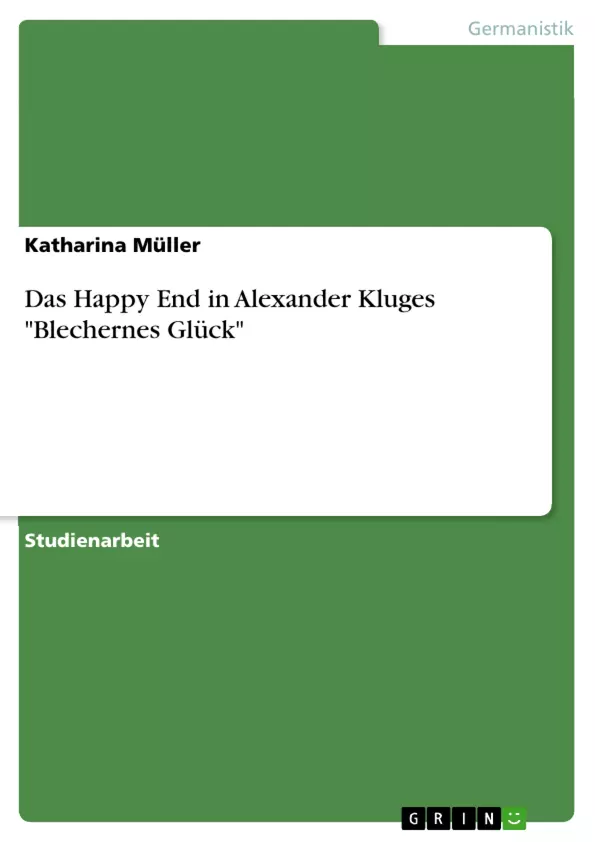Die internationale DFG-Tagung "Glück am Ende? Episodisches Erzählen in Mittelalter und Gegenwart" brachte internationale Expertinnen und Experten der Narratologie, der Alt- und Neugermanistik, der Literatur- und Medienwissenschaft sowie Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler verschiedenster Disziplinen zusammen, um sich gemeinsam der quest – der Suche nach der Sinnhaftigkeit und der Problematiken eines glücklichen Endes zu widmen. Die studentische Projektgruppe Heidelberg präsentierte Überlegungen zu Alexander Kluges "Blechernes Glück". Die Erzählung verbindet die Hauptthemen der DFG-Tagung des episodischen Erzählens und der quest und soll im Folgenden näher beleuchtet werden, indem nach Details zur Konzeption, die narrative Instanz in den Vordergrund gerückt wird. Daraufhin werden drei Thesen vorgestellt, welche die Motivierung der Erzählung darlegen, das typische Happy End problematisieren und die Plausibilität der dargestellten Glücksbegriffe überprüfen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Alexander Kluge: Blechernes Glück
- 2.1. These 1: Der Handlungsverlauf wird durch kausale und finale Motivierungen vorangetrieben.
- 2.2. These 2: In der postmodernen Erzählung Blechernes Glück von Alexander Kluge wird das typische Happy End problematisiert.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Alexander Kluges Erzählung "Blechernes Glück" im Kontext der DFG-Tagung "Glück am Ende? Episodisches Erzählen in Mittelalter und Gegenwart". Ziel ist es, die narrative Struktur, die Motivationsstrukturen und die Darstellung des Glücksbegriffs zu untersuchen und die Problematik des dargestellten "Happy Ends" zu beleuchten.
- Episodisches Erzählen
- Kausale und finale Motivierung
- Der Glücksbegriff (fortuna und felicitas)
- Problematik des Happy Ends
- Narrative Instanz und Erzählperspektive
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der DFG-Tagung "Glück am Ende?" ein und definiert den Begriff der Episode im erzählerischen Kontext. Sie stellt Alexander Kluges "Blechernes Glück" als Fallbeispiel vor und kündigt die Analyse der Erzählung an, wobei der Fokus auf der Konzeption, der narrativen Instanz und drei zentralen Thesen liegt, die die Motivierung, das Happy End und die Plausibilität des Glücksbegriffs untersuchen.
2. Alexander Kluge: Blechernes Glück: Dieses Kapitel beginnt mit einer Einführung in die Erzählung "Blechernes Glück" und ihren Kontext innerhalb von Kluges Sammlung "Die Lücke, die der Teufel läßt". Es analysiert die Erzählperspektive und die Distanzierung des Erzählers von der Protagonistin Wilma Bison. Die Darstellung von Wilmas Selbstmordversuch und ihrem unerwarteten Überleben wird kritisch beleuchtet, wobei die ironische Distanz des Erzählers und die fehlende Empathie hervorgehoben werden. Die Beschreibung Wilmas als oberflächlich und die Darstellung ihres Überlebens als grotesk werden als Beispiele für diese Distanzierung angeführt.
2.1. These 1: Der Handlungsverlauf wird durch kausale und finale Motivierungen vorangetrieben.: Dieser Abschnitt analysiert die Handlungsstruktur von "Blechernes Glück" im Hinblick auf kausale und finale Motivierung. Die Erzählung ist anachronistisch aufgebaut, wobei die Vorgeschichte erst nach dem zentralen Ereignis (Selbstmordversuch) enthüllt wird. Der Handlungsverlauf wird als kausal motiviert dargestellt, wobei jedoch an mehreren Stellen finale Motivierungen, insbesondere die "Fügung" und die Intervention der "Geister des Doms", die Kausalkette unterbrechen. Der Erzähler schafft durch eine retrospektive Perspektive eine Ambiguität, die sowohl die lebensweltliche als auch die analytische Betrachtungsweise einbezieht.
2.2. These 2: In der postmodernen Erzählung Blechernes Glück von Alexander Kluge wird das typische Happy End problematisiert.: Hier wird das "Happy End" der Erzählung im Kontext der postmodernen Literatur und Filmdramaturgie diskutiert. Kluges Erzählung hinterfragt den traditionellen Glücksbegriff und das einfache "Happy End". Der Titel "Blechernes Glück" selbst impliziert bereits eine Ambivalenz. Obwohl Wilma Bison am Ende eine Beziehung eingeht, bleibt die Frage nach der Plausibilität des Glücksbegriffs offen. Die ambivalenten Textsignale und die Ironie des Erzählers stören die Textkohärenz und lassen den Leser die Darstellung des Glücks kritisch hinterfragen.
Schlüsselwörter
Alexander Kluge, Blechernes Glück, episodisches Erzählen, Kausalität, Finale Motivierung, Fortuna, Felicitas, Happy End, Postmoderne, Narrative Instanz, Erzählperspektive, Ambivalenz.
Häufig gestellte Fragen zu Alexander Kluges "Blechernes Glück"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Alexander Kluges Erzählung "Blechernes Glück" im Kontext der DFG-Tagung "Glück am Ende? Episodisches Erzählen in Mittelalter und Gegenwart". Der Fokus liegt auf der narrativen Struktur, den Motivationsstrukturen, der Darstellung des Glücksbegriffs und der Problematik des dargestellten "Happy Ends".
Welche Themen werden in der Analyse behandelt?
Die Analyse behandelt folgende Themen: episodisches Erzählen, kausale und finale Motivierung, den Glücksbegriff (fortuna und felicitas), die Problematik des Happy Ends, die narrative Instanz und Erzählperspektive.
Welche These wird im Bezug auf die Handlungsstruktur aufgestellt?
Die These 1 besagt, dass der Handlungsverlauf in "Blechernes Glück" durch kausale und finale Motivierungen vorangetrieben wird. Die Erzählung ist anachronistisch aufgebaut, und finale Motivierungen, wie "Fügung" und Interventionen, unterbrechen die Kausalkette. Der Erzähler schafft durch eine retrospektive Perspektive eine Ambiguität.
Wie wird das "Happy End" in der Erzählung bewertet?
These 2 argumentiert, dass das "Happy End" in Kluges postmodernen Erzählung problematisiert wird. Der Titel "Blechernes Glück" impliziert bereits eine Ambivalenz. Die Frage nach der Plausibilität des Glücks bleibt offen, und ambivalente Textsignale und die Ironie des Erzählers stören die Textkohärenz und lassen den Leser die Darstellung des Glücks kritisch hinterfragen.
Wie ist die Erzählung strukturiert?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, ein Kapitel zur Analyse von "Blechernes Glück", unterteilt in zwei Abschnitte zu These 1 (kausale und finale Motivierung) und These 2 (Problematik des Happy Ends), sowie eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Rolle spielt die Erzählperspektive?
Die Erzählperspektive in "Blechernes Glück" ist distanziert und ironisch. Der Erzähler distanziert sich von der Protagonistin Wilma Bison, was in der Beschreibung Wilmas als oberflächlich und der Darstellung ihres Überlebens als grotesk zum Ausdruck kommt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Alexander Kluge, Blechernes Glück, episodisches Erzählen, Kausalität, Finale Motivierung, Fortuna, Felicitas, Happy End, Postmoderne, Narrative Instanz, Erzählperspektive, Ambivalenz.
Welche Kapitel sind enthalten?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zu Alexander Kluges "Blechernes Glück" (mit Unterkapiteln zu These 1 und These 2), und eine Zusammenfassung der Kapitel.
- Quote paper
- Katharina Müller (Author), 2016, Das Happy End in Alexander Kluges "Blechernes Glück", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375216