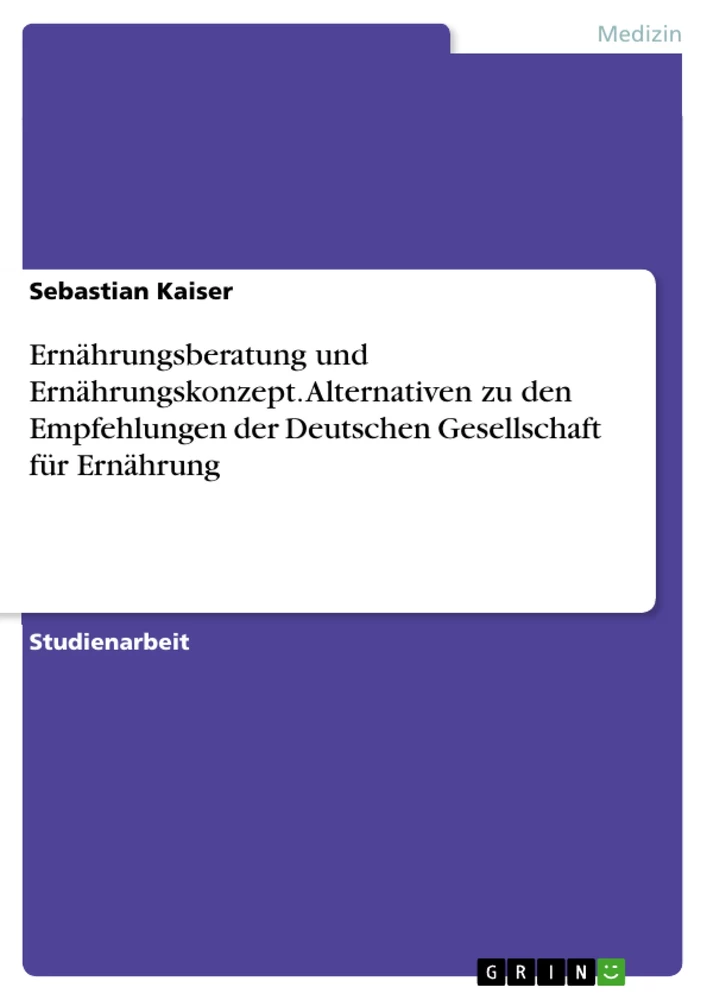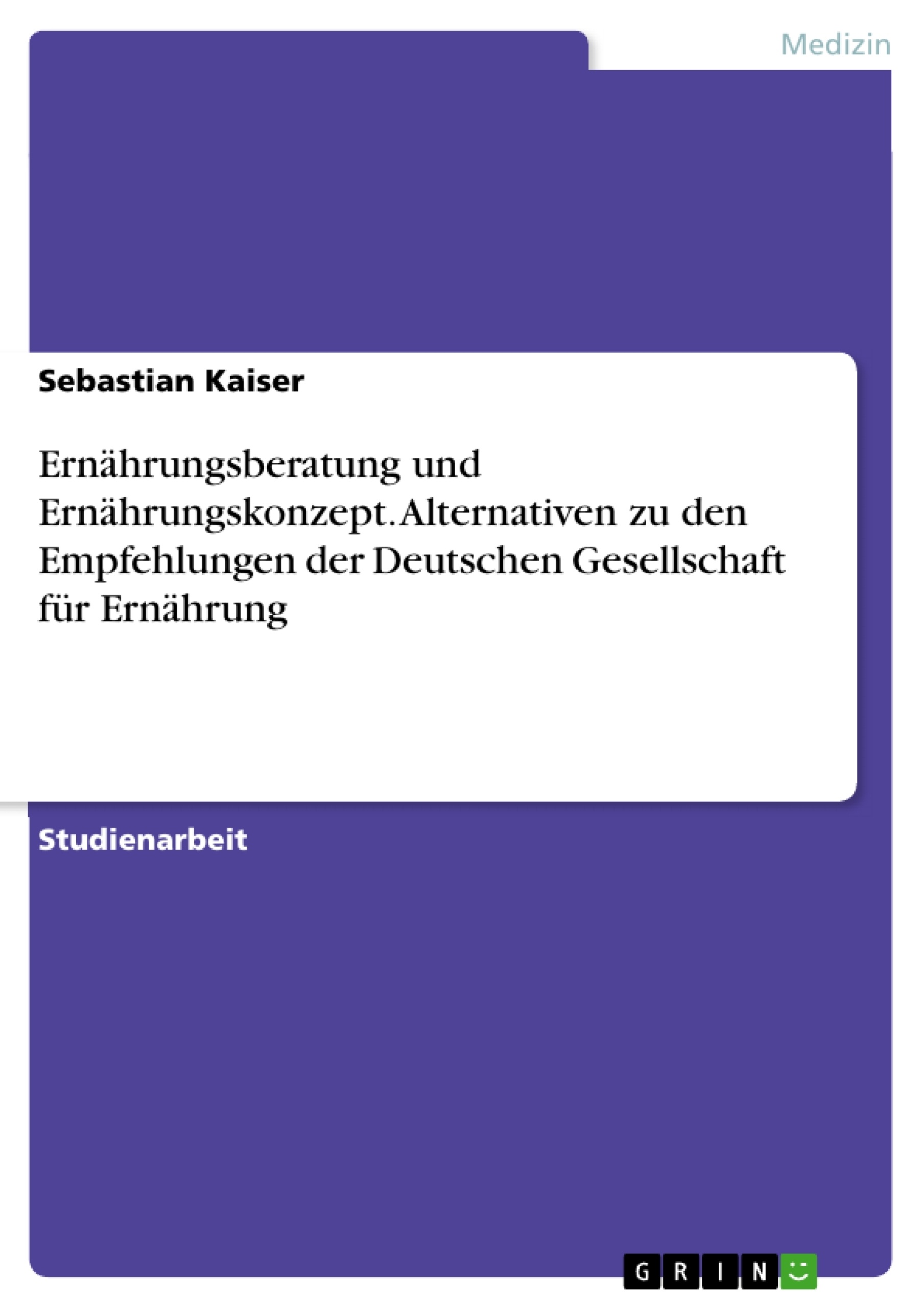Eine Ernährungsberatung am Beispiel eines fiktiven Klienten. Die Arbeit zeigt insbesondere auf, warum die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) kritisch betrachtet werden müssen und welche Vorteile im Vergleich dazu die Ernährung nach der Paleo Methode aufweisen kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ernährungsempfehlungen
- 2.1 Ernährungsempfehlungen der DGE
- 2.1.1 Darstellung der Ernährungsempfehlungen der DGE
- 2.1.2 Kritik an den Ernährungsempfehlungen der DGE
- 2.2 Alternative Ernährungsempfehlungen
- 2.1 Ernährungsempfehlungen der DGE
- 3. Das Erstgespräch
- 4. Die Anamnese
- 4.1 Aufbau des Anamnesebogens
- 4.2 Auswertung des Anamnesebogens
- 4.2.1 Die biologischen Faktoren
- 4.2.2 Die Erkrankungen
- 4.2.3 Der Allgemeinzustand
- 5. Das Ernährungsprotokoll
- 5.1 Auswertung des Ernährungsprotokolls
- 5.2 Schlussfolgerungen aus dem Ernährungsprotokoll
- 6. Ernährungsplan für Peter Meier
- 6.1 Zufuhrempfehlungen für Peter Meier
- 6.2 Ernährungsplan für Peter Meier
- 6.3 Weitere Empfehlung: Sport und Bewegung
- 6.4 Zwischengespräch I nach 4 Wochen
- 6.5 Zwischengespräch II nach 8 Wochen
- 6.6 Schlussgespräch nach 12 Wochen
- 7. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Abschlussarbeit befasst sich mit der Erstellung eines individuellen Ernährungskonzepts für den fiktiven Klienten Herrn Peter Meier. Die Arbeit verfolgt das Ziel, eine 12-wöchige Ernährungsberatung zu entwickeln, die auf seine Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist. Dabei werden die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) als Grundlage für die Entwicklung des Ernährungsplans genutzt und kritisch betrachtet.
- Analyse und Beurteilung der Ernährungsempfehlungen der DGE
- Erstellung eines individuellen Anamnesebogens für Herrn Peter Meier
- Auswertung eines Ernährungsprotokolls, um seine aktuelle Ernährungsweise zu beurteilen
- Entwicklung eines Ernährungsplans, der auf die Bedürfnisse von Herrn Meier abgestimmt ist
- Einbezug von sportlicher Aktivität und Bewegung in das Gesamtkonzept
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in die Thematik der Ernährungsberatung und stellt den fiktiven Klienten Herrn Peter Meier vor. Kapitel 2 behandelt die Ernährungsempfehlungen der DGE, inklusive einer detaillierten Darstellung und einer kritischen Auseinandersetzung mit deren Inhalten. Kapitel 3 widmet sich dem Erstgespräch mit dem Klienten und dessen Bedeutung für die erfolgreiche Ernährungsberatung. Kapitel 4 beschreibt den Aufbau und die Auswertung des Anamnesebogens, der wertvolle Informationen über Herrn Meiers Lebensgewohnheiten, Krankheitsvorgeschichte und Ernährung liefert. Kapitel 5 befasst sich mit dem Ernährungsprotokoll, das die Ernährungsgewohnheiten von Herrn Meier im Detail dokumentiert. Kapitel 6 stellt den individualisierten Ernährungsplan für Herrn Peter Meier vor, inklusive der empfohlenen Nährstoffzufuhr, konkreten Rezeptideen und Empfehlungen für sportliche Aktivität. Abschließend fasst das siebte Kapitel die wichtigsten Erkenntnisse und Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Ernährungsberatung, Ernährungsempfehlungen, DGE, Anamnese, Ernährungsprotokoll, Ernährungsplan, individueller Ernährungsplan, Sport und Bewegung, Ernährungsumstellung.
Häufig gestellte Fragen
Was wird an den Empfehlungen der DGE kritisiert?
Die Arbeit setzt sich kritisch mit den Standardvorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) auseinander und zeigt alternative Ansätze auf.
Was ist die Paleo-Methode?
Die Paleo-Ernährung (Steinzeitdiät) orientiert sich an den vermuteten Essgewohnheiten der Jäger und Sammler, unter Verzicht auf industriell verarbeitete Lebensmittel.
Wer ist der Klient in dieser Fallstudie?
Die Ernährungsberatung wird beispielhaft für den fiktiven Klienten Peter Meier durchgeführt.
Wie läuft die Erstellung des Ernährungsplans ab?
Der Prozess umfasst ein Erstgespräch, eine detaillierte Anamnese, die Auswertung eines Ernährungsprotokolls und regelmäßige Zwischengespräche über 12 Wochen.
Spielt Sport eine Rolle im Ernährungskonzept?
Ja, neben der Ernährungsumstellung enthält das Konzept auch Empfehlungen für Sport und Bewegung zur Erreichung der Gesundheitsziele.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Kaiser (Autor:in), 2015, Ernährungsberatung und Ernährungskonzept. Alternativen zu den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375238