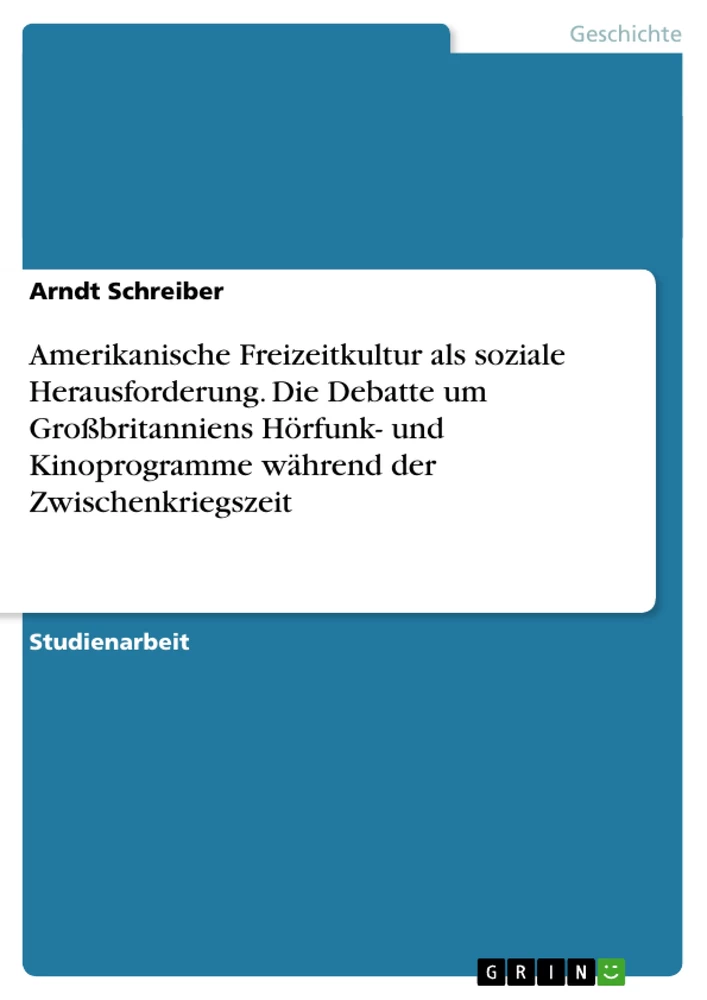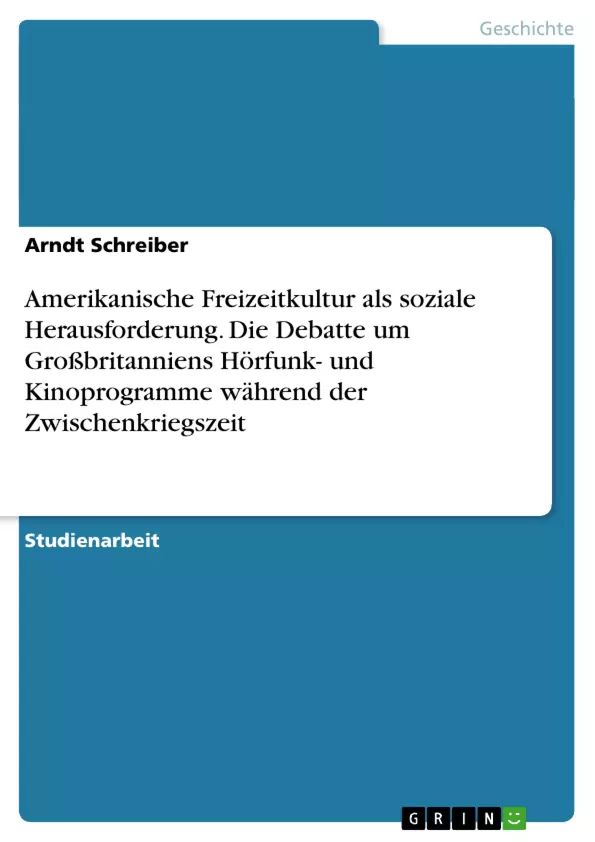EINLEITUNG
Bereits um 1900 begünstigten sukzessive Arbeitszeitverkürzungen und steigende Reallöhne in den wirtschaftlich prosperierenden Regionen Europas das Entstehen einer völlig neuartigen Freizeitindustrie, deren rasche Expansion jedoch erst zwischen den beiden Weltkriegen einen vorläufigen Zenit erreichte. Erfolgreiche Vorbilder lieferten hierbei vielfach die standardisierten Unterhaltungsangebote der US-amerikanischen Massenkünste. Dass diese – im Interesse hoher Profitraten – die ästhetischen Maßstäbe der bislang unangefochten als sinnstiftend respektierten nationalen Hochkulturen von Anfang an ignorierten und stattdessen fast ausschließlich den Geschmack eines breiten Publikums bedienten, löste bekanntlich nicht bloß in den Kreisen des deutschen Bildungsbürgertums, sondern auch unter den Intellektuellen Frankreichs und Großbritanniens heftige Kritik aus. Als die damals attraktivsten Medien kommerzieller Freizeitgestaltung rückten neben dem Trivialroman und der populären Presse vor allem der Film, die Unterhaltungsmusik und das Varieté in den Mittelpunkt des kulturellen Diskurses der Zwischenkriegszeit.
Deshalb soll auf den folgenden Seiten am Beispiel von Hörfunk [2] und Kino [3] untersucht werden, mit welchen Diagnosen bzw. Reformansätzen die geistigen Eliten des Vereinigten Königreiches auf die wachsende „Amerikanisierung“ der britischen Massenkultur zwischen 1918 und 1939 reagierten und ob sie mit letzteren tatsächlich das Freizeitverhalten der adressierten Bevölkerungsschichten nachhaltig zu steuern vermochten. Sowohl die Sozialgeschichte des „Listeningin“ als auch diejenige der Lichtspiele darf seit Ende der 1980er Jahre als relativ gut erforscht gelten : Mit der BBC und ihrem Auditorium haben sich insbesondere die Historiker Asa Briggs und Mark Pegg intensiv auseinandergesetzt ; für die Ära des „Dream Palace“ genießt die gleichnamige Monographie Jeffrey Richards4 noch immer den Rang eines Standardwerkes. Allerdings existieren zu den Freizeiterwartungen der „Massen“ mit den wenigen, bis zu Beginn des II. Weltkrieges erhobenen lokalen „Mass-Observations“5 keine wirklich repräsentativen Quellen...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Indifferente, Pessimisten und Reformer
- Geschmacksbildung statt Massenentertainment
- Für alle nur das Beste
- Konkurrenz und Konzessionen
- „Nothing but Films, Films, Films“
- Going to the Pictures
- Kulturkritik - Moralismus - Zensur
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Reaktion britischer Eliten auf die zunehmende „Amerikanisierung“ der britischen Massenkultur in der Zwischenkriegszeit. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Debatte um Hörfunk und Kino als zentrale Medien der kommerziellen Freizeitgestaltung.
- Die „Amerikanisierung“ der britischen Massenkultur und ihre Auswirkungen auf die kulturelle Identität
- Die Rolle von Hörfunk und Kino als Medien der kommerziellen Unterhaltung
- Die Kritik der britischen Eliten an der „Amerikanisierung“ und ihre Versuche zur Steuerung des Freizeitverhaltens
- Die Entstehung von Reformprojekten im Bereich der Film- und Musikindustrie
- Die Auseinandersetzung mit den ästhetischen und moralischen Aspekten der Massenkunst
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen Reaktionen britischer Intellektueller auf die „Amerikanisierung“ der Massenkultur. Es zeigt, wie die intellektuelle Elite die wachsende Kommerzialisierung der Unterhaltungsindustrie als Bedrohung für die etablierte kulturelle Hierarchie empfand.
Das zweite Kapitel geht näher auf die Debatte um die Geschmacksbildung im Bereich der Massenentertainment ein. Es analysiert die Argumente derjenigen, die eine „hochwertige“ Kultur für alle propagierten, und diejenigen, die die Notwendigkeit von Kompromissen zwischen kulturellen Idealen und kommerziellen Interessen erkannten.
Das dritte Kapitel untersucht die Auswirkungen der „Amerikanisierung“ auf den britischen Film. Es befasst sich mit der Popularität von Hollywoodfilmen und den Bemühungen der britischen Kulturkritik, den „Moralismus“ und die „Zensur“ im Bereich der Kinokultur zu adressieren.
Schlüsselwörter
Amerikanisierung, Massenkultur, Freizeitindustrie, Hörfunk, Kino, Kulturkritik, Moralismus, Zensur, Geschmacksbildung, Eliten, Intellektuelle, soziale Herausforderung.
Häufig gestellte Fragen
Was wird unter der „Amerikanisierung“ der britischen Freizeitkultur verstanden?
Es beschreibt den wachsenden Einfluss standardisierter US-Unterhaltungsangebote (Film, Musik, Varieté) auf das britische Publikum in der Zwischenkriegszeit.
Warum kritisierten die britischen Eliten das amerikanische Kinoprogramm?
Die Eliten sahen darin eine Bedrohung für die nationale Hochkultur und kritisierten die mangelnden ästhetischen Maßstäbe sowie moralische Aspekte der Hollywood-Produktionen.
Welche Rolle spielte die BBC in dieser Debatte?
Die BBC wurde oft als Instrument zur „Geschmacksbildung“ gesehen, um dem Massenentertainment ein hochwertiges Programm entgegenzusetzen.
Was war der „Dream Palace“?
Es ist ein Begriff für die Kinos der damaligen Zeit, die als Fluchtorte aus dem Alltag dienten und massgeblich zur Verbreitung amerikanischer Lebensstile beitrugen.
Gab es Versuche der Zensur?
Ja, die Arbeit untersucht, wie Kulturkritik und Moralismus zu Bestrebungen führten, das Kinoprogramm durch Zensur und Regulierungen zu steuern.
Konnten die Eliten das Freizeitverhalten der Massen nachhaltig steuern?
Die Untersuchung hinterfragt kritisch, ob die Reformansätze der geistigen Eliten tatsächlich die gewünschte Wirkung auf das reale Verhalten der breiten Bevölkerung hatten.
- Arbeit zitieren
- Arndt Schreiber (Autor:in), 2005, Amerikanische Freizeitkultur als soziale Herausforderung. Die Debatte um Großbritanniens Hörfunk- und Kinoprogramme während der Zwischenkriegszeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37537