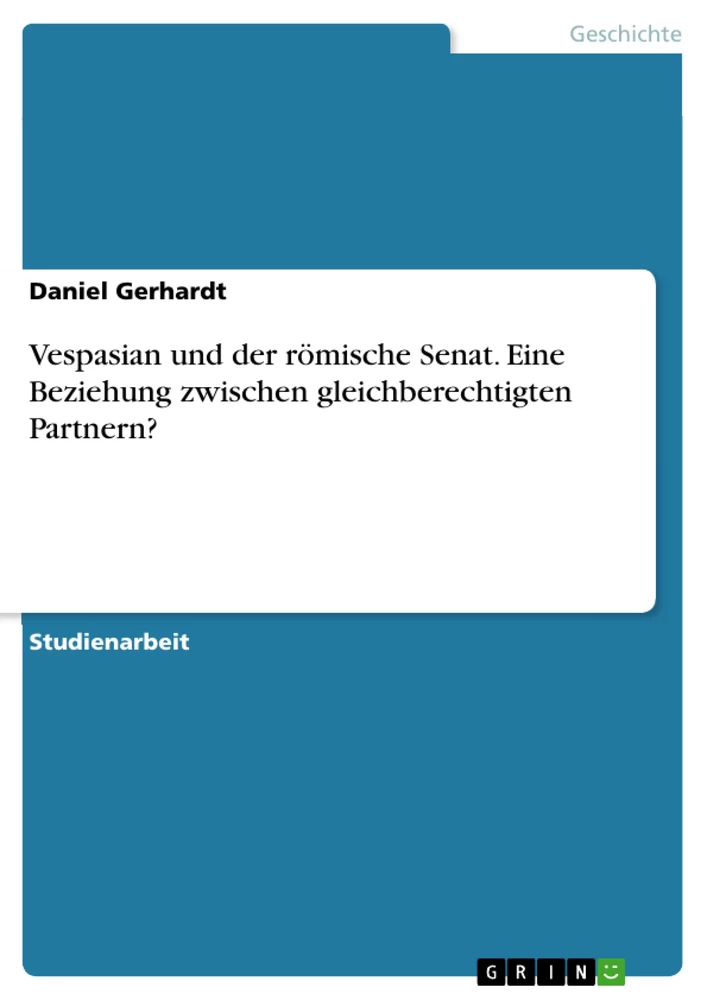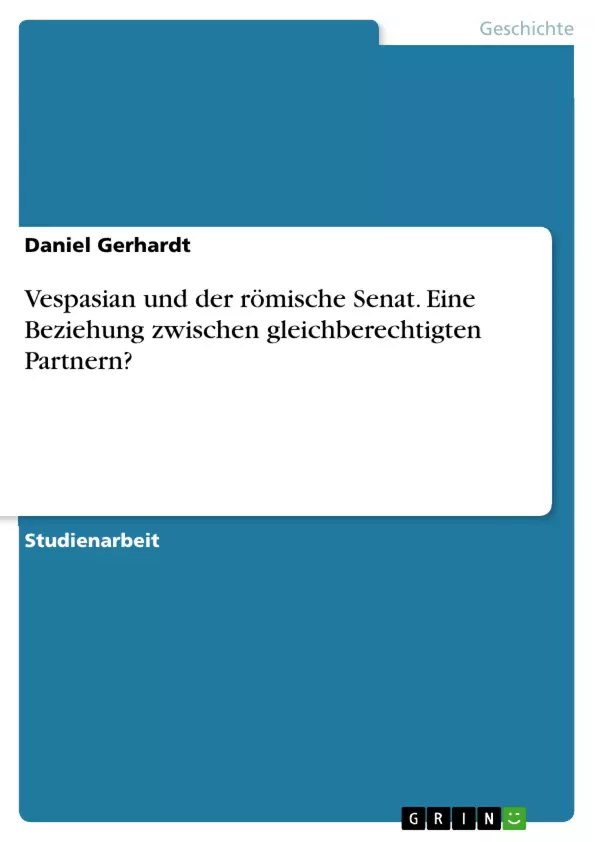In dieser Seminararbeit soll das Verhältnis des Princeps Vespasian und dem Senat, als zentralem Gremium der Republik, näher erläutert werden. War dies eine Beziehung von gleichberechtigten Partnern oder machte Vespasian den Senat schrittweise zu „seinem“ persönlichen Gremium von Marionetten? War die flavische Regierungskonzeption der Stabilität nur auf Kosten der Freiheit zu bewerkstelligen?
Zur Klärung dieser Fragestellung soll die schubweise erfolgte electio in senatum durch Vespasian dargestellt werden. War sie etwa notwendig, aufgrund der politischen Wirren der Vorjahre, oder diente sie lediglich zum Ausbau der eigenen Herrschaft, indem man treue Parteigänger der Flavier in den Rat brachte? Des Weiteren gilt es an dieser Stelle zu beachten, wie sich Vespasian in den Jahren seiner Regentschaft gegenüber dem Senat verhielt. Schließlich müssen das Auftreten der politischen Opposition unter Vespasian und sein Umgang damit eine eingehendere Betrachtung finden. Hierbei soll das Beispiel des Helvidius Priscus explizit herausgehoben werden und eine Schwerpunktsetzung erfahren. Dies alles soll in der Frage gipfeln, ob Vespasian als optimus Princeps bezeichnet werden kann.
Als Grundlage für diese Arbeit dienen Suetons Kaiserbiographie des Vespasian,die Berichte des Cassius Dio über das Verhältnis von Vespasian und dem Senat, sowie die Berichte des Tacitus in seinen Historien. Für die electio in senatum bildet Birks 1967 erschienene Dissertation zum Wandel der römischen Führungsschicht unter Vespasian ein wichtiges Fundament dieser Arbeit. Ebenso gelten Herrmann Bengtsons Werk „Die Flavier“ und Jürgen Malitzs Artikel über Helvidius Priscus und Vespasian als besonders relevant, da bei ihnen die umfangreichen Forschungskont-roversen ebenfalls Anklang finden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Electio in Senatum
- Der Princeps Vespasian und der Senat
- Umgang mit politischer Opposition
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert das Verhältnis zwischen dem römischen Kaiser Vespasian und dem Senat während seiner Regentschaft. Die Arbeit beleuchtet die Frage, ob Vespasian den Senat als gleichberechtigten Partner betrachtete oder ob er ihn zu einem Instrument seiner Macht ausbaute. Zudem wird untersucht, ob die Stabilität der flavischen Herrschaft auf Kosten der Freiheit erkauft wurde.
- Analyse der Ernennung neuer Senatoren unter Vespasian (electio in senatum)
- Untersuchung des Verhältnisses zwischen Vespasian und dem Senat
- Bewertung des Umgangs Vespasians mit politischer Opposition
- Beurteilung der Frage, ob Vespasian als optimus Princeps bezeichnet werden kann
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Problem der Definition des römischen Prinzipats dar und verdeutlicht das Spannungsfeld zwischen der Wahrung der traditionellen republikanischen Staatsform und den Interessen des Princeps, seine Macht zu sichern und gegebenenfalls auszubauen. Die Arbeit fokussiert auf die Beziehung zwischen Vespasian und dem Senat und stellt die Frage, ob Vespasian den Senat zu einem Instrument seiner Macht machte.
Hauptteil
Electio in Senatum
Dieses Kapitel beleuchtet die Ernennung neuer Senatoren unter Vespasian. Es analysiert die Gründe für die umfangreiche Erneuerung des Senats, insbesondere die politische Situation der Vorjahre und die Verfolgung von Senatoren durch Nero. Das Kapitel beschreibt die zwei Phasen der Neuordnung des Senats unter Vespasian: die eingeschränkte Erweiterung des Senats in den Jahren 69/70 n. Chr. und die umfassende lectio Senatus in den Jahren 73/74 n. Chr. Es wird zudem die soziale und geographische Herkunft der neu ernannten Senatoren betrachtet.
Der Princeps Vespasian und der Senat
Dieses Kapitel untersucht das Verhältnis zwischen Vespasian und dem Senat. Es wird analysiert, ob Vespasian sich an der augusteischen Politik orientierte und welche Aspekte seiner Herrschaft von der Tradition abwichen. Das Kapitel beleuchtet die Frage, ob Vespasian den Senat zu einem Instrument seiner Macht machte oder ob er ihn als gleichberechtigten Partner betrachtete.
Umgang mit politischer Opposition
Dieses Kapitel analysiert den Umgang Vespasians mit politischer Opposition. Es untersucht die Rolle des Helvidius Priscus als Beispiel für die Opposition und diskutiert, ob Vespasian die Freiheit des Senats einschränkte. Das Kapitel beleuchtet die Frage, ob Vespasian als optimus Princeps bezeichnet werden kann, angesichts seiner Politik gegenüber der Opposition.
Schlüsselwörter
Vespasian, Senat, electio in senatum, Princeps, Republik, politische Opposition, Helvidius Priscus, optimus Princeps, Flavier, Augustus, Tradition, römische Führungsschicht, konsul, Imperium
Häufig gestellte Fragen
Wie war das Verhältnis zwischen Vespasian und dem Senat?
Die Arbeit untersucht, ob Vespasian den Senat als gleichberechtigten Partner sah oder ihn schrittweise zu einem persönlichen Gremium von „Marionetten“ umformte.
Was bedeutet der Begriff „electio in senatum“?
Es beschreibt die Ernennung neuer Senatoren durch den Princeps, die Vespasian nutzte, um die durch Kriege und Verfolgungen gelichteten Reihen des Senats zu füllen.
Wer war Helvidius Priscus?
Helvidius Priscus war ein prominenter Vertreter der politischen Opposition, dessen Konflikt mit Vespasian als Beispiel für das Spannungsfeld zwischen kaiserlicher Macht und senatorischer Freiheit dient.
Kann Vespasian als „optimus Princeps“ bezeichnet werden?
Diese Frage bildet den Kern der Arbeit, wobei Vespasians Regierungsstil, sein Umgang mit der Opposition und die Stabilität der flavischen Herrschaft abgewogen werden.
Welche Quellen wurden für die Analyse herangezogen?
Grundlage sind die Kaiserbiographien von Sueton, die Berichte von Cassius Dio sowie Tacitus' Historien.
- Citation du texte
- Daniel Gerhardt (Auteur), 2013, Vespasian und der römische Senat. Eine Beziehung zwischen gleichberechtigten Partnern?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375394