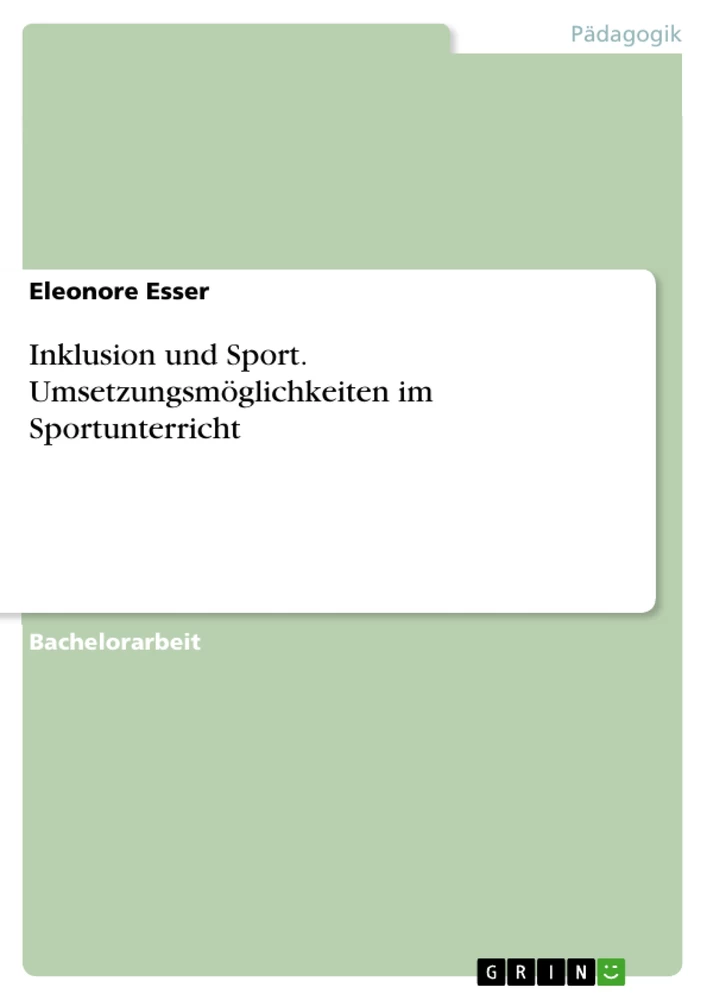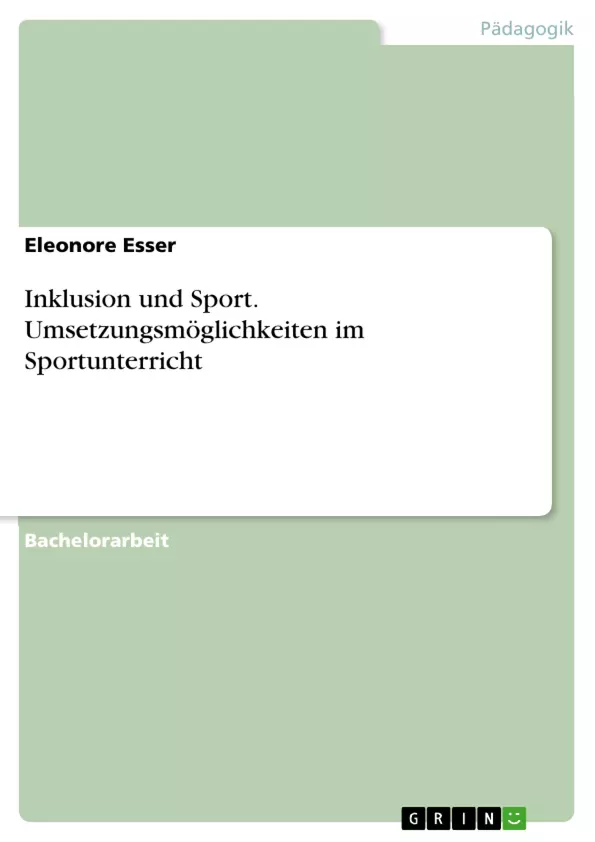Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention hat sich die Bundesregierung verpflichtet, die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen für Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Diese eingegangene Verpflichtung bedeutet für das deutsche Schulwesen, in welchem immer noch das Prinzip der Separation überwiegt, eine völlige Umwälzung. Die Analyse widmet sich der Aufgabe, einige didaktische Umsetzungsmöglichkeiten eines inklusiven Unterrichts explizit im Fach „Sport“ aufzuführen, welche in Bezug auf den Rahmenlehrplan Berlin-Brandenburg ihre Legitimation erhalten. Zentrale Prinzipien des Sportunterrichts, die sich für inklusive Pädagogik anbieten und mögliche Leistungsbeurteilungen innerhalb eines inklusiven Sportunterrichts werden erläutert. Ein inklusiver Sportunterricht ist schon heute mit bereits bestehendem didaktischen Material umsetzbar. Jedoch wird in der Analyse deutlich, dass bis sich das deutsche Schulwesen wirklich inklusiv nennen darf, sich grundlegende Veränderungen im deutschen Bildungssystem vollziehen werden müssen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- 1 Einleitung
- 2 Definitionen der Begrifflichkeiten
- 2.1 Behinderung
- 2.1.1 „Behinderung“ oder „Das alte Verständnis von Behinderung“
- 2.1.2 „Mensch mit Behinderung“ oder „Das neue Verständnis von Behinderung“
- 2.1.3 Sonderpädagogische Förderbereiche
- 2.2 Integration
- 2.3 Inklusion
- 2.4 Gegenüberstellung von Integration und Inklusion
- 2.1 Behinderung
- 3 Historische Entwicklung
- 3.1 Vom Versehrtensport bis zu den Paralympics
- 3.2 Von der Separation zur Inklusion
- 3.3 Bildung und Sport im Fokus der UN-Behindertenrechtskonvention
- 4 Umsetzungsmöglichkeiten eines inklusiven Sportunterrichts
- 4.1 Inklusiver Sportunterricht unter den Bedingungen des Rahmenlehrplans Berlin-Brandenburg
- 4.1.1 Kompetenzen
- 4.1.2 Leistungsbeurteilung
- 4.2 Zentrale Prinzipien für einen inklusiven Sportunterricht
- 4.2.1 Individualisierung
- 4.2.2 Binnendifferenzierung
- 4.2.3 Kooperatives Lernen
- 4.3 Mögliche Leistungsbeurteilungen im inklusiven Sportunterricht
- 4.3.1 Individuelle Bezugsnorm
- 4.3.2 Bewertung sozialen Lernens
- 4.1 Inklusiver Sportunterricht unter den Bedingungen des Rahmenlehrplans Berlin-Brandenburg
- 5 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die Umsetzungsmöglichkeiten eines inklusiven Sportunterrichts im deutschen Schulwesen. Im Fokus steht die Frage, wie die Prinzipien der Inklusion im Sportunterricht, insbesondere unter den Bedingungen des Rahmenlehrplans Berlin-Brandenburg, umgesetzt werden können.
- Definitionen von Behinderung, Integration und Inklusion
- Historische Entwicklung des Sportangebots für Menschen mit Behinderungen
- Relevanz der UN-Behindertenrechtskonvention für inklusive Sportpädagogik
- Zentrale Prinzipien eines inklusiven Sportunterrichts
- Mögliche Leistungsbeurteilungen im inklusiven Sportunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema Inklusion und Sport. Im zweiten Kapitel werden die Begriffe Behinderung, Integration und Inklusion definiert und miteinander verglichen. Das dritte Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Sportangebots für Menschen mit Behinderungen und die Bedeutung der UN-Behindertenrechtskonvention für inklusive Sportpädagogik. Im vierten Kapitel werden die Umsetzungsmöglichkeiten eines inklusiven Sportunterrichts unter den Bedingungen des Rahmenlehrplans Berlin-Brandenburg analysiert. Es werden zentrale Prinzipien für einen inklusiven Sportunterricht sowie mögliche Leistungsbeurteilungen vorgestellt.
Schlüsselwörter
Inklusion, Sport, Sportunterricht, Behinderung, Integration, UN-Behindertenrechtskonvention, Rahmenlehrplan Berlin-Brandenburg, Individualisierung, Binnendifferenzierung, Kooperatives Lernen, Leistungsbeurteilung, individuelle Bezugsnorm, Bewertung sozialen Lernens.
- Citation du texte
- Eleonore Esser (Auteur), 2015, Inklusion und Sport. Umsetzungsmöglichkeiten im Sportunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375522