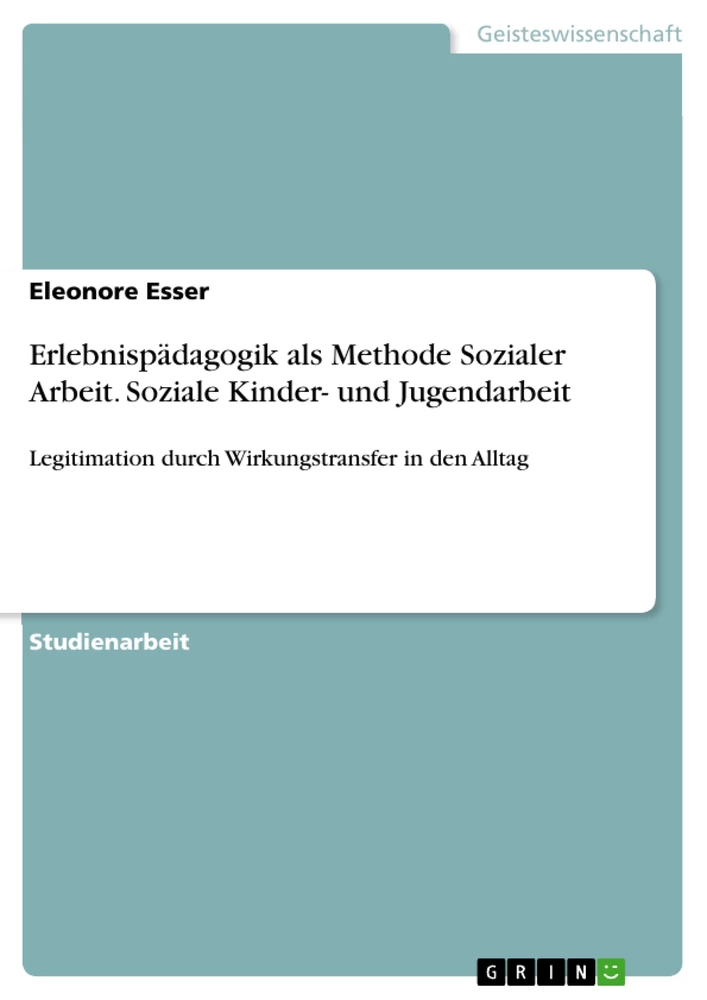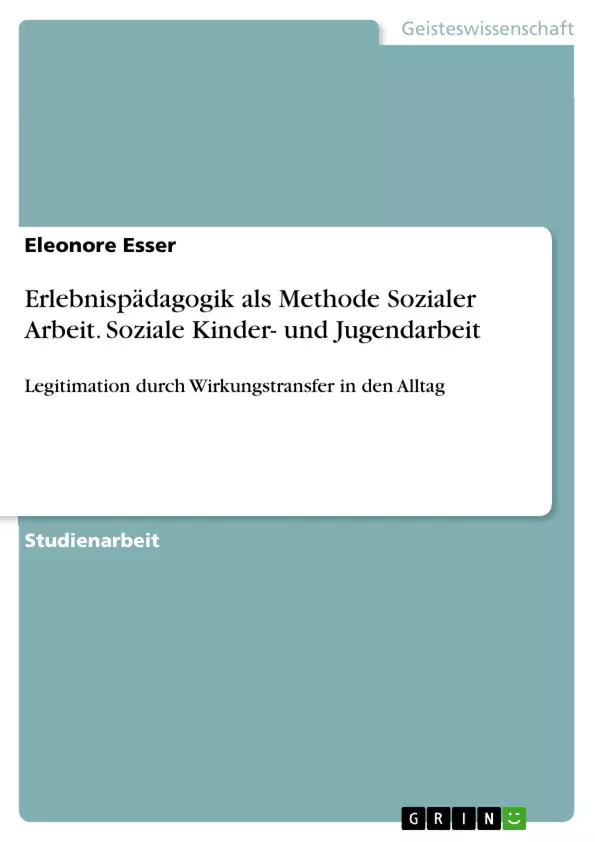Entwicklungsgeschichtlich kann behauptet werden, dass es immer unterschiedliche Voraussetzungen gab, welche gegeben sein mussten, um an der Spitze der Gesellschaft stehen zu können. So war es beispielsweise im Mittelalter die Herkunft und das Geblüt, welche entschieden haben an welcher Stelle der Gesellschaft das Individuum eines Tages zu stehen hat. Im Zeitalter der Industrialisierung lag die Gewichtung anders und es war ausschlaggebend viel Geld zu haben um gesellschaftlichen Einfluss zu bekommen. Heute ist unsere Kultur dadurch geprägt, dass sie den Intellekt sehr hoch bewertet und mit dieser Ressource kann eine entsprechend hohe Position in der Gesellschaft eingenommen werden. Ein guter Bildungsabschluss eröffnet einem Menschen fast alle Türen in unserer heutigen Gesellschaft, auch wenn die Eltern aus ärmlichen Verhältnissen stammen und keinen Adelstitel tragen. Natürlich muss das Individuum über verschiedene Schlüsselkompetenzen und Formen des Kapitals verfügen, um seinen Weg entsprechend ebenen zu können. Aber darauf soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden. Unsere heutige Gesellschaft definiert sich also primär über den Geist, den Verstand und das kognitive Wissen!
Aus der Perspektive des reformpädagogischen, ganzheitlichen Ansatzes betrachtet, hat dies allerdings zur Folge, dass die Entwicklung und Förderung der intuitiven und instinktiven Wahrnehmungsformen und Fähigkeiten im hohen Ausmaß vernachlässigt werden. Bei extremen Verstandesmenschen kann sich somit ein Mangel im sinnlichen Erfahrungsbereich ausbilden und zu einer Erlebnisunfähigkeit führen. Die kognitive Ebene ist also nur eine Möglichkeit, sich Wissen anzueignen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Soziale Arbeit und Erlebnispädagogik
- Soziale Kinder- und Jugendarbeit
- Handlungsmethode
- Das „Transferproblem“
- Studie
- „Erlebnispädagogik mit Jugendlichen: Einflüsse auf Symptombelastungen und Selbstwert“
- Ergebnisse
- Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Legitimation der Erlebnispädagogik als Methode der Sozialen Arbeit im Hinblick auf ihren Transfer in den Alltag. Sie beleuchtet die Relevanz von ganzheitlichen Lernansätzen angesichts einer Gesellschaft, die den Intellekt übermäßig stark gewichtet, und zeigt die potenzielle Rolle der Erlebnispädagogik, um den Mangel an sinnlichen Erfahrungen zu kompensieren.
- Die Bedeutung der Erlebnispädagogik für ganzheitliches Lernen und die Entwicklung der Persönlichkeit
- Die Relevanz von erlebnispädagogischen Konzepten in der Sozialen Arbeit, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit
- Das Transferproblem der Erlebnispädagogik und die Frage, ob erlebnispädagogische Erfahrungen in den Alltag übertragbar sind
- Die Bedeutung von wissenschaftlichen Studien, um die Wirkung der Erlebnispädagogik zu belegen und ihre Legitimation zu stärken
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt den Ausgangspunkt der Arbeit dar und beleuchtet die Bedeutung von ganzheitlichen Lernansätzen in einer Gesellschaft, die den Intellekt übermäßig stark gewichtet. Sie führt die Erlebnispädagogik als einen Ansatz ein, der die Entwicklung der intuitiven und instinktiven Wahrnehmungsformen und Fähigkeiten fördert.
- Soziale Arbeit und Erlebnispädagogik: Dieses Kapitel beschreibt die grundlegenden Ziele und Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit sowie die Relevanz von wissenschaftlich fundierten Handlungsmethoden. Es stellt die Erlebnispädagogik als eine wirksame Handlungsmethode vor, die insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit Anwendung findet.
- Soziale Kinder- und Jugendarbeit: Dieses Kapitel fokussiert sich auf das Handlungsfeld der Sozialen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, welches einen wichtigen Anwendungsschwerpunkt der Erlebnispädagogik darstellt.
- Handlungsmethode: Dieses Kapitel befasst sich mit grundlegenden Überlegungen zum methodischen Handeln und deren Anwendung auf die Erlebnispädagogik. Es stellt die Handlungsorientierung und die Betonung von aktiven Erleben in der Erlebnispädagogik heraus.
- Das „Transferproblem“: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, ob erlebnispädagogische Erfahrungen in den Alltag transferiert werden können. Es untersucht die (Un)Möglichkeit einer Transferleistung der Erlebnispädagogik und analysiert die Kritik an der fehlenden wissenschaftlichen Fundierung ihrer Wirkung und Transferfähigkeit.
- Studie: Dieses Kapitel präsentiert eine beispielhafte Studie, die die Wirkung der Erlebnispädagogik auf die Symptombelastungen und den Selbstwert von Jugendlichen untersucht. Die Ergebnisse der Studie sollen Aufschluss darüber geben, inwieweit die Erlebnispädagogik der Forderung nach einer Transferleistung entsprechen kann.
Schlüsselwörter
Erlebnispädagogik, Soziale Arbeit, Kinder- und Jugendarbeit, Ganzheitliches Lernen, Handlungsmethode, Transferproblem, Transferleistung, Selbstwert, Symptombelastung, wissenschaftliche Fundierung, Legitimation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Erlebnispädagogik in der Sozialen Arbeit?
Sie dient als ganzheitliche Methode, um durch unmittelbare Erlebnisse Schlüsselkompetenzen zu fördern, das Selbstwertgefühl zu stärken und soziale Lernprozesse anzustoßen.
Was versteht man unter dem „Transferproblem“?
Das Transferproblem beschreibt die Schwierigkeit, die in einer künstlichen oder außergewöhnlichen Situation (z.B. Klettern) gemachten Erfahrungen nachhaltig in den Alltag der Jugendlichen zu übertragen.
Warum ist ein ganzheitlicher Lernansatz heute so wichtig?
In einer Gesellschaft, die den Intellekt und kognitives Wissen überbewertet, hilft Erlebnispädagogik, den Mangel an sinnlichen und intuitiven Erfahrungen auszugleichen.
Welchen Einfluss hat Erlebnispädagogik auf den Selbstwert von Jugendlichen?
Wissenschaftliche Studien zeigen, dass erfolgreiche Grenzerfahrungen und Gruppenprozesse die Symptombelastung senken und das Selbstvertrauen nachhaltig steigern können.
Ist Erlebnispädagogik wissenschaftlich legitimiert?
Die Arbeit diskutiert die Notwendigkeit wissenschaftlicher Belege, um die Erlebnispädagogik als anerkannte Handlungsmethode in der Kinder- und Jugendarbeit zu festigen.
- Quote paper
- MA Eleonore Esser (Author), 2014, Erlebnispädagogik als Methode Sozialer Arbeit. Soziale Kinder- und Jugendarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375532