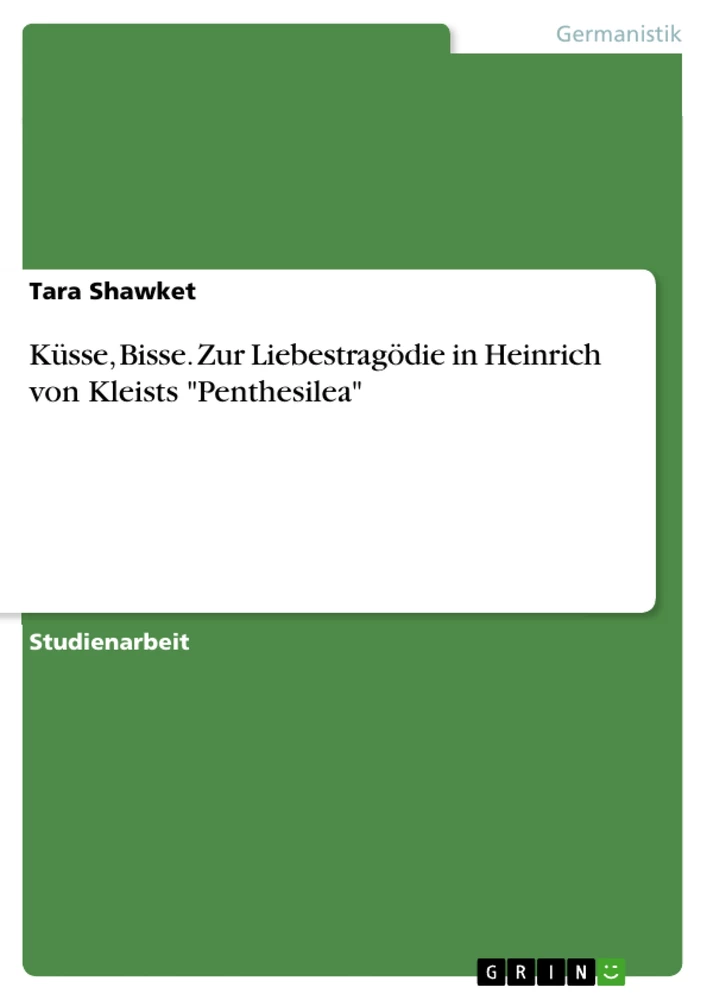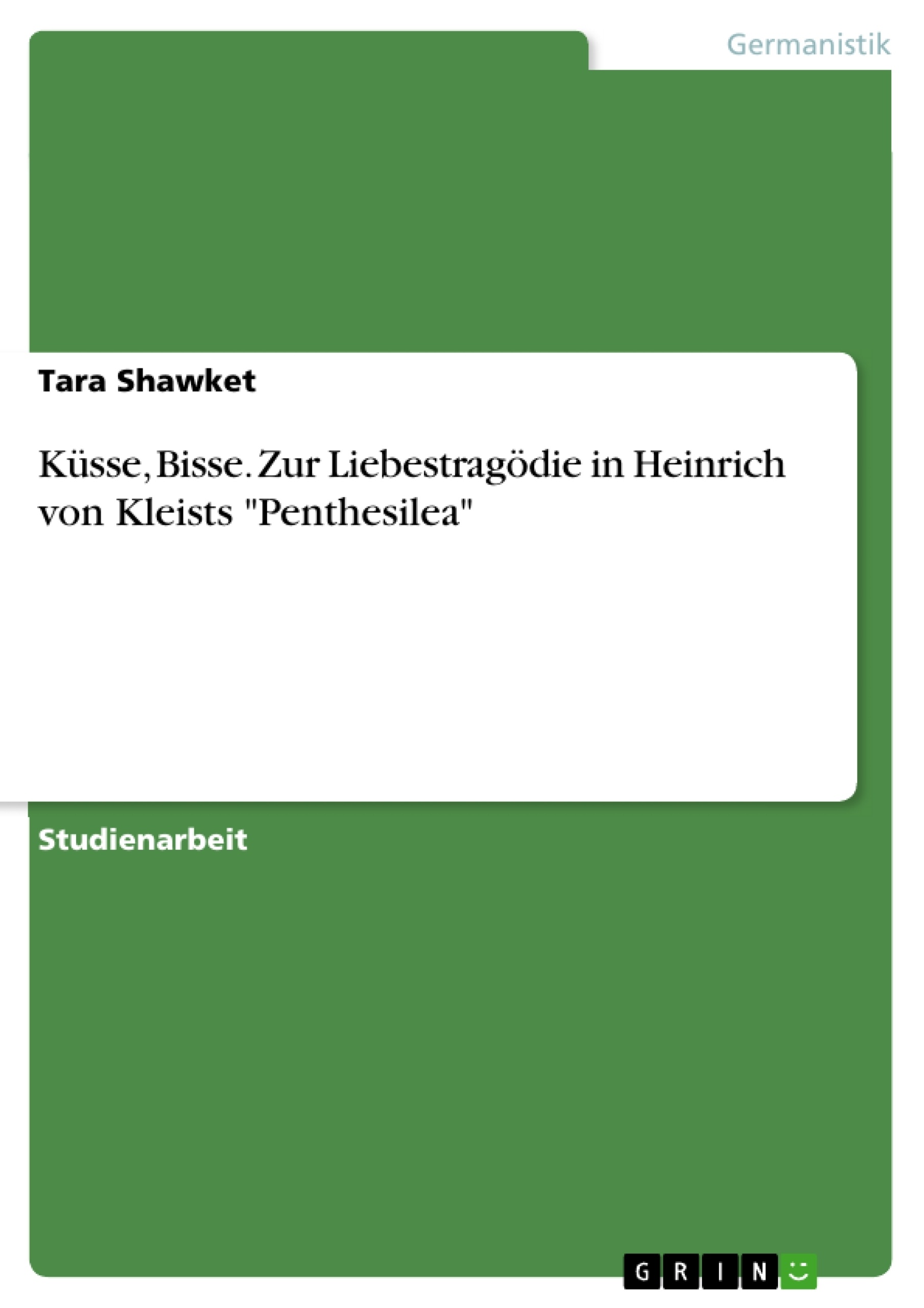Heinrich von Kleist war ein polarisierender Schriftsteller, dessen Werk „Penthesilea“ gerade sein Zeitgenosse und Helios Goethe mit Abscheu begegnete. Kleist war viel daran gelegen, dass seine Werke Johann Wolfgang von Goethe gefallen, aber erfahren durfte Kleist nur kühle Ablehnung.
Wenn also die Koryphäe deutscher Literatur ein Werk so inbrünstig ablehnt, stellt sich die Frage, was an Kleists Stück, den Goethe ja durchaus als Genie benannte, so grässliche Empfindungen bei seinen Rezipienten auslösen kann?
Außerdem ist der Tod ein ständiger Begleiter in Kleists Literatur, aber gerade in „Penthesilea“ scheint er sein Grausamstes zu zeigen, passiert er doch nicht aus Hass, sondern aus Liebe.
Trotzdem ist es nicht das Ziel meiner Arbeit das Augenmerk auf die Ermordung Achills durch Penthesilea zu richten, sondern herauszufinden wieso, obwohl der Tod doch eigentlich das bittere Ende und den nicht-heroischen Untergang der Helden bedeutet, der Ausgang des Stückes vollkommen befriedigend ist und sich kein treffenderes Ende vorstellen lässt?
Um davon überzeugt zu sein, dass der Tod das Richtige für die Heldenfigur der Penthesilea ist, gilt es zuvor ihre Person und ihre sozialen Rollen genauer zu betrachten.
Eine besondere Faszination geht von Penthesilea auch aus, weil Kleist ihr Wesen mit seinem Innersten beschrieb und er sein eigenes Leben wie das Leben der Titelgeberin in einem Selbstmord enden lässt. Beide Seelen erfahren Demütigungen sowie Kränkung und sind, jeglichem gesellschaftlichen Prestige und allen Bemühungen zum Trotze, nicht in der Lage ihr Glück auf Erden zu finden.
Weil, wie der Dichter selbst angibt, in „Penthesilea“ Heinrich von Kleist zu finden ist, möchte ich der Frage auf den Grund gehen, ob sich des Autors „innerstes Wesen“ auch im Ausgang des Stücks wiederfinden lässt und auf Kleists noch bevorstehenden Suizid deutet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Autor und Zeit
- Historische Kontexteinbettung
- Charakterisierung der Protagonisten
- Penthesilea
- als Amazone
- als Königin
- als Liebende
- Schmerz, Gefühl und Wahnsinn als Wesensmerkmale
- Katharsis
- Ambivalenz der Gesetzesordnung
- Die Funktion der absoluten Liebe
- Der Tod als Doppelschluss
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die tragische Liebesgeschichte in Kleists „Penthesilea“ zu analysieren und zu verstehen, warum der Tod der Titelheldin trotz seiner Grausamkeit ein befriedigendes Ende darstellt. Dabei wird untersucht, wie Kleist die Figur der Penthesilea zeichnet und welche sozialen Rollen sie innehat.
- Die Ambivalenz der Gesetzesordnung in der griechischen Mythologie und ihre Auswirkungen auf Penthesileas Handlungen
- Die Rolle der absoluten Liebe im Kontext von Krieg und Gewalt
- Die Verbindung zwischen Penthesileas Leidensgeschichte und Kleists eigener Biografie
- Der Einfluss des historischen Kontextes auf Kleists Werk
- Die Frage nach dem „innersten Wesen“ des Autors und seiner Darstellung in „Penthesilea“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Frage der Arbeit dar: Warum ist der Tod der Penthesilea trotz seiner Grausamkeit ein befriedigendes Ende? Die Arbeit zielt darauf ab, die Figur der Penthesilea und ihre sozialen Rollen zu analysieren und den Zusammenhang zwischen Kleists Leben und seinem Werk zu erforschen.
Autor und Zeit: Dieses Kapitel beleuchtet die Lebensumstände Heinrich von Kleists im Kontext der historischen Ereignisse seiner Zeit, insbesondere des Krieges und der Veränderungen der gesellschaftlichen Ordnung. Es werden Kleists frühe Erfahrungen im Militär, seine Suche nach Selbstbestimmung und sein Denken in traditionellen Geschlechterrollen beleuchtet.
Penthesilea: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Facetten der Titelheldin: ihre Rolle als Amazone, als Königin und als Liebende. Es werden ihre emotionalen und psychologischen Wesensmerkmale, insbesondere Schmerz, Gefühl und Wahnsinn, betrachtet.
Katharsis: Dieses Kapitel erörtert die Rolle der Katharsis im Stück, insbesondere die Ambivalenz der Gesetzesordnung, die Funktion der absoluten Liebe und die Bedeutung des Todes als Doppelschluss. Es werden die Auswirkungen dieser Elemente auf die Handlung und die Figuren analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Penthesilea, Heinrich von Kleist, Liebestragödie, Tod, Katharsis, Gesetzesordnung, absolute Liebe, Krieg, Gewalt, Selbstbestimmung, Geschlechterrollen, historischer Kontext, inneres Wesen.
Häufig gestellte Fragen
Warum reagierte Goethe mit Abscheu auf Kleists „Penthesilea“?
Goethe empfand die Radikalität und die grausame Darstellung der Liebe, die in Gewalt umschlägt, als unvereinbar mit seinen klassischen Idealen.
Was ist das Besondere an der Liebestragödie in diesem Werk?
Der Tod erfolgt nicht aus Hass, sondern als Folge einer absoluten, grenzenlosen Liebe, die an den gesellschaftlichen Gesetzen (Amazonenstaat) scheitert.
Welche sozialen Rollen bekleidet Penthesilea?
Sie ist zugleich Amazone, Königin und Liebende, wobei diese Rollen in einen unauflösbaren Konflikt miteinander geraten.
Gibt es Parallelen zwischen Kleists Leben und der Figur Penthesilea?
Ja, Kleist schrieb sein „innerstes Wesen“ in die Figur; beide erfuhren soziale Kränkungen und sahen im Tod einen Ausweg aus unlösbaren Konflikten.
Was bedeutet Katharsis im Kontext des Stücks?
Die Arbeit untersucht, warum der grauenhafte Ausgang des Stücks beim Leser dennoch ein Gefühl der (tragischen) Befriedigung oder Reinigung hinterlässt.
- Quote paper
- Tara Shawket (Author), 2017, Küsse, Bisse. Zur Liebestragödie in Heinrich von Kleists "Penthesilea", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375632