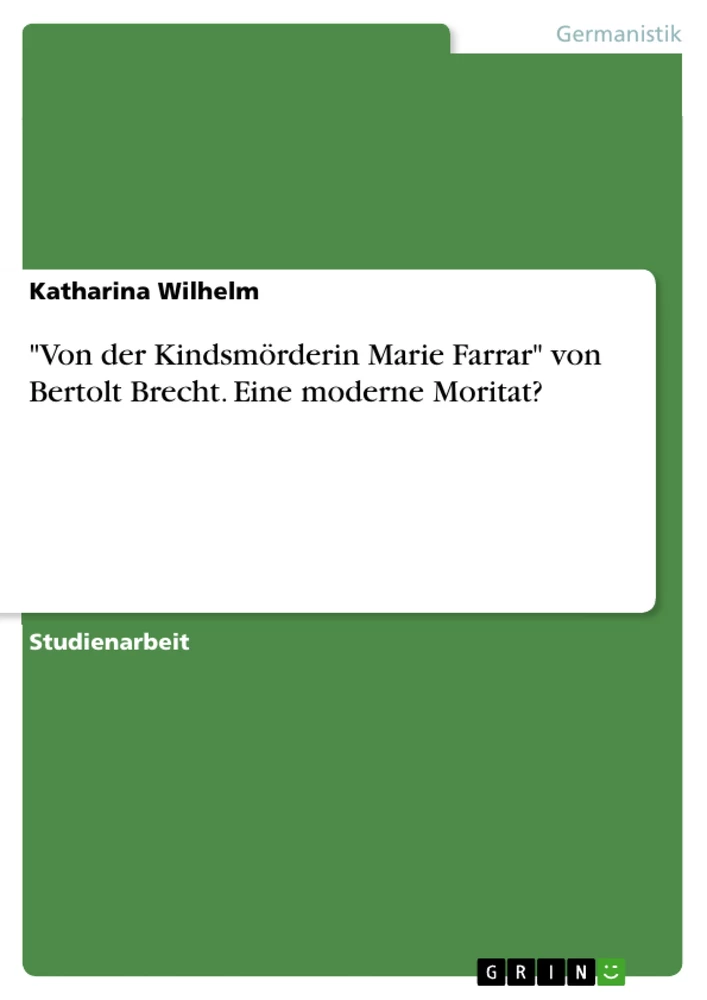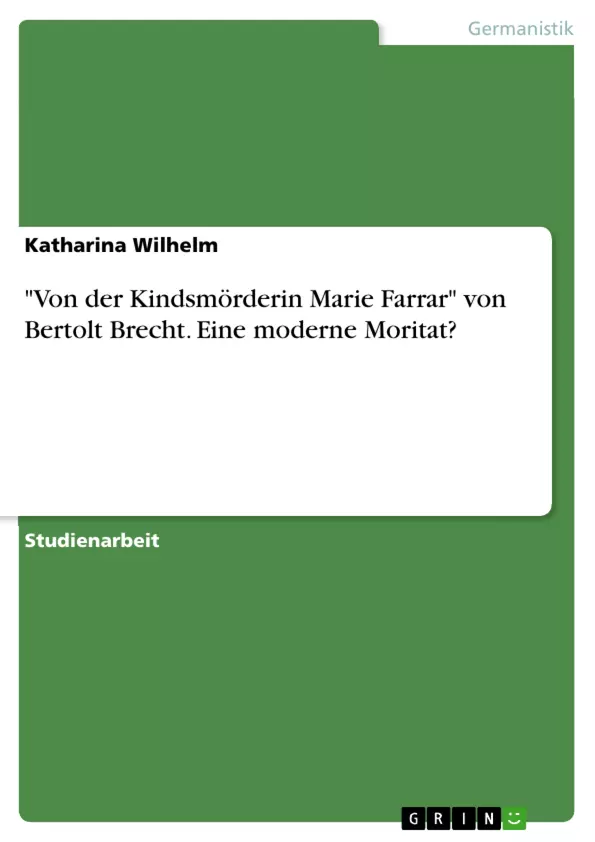In meiner Arbeit im Kontext des Seminars „Kindsmord in der Literatur und im Lied“ werde ich der Frage nachgehen, wie sich die Thematik des Kindsmords in traditionelleren literarischen Formen gestaltet und wie diese Darstellung moderne Werke beeinflusst hat. Welche Motive und Techniken haben sich entwickelt und verändert, welche sind gleichgeblieben und von welchen grenzen sich neuere Kindsmord-Darstellungen ab? Diese und weitere Fragen werde ich am Beispiel von Bertolt Brechts Ballade „Von der Kindsmörderin Marie Farrar“ untersuchen, die ich mit zwei historischen Moritaten, „Die Geschichte der Kinds-Mörderin M. H. von T.“ und „Das erwachte Gewissen oder Die böse Mutter“ vergleichen möchte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Analyse: Brechts Ballade und die Tradition der Moritat
- Vergleich: Die Darstellung des Kindsmords in historischen Moritaten
- Die Geschichte der M. H. v. T.
- Das erwachte Gewissen oder Die böse Mutter
- Zusammenfassung, Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit im Rahmen des Seminars „Kindsmord in der Literatur und im Lied“ untersucht die Darstellung des Kindsmords in Bertolt Brechts Ballade „Von der Kindsmörderin Marie Farrar“. Sie verfolgt die Frage, wie sich die Thematik des Kindsmords in traditionelleren literarischen Formen gestaltet und wie diese Darstellung moderne Werke beeinflusst hat. Die Arbeit analysiert Brechts Ballade im Vergleich mit zwei historischen Moritaten und erörtert Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Darstellung des Kindsmords.
- Die Darstellung des Kindsmords in der Literatur
- Analyse von Brechts Ballade „Von der Kindsmörderin Marie Farrar“
- Vergleich mit historischen Moritaten
- Entwicklung von Motiven und Techniken in der Darstellung des Kindsmords
- Brechts Ballade als moderne Moritat
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Das Kapitel stellt Marie Farrar, die Protagonistin von Brechts Ballade, als eine der zahlreichen Mütter der Literaturgeschichte vor, die ihr Kind töteten. Es werden die Tradition des Kindsmordmotivs in der Literatur und die unterschiedlichen Gattungen, in denen es auftritt, beleuchtet. Die Arbeit verfolgt die Frage, wie sich die Darstellung des Kindsmords in traditionellen literarischen Formen von modernen Darstellungen unterscheidet und wie diese sich gegenseitig beeinflussen.
Analyse: Brechts Ballade und die Tradition der Moritat
Dieses Kapitel analysiert Brechts Ballade „Von der Kindsmörderin Marie Farrar“ im Kontext seiner soziopolitischen Wendung und zeigt auf, wie er traditionelle Formen und Motive umkehrt. Es untersucht die sprachlichen Besonderheiten der Ballade, die sich durch zwei unterschiedliche Sprechweisen auszeichnen: eine bürokratisch-unmenschliche Sprache und eine predigend-mitleidige Sprache. Das Kapitel beleuchtet die Syntax und Form der Ballade und zeigt auf, wie Brecht durch bewusst eingesetzte Pausen den Leser zu neuer Aufmerksamkeit für das Erzählte drängt.
Schlüsselwörter
Kindsmord, Moritat, Bertolt Brecht, Ballade, Tradition, Moderne, Darstellung, Motiv, Technik, Sprache, Vergleich, Geschichte der M. H. v. T., Das erwachte Gewissen oder Die böse Mutter.
- Arbeit zitieren
- Katharina Wilhelm (Autor:in), 2014, "Von der Kindsmörderin Marie Farrar" von Bertolt Brecht. Eine moderne Moritat?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375792