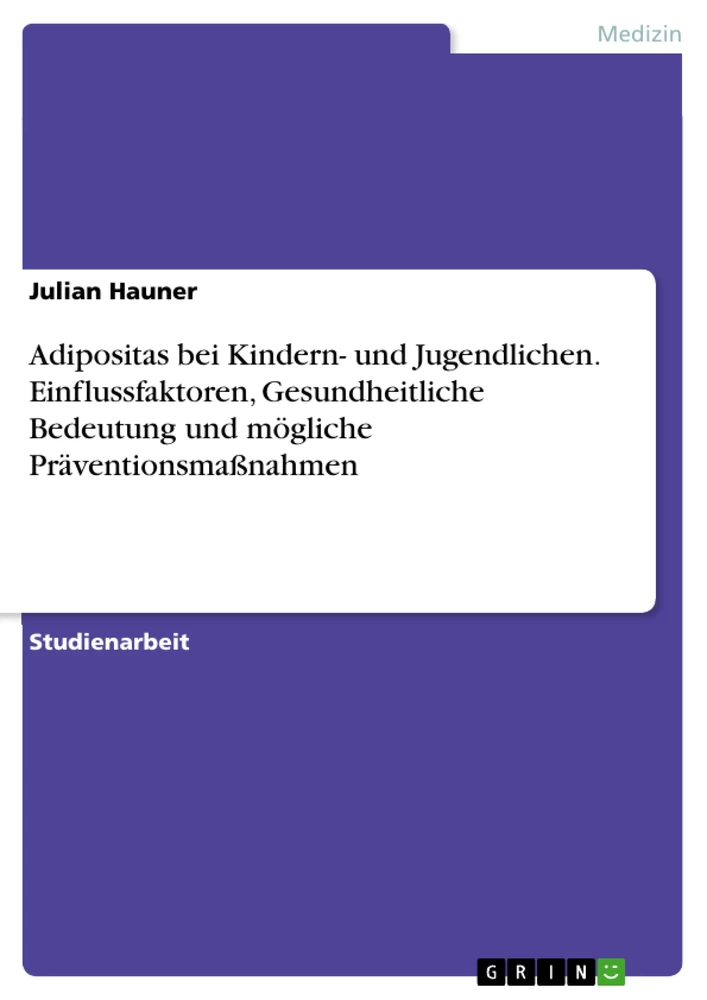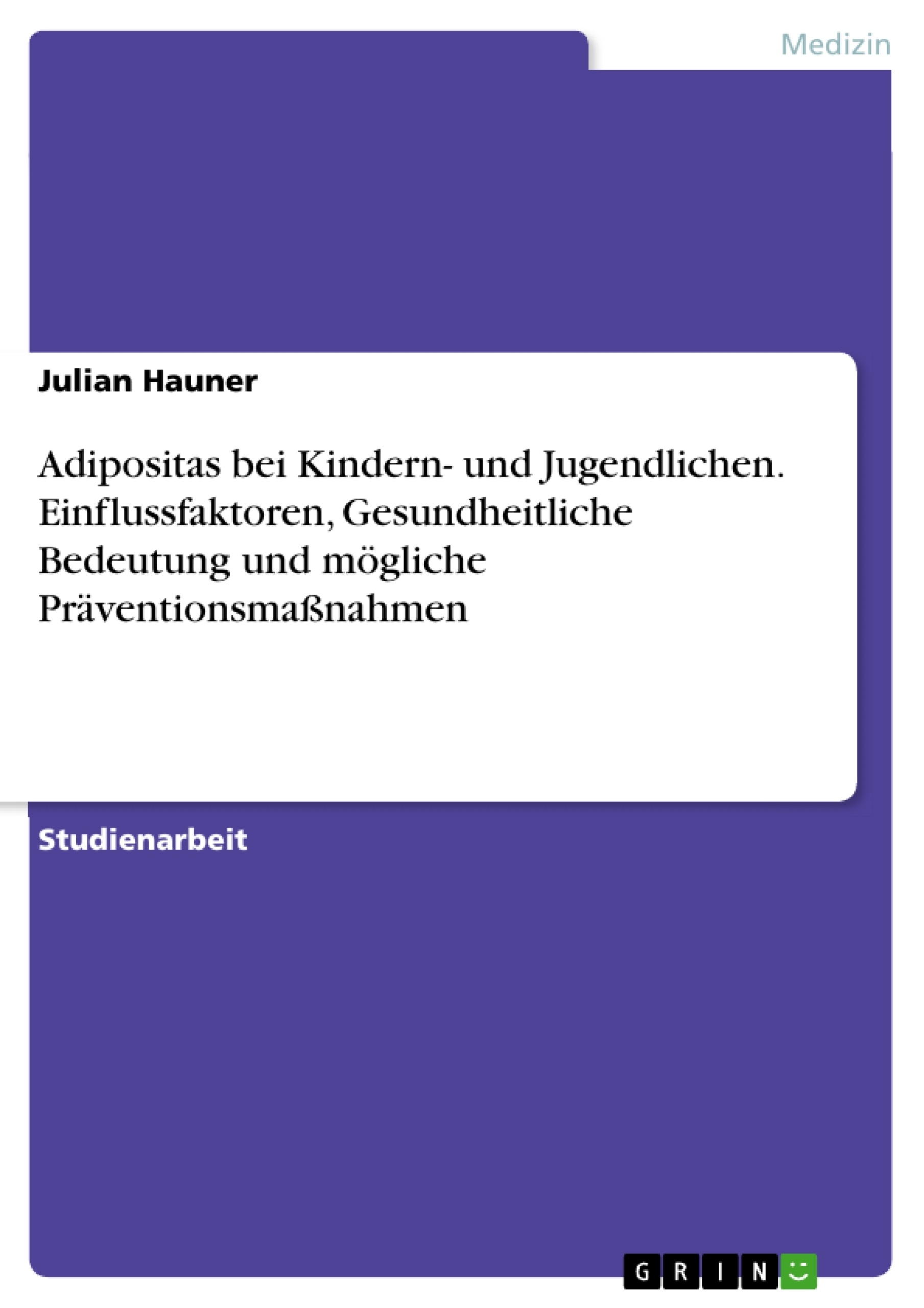In Deutschland ist jedes 5. Kind übergewichtig, wobei eine steigende Zahl an adipösen Menschen anzunehmen ist. Gründe dafür sind das sich verschlechternde Bewegungsverhalten der heutigen Gesellschaft, ebenso wie das schlechte Ernährungsverhalten. Warum ist solch eine Entwicklung vorhanden und wie kommt es zu Übergewicht und Adipositas? Auf die verschiedenen Entstehungs- und Einflussfaktoren, welche zu Adipositas führen, wird in dieser Hausarbeit eingegangen. Ebenso werden die unmittelbaren und langfristigen gesundheitlichen Folgen näher betrachtet. Um eine Entstehung von Übergewicht und Adipositas zu verhindern bzw. dieser entgegen zu wirken, sind Präventions- und Therapiemaßnahmen notwendig, diese werden ebenfalls erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition und Klassifikation Adipositas
- Prävelenz
- Entstehungs- und Einflussfaktoren
- Genetische Einflussfaktoren
- Psychische und psychosoziale Einflussfaktoren
- Externe Einflussfaktoren
- Sozioökonomische Einflussfaktoren
- Fernsehkonsum und Ernährungsverhalten
- Gesundheitliche Bedeutung von Adipositas
- Konsequenzen von Adipositas im Kindesalter
- Langzeitkonsequenzen der Adipositas im Kindesalter
- Psychosoziale Folgen
- Mögliche Präventionsmaßnahmen
- Sport/Bewegung
- Ernährung
- Verhaltenstraining
- Diskussion/Schlussfolgerung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Adipositas bei Kindern und Jugendlichen. Die Arbeit analysiert die Definition und Klassifikation von Adipositas, untersucht die Prävalenz des Problems in Deutschland und beleuchtet die verschiedenen Entstehungs- und Einflussfaktoren. Darüber hinaus werden die gesundheitlichen Folgen von Adipositas im Kindesalter sowie mögliche Präventionsmaßnahmen beleuchtet.
- Definition und Klassifikation von Adipositas
- Prävalenz von Adipositas bei Kindern und Jugendlichen
- Entstehungs- und Einflussfaktoren von Adipositas
- Gesundheitliche Folgen von Adipositas im Kindesalter
- Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Adipositas
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema Adipositas bei Kindern und Jugendlichen ein und beschreibt die wachsende Problematik in Deutschland. Es werden Statistiken zum Anstieg von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren dargestellt und die Bedeutung des Themas für die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen betont.
Definition und Klassifikation Adipositas
Dieses Kapitel erklärt den Begriff Adipositas und erläutert die Klassifikation von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen anhand des BMI (Body Mass Index). Die Unterschiede in der Berechnung des BMI bei Erwachsenen und bei Kindern und Jugendlichen werden dargestellt und die Verwendung von BMI-Referenzkurven erklärt.
Prävelenz
Dieses Kapitel beleuchtet die Häufigkeit von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Es werden statistische Daten zur Verbreitung des Problems vorgestellt, die sich auf verschiedene Altersgruppen und Geschlechter beziehen.
Entstehungs- und Einflussfaktoren
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Ursachen von Adipositas bei Kindern und Jugendlichen. Es werden verschiedene Einflussfaktoren, wie genetische Faktoren, psychische und psychosoziale Faktoren, sowie externe Faktoren wie sozioökonomische Faktoren und Fernsehkonsum, analysiert.
Gesundheitliche Bedeutung von Adipositas
In diesem Kapitel werden die gesundheitlichen Konsequenzen von Adipositas im Kindesalter erörtert. Es werden sowohl unmittelbare Folgen, wie z.B. erhöhte Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten, als auch Langzeitfolgen, wie z.B. chronische Erkrankungen im Erwachsenenalter, beleuchtet.
Schlüsselwörter
Adipositas, Übergewicht, Kinder, Jugendliche, Prävalenz, Entstehung, Einflussfaktoren, genetische Faktoren, psychische Faktoren, sozioökonomische Faktoren, Ernährungsverhalten, Fernsehkonsum, Gesundheit, Folgen, Prävention, BMI, WHO, DGE.
- Quote paper
- Julian Hauner (Author), 2016, Adipositas bei Kindern- und Jugendlichen. Einflussfaktoren, Gesundheitliche Bedeutung und mögliche Präventionsmaßnahmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375806