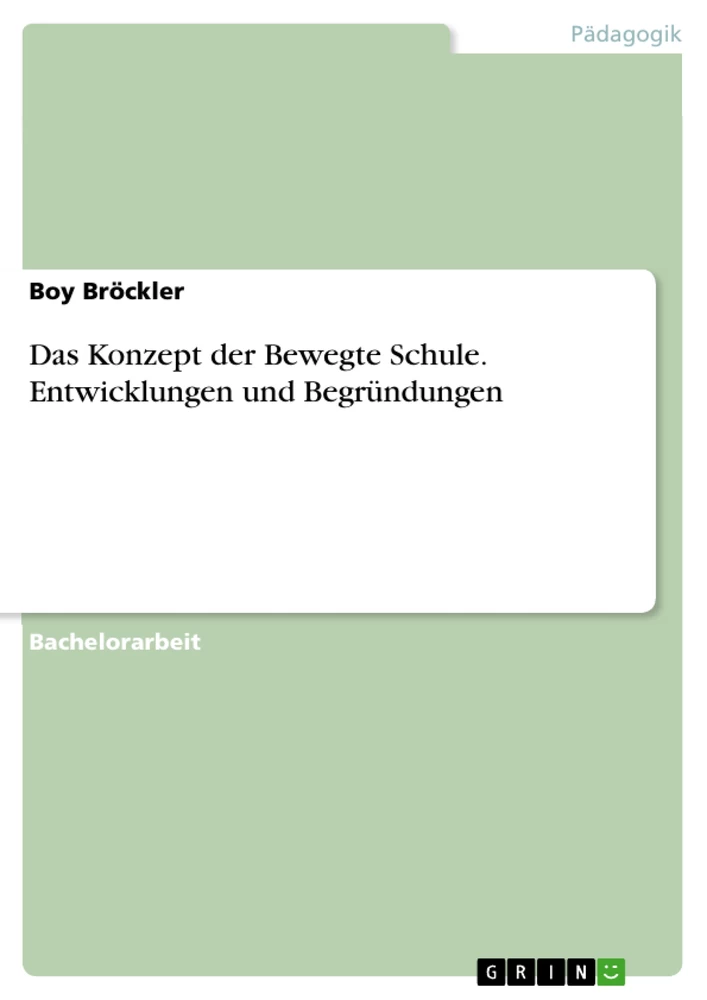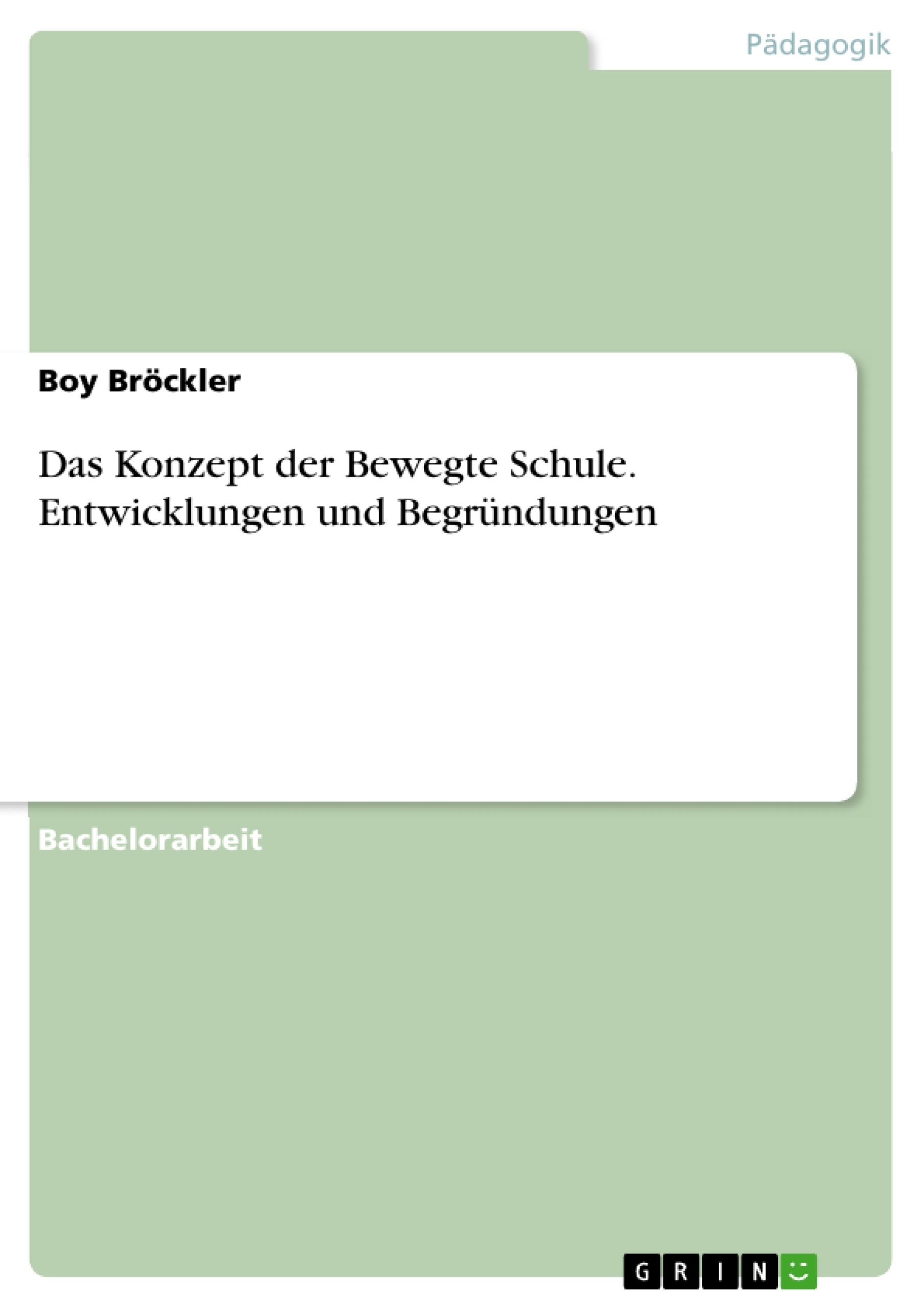Die „Bewegte Schule“ ist mittlerweile in der Schulpädagogik eine nicht mehr wegzudenkende Begrifflichkeit. Seit der Einführung der Thematik von Urs Illi Anfang der 1980er Jahre ist die „Bewegte Schule“ stets ein viel diskutiertes Thema gewesen, welches durch die zunehmende Einführung der Ganztagsschulen und die nicht endenden Diskussionen um die veränderte Lebenswelt von Kindern nie an Bedeutung verloren hat. Während sich die ersten Entwürfe zur „Bewegten Schule“ zumeist nur auf einen kleinen ausgewählten Rahmen der Schule beschränkten und auf die Grundschule ausgelegt waren, ist bis heute durch den stetigen Zuwachs von Veröffentlichungen jeglicher Art eine starke Ausweitung des Konzepts auf alle Schulbereiche und Schulformen zu verzeichnen. Lehrer aller Fachrichtungen, Pädagogen, Mediziner, Physiologen, Sportverbände und viele mehr beteiligten sich an den Diskussionen und veröffentlichten ihrerseits weitere Beiträge zur Thematik. Während einige Autoren sich darauf konzentrierten, durch Beiträge und Veröffentlichungen die Grundidee einer bewegungsfreudigen Schule zu verbreiten, versuchten andere ein eigenständiges Konzept für die „Bewegte Schule“ zu konzipieren und dieses an den Schulen zu integrieren. So ist im Laufe der Zeit eine weitreichende Beitrags- und Konzeptvielfalt entstanden, die eine einheitliche Definition der Bewegten Schule bis heute nicht ermöglicht. Trotzdem sind die Voraussetzungen so gut wie nie zuvor für das Konzept der Bewegten Schule zu sensibilisieren. Die Einführung der Ganztagsschulen und Schulprogramme bieten die Möglichkeit, der Bewegung eine neue Dimension im Schulalltag zu geben. Zudem stehen die Menschen dem Thema offener gegenüber, da die Bedeutung von Bewegung in der Bevölkerung immer mehr zunimmt.
Doch bevor ein umfassendes Bewegungsangebot an der Schule offeriert und umgesetzt werden kann, sehen sich die Verantwortlichen einer Vielzahl von Bewegungskonzepten gegenüber, die alle mehr Bewegung und ein effektiveres Lernen an der Schule versprechen. Auf den ersten Blick unterscheiden sich die Grundideen der Konzepte kaum und auch die praktischen Umsetzungen, wie z.B. das bewegte Schulleben, die bewegte Pause und das bewegte Klassenzimmer, scheinen ähnlich zu sein. Ein aufmerksamer Blick auf die Begründungsmuster zeigt jedoch, dass die Konzepte zum Teil aus sehr unterschiedlichen Intentionen entwickelt worden sind und dass diese Beweggründe die Ausrichtung, Gestaltung und Organisation einer Bewegten Schule stark beeinflussen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historische Entwicklung
- 2.2 Bewegte Schule“ als integrativer Bestandteil von Ganztagsschulen und Schulprogrammen
- 2.1 Entstehung einer Konzeptvielfalt
- 3. Gruppierter Überblick der Konzepte
- 3.1 Kompensatorische Konzepte
- 3.1.1 Kompensierende Gesundheitserziehung
- 3.1.2 Sportergänzende Bewegungserziehung
- 3.2 Bewegung als anthropologische Grundlage von Schulgestaltung und Schulentwicklung
- 3.2.1 Bewegung als Entwicklungs- und Lernförderung im Schulprogramm
- 3.2.2 Bewegungsorientierte Schulkultur
- 3.3 Abschließender Vergleich der Konzepte
- 4. Kritische Analyse der Begründungsmuster
- 4.1 Gesundheitlich kompensierendes Begründungsmuster
- 4.1.1 Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen?
- 4.1.2 Abschließende Bewertung des gesundheitlich kompensatorischen Begründungsmusters
- 4.2 Entwicklungs- und lernförderndes Begründungsmuster
- 4.2.1 Bewegung und Lernen
- 4.2.2 Bewegung und Lernen in Bezug auf die „Bewegte Schule“
- 4.2.3 Bewegung und Entwicklung
- 4.2.4 Bewegung und Entwicklung in Bezug auf die „Bewegte Schule“
- 4.3 Kulturbildendes Begründungsmuster
- 4.3.1 Schulpädagogischer Bildungsgedanke
- 4.3.2 Die Schlüsselrolle der „Schulkultur“ in der „Bewegten Schule“
- 4.3.3 Abschließende Bewertung des kulturbildenden Begründungsmusters
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Konzept der „Bewegten Schule“ mit dem Ziel, die verschiedenen Begründungsmuster der verschiedenen Konzepte zu untersuchen und auf ihre Berechtigung hin zu hinterfragen. Dies erfolgt vor dem Hintergrund der steigenden Bedeutung von Bewegung im schulischen Alltag und der wachsenden Anzahl von Bewegungskonzepten, die unterschiedliche Intentionen verfolgen.
- Historische Entwicklung des Konzepts der „Bewegten Schule“
- Vielfalt der Konzepte der „Bewegten Schule“ und deren Begründungsmuster
- Kritik an den Begründungsmustern und deren theoretischer Fundierung
- Relevanz der „Bewegten Schule“ im Kontext von Ganztagsschulen und Schulprogrammen
- Bedeutung von Bewegung für Entwicklung und Lernen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer historischen Entwicklungsübersicht des Konzepts der „Bewegten Schule“ und beleuchtet die Entstehung einer Vielzahl an Konzepten. Im Anschluss erfolgt eine gruppierte Darstellung der populärsten Konzepte, wobei kompensatorische Konzepte wie die kompensierende Gesundheitserziehung und die sportergänzende Bewegungserziehung sowie Konzepte, die Bewegung als anthropologische Grundlage von Schulgestaltung und Schulentwicklung betrachten, näher beleuchtet werden. Im dritten Kapitel erfolgt eine kritische Analyse der Begründungsmuster der verschiedenen Konzepte. Hierbei werden die gesundheitlich kompensierenden, die entwicklungs- und lernfördernden sowie die kulturbildenden Begründungsmuster analysiert und auf ihre Berechtigung hin hinterfragt.
Schlüsselwörter
Bewegte Schule, Bewegungskonzepte, Begründungsmuster, Ganztagsschule, Schulprogramm, Bewegungsmangel, Entwicklung, Lernen, Schulkultur, Gesundheitserziehung, Sportergänzende Bewegungserziehung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Grundkonzept der „Bewegten Schule“?
Es handelt sich um ein pädagogisches Konzept, das Bewegung als integralen Bestandteil des Schulalltags sieht, um Lernen und Entwicklung zu fördern.
Wann entstand die Idee der Bewegten Schule?
Die Thematik wurde Anfang der 1980er Jahre von Urs Illi eingeführt und hat seitdem stetig an Bedeutung gewonnen.
Welche verschiedenen Konzepte der Bewegten Schule gibt es?
Man unterscheidet zwischen kompensatorischen Modellen (Gesundheitserziehung) und Ansätzen, die Bewegung als anthropologische Grundlage der Schulentwicklung sehen.
Warum gibt es keine einheitliche Definition?
Aufgrund der Vielfalt an beteiligten Fachrichtungen (Pädagogen, Mediziner, Sportverbände) sind sehr unterschiedliche Begründungsmuster und Intentionen entstanden.
Welche Rolle spielt die Ganztagsschule für dieses Konzept?
Ganztagsschulen bieten den zeitlichen Rahmen, um Bewegung über das bewegte Klassenzimmer und die Pause hinaus in den gesamten Schulalltag zu integrieren.
- Citar trabajo
- Boy Bröckler (Autor), 2015, Das Konzept der Bewegte Schule. Entwicklungen und Begründungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375858