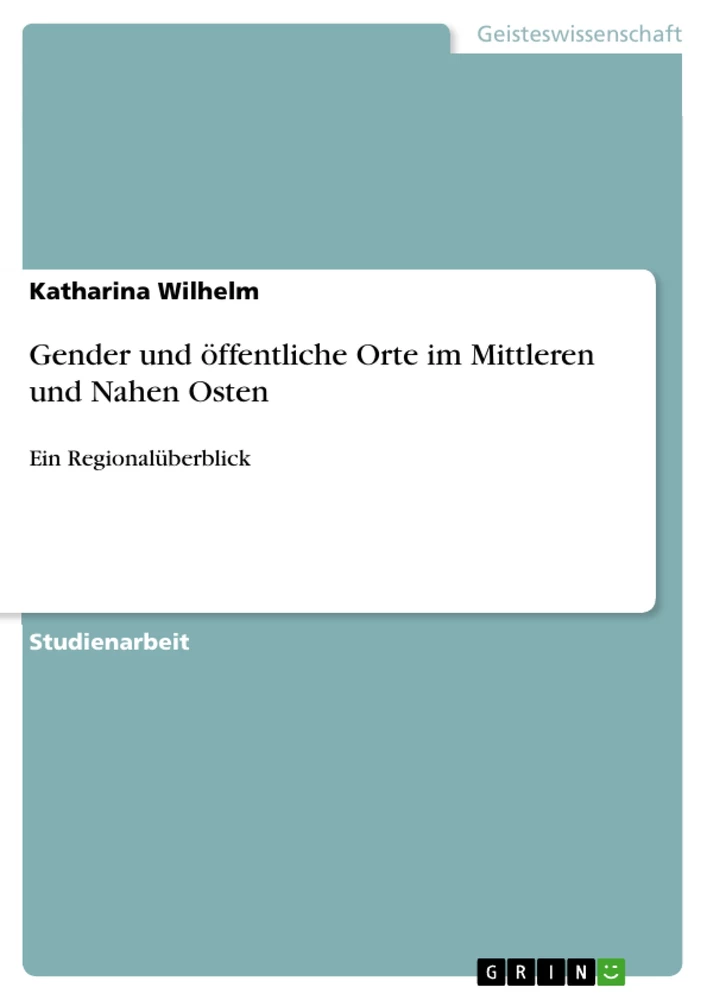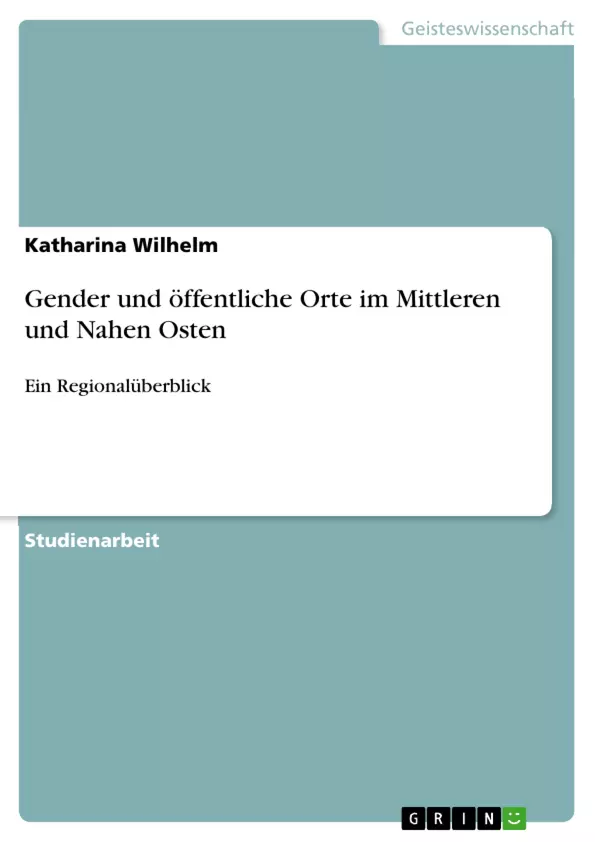Diese Hausarbeit versucht folgende Fragen zu beantworten: Welche Rollen haben Frauen und Männer im Mittleren und Nahen Osten in der Öffentlichkeit inne? Wie unterscheidet sich ihr Verhalten in diesem Bereich und inwiefern wird dieses von der Gesellschaft bzw. ihren Familien beeinflusst? Kann man ihre Rollen an öffentlichen Orten überhaupt pauschal unterscheiden, oder gibt es hier Ähnlichkeiten oder gar Schnittpunkte zwischen den beiden Geschlechtern?
Die Autorin wird sich auf drei ethnographische Beispiele beziehen, um von diesen konkreten Fällen zu allgemeineren Aussagen zu gelangen. Bei diesen Beispielen handelt es sich vor allem um Untersuchungen zu Märkten (suqs) im Mittleren und Nahen Osten. Die Autorin wird sich also hauptsächlich auf den suq als öffentlichen Ort beziehen und hierbei besonders das weibliche Geschlecht betrachten: Welche Rolle spielen Frauen in diesen Märkten und was für eine Rolle haben diese Märkte wiederum im Leben der Frauen inne?
Zunächst wird eine These auf allgemeinerer Ebene untersucht, die bisherige Forschungsansätze zu diesem Thema hervorgebracht haben und die in dieser Arbeit auch in Frage gestellt werden: der Bereich des Privaten wurde oft als Welt der Frau gesehen, während der öffentliche Bereich dem Mann zugeschrieben wurde. Anhand von Arbeiten wie dem Werk Levi-Strauss‘ und u.a. Jeff Weintraubs Gedanken zu dem Thema wird versucht, diese vermeintliche Dichotomie zunächst allgemeiner zu betrachten, um dann im Folgenden durch die Fallbeispiele aus der Region Mittlerer und Naher Osten (v.a. also durch den Markt als öffentlicher Ort in Bezug zur Frau) zu einer Aussage zu dieser These zu gelangen. Als erstes Beispiel wird Farha Ghannams Forschung in al-Zawiya al-Hamra in Kairo herangezogen. Hier wird zunächst beschrieben, was sie allgemein zum Thema Gender, Privatsphäre und öffentliche Orte in al-Zawiya al-Hamra beobachtet hat. Dann konzentriert sich die Arbeit auf zwei öffentliche Orte, die sie näher untersucht und mit den beiden Geschlechtern verbunden hat, um hier bereits die beschriebene These der Dichotomie zu überprüfen: der suq als frauendominierter Ort und der coffee shop als vermeintliche Sphäre der Männer.
Die Arbeit fokussiert sich hauptsächlich auf Frauen und ihre Rolle in öffentlichen Orten und streife die männliche Perspektive nur anhand von zwei Beispielen, eines davon Ende der 1970er-Jahre niedergeschrieben, um sie mit der der Frauen in Kontrast zu setzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bereich des Privaten als Welt der Frau, Bereich des Öffentlichen als Welt des Mannes - eine Dichotomie?
- Gender in al-Zawiya al-Hamra
- Gender, Privatsphäre und öffentliche Orte in al-Zawiya al-Hamra
- Der suq und die Frauen
- Der coffee shop und die Männer
- Suqs und Gender in Marokko - wer dominiert den Markt?
- Der suq in Sefrou - eine Männerdomäne
- Frauen auf Marokkos Märkten
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Rolle von Frauen und Männern im öffentlichen Raum im Mittleren und Nahen Osten, insbesondere in Bezug auf die Dichotomie von Privatsphäre und Öffentlichkeit. Der Fokus liegt auf der Analyse von Märkten (suqs) als öffentlichen Orten und der Rolle von Frauen in diesen Märkten.
- Untersuchung der These, dass der private Bereich als Welt der Frau und der öffentliche Bereich als Welt des Mannes betrachtet wird
- Analyse von ethnographischen Beispielen aus Kairo und Marokko
- Beurteilung der Rolle von Frauen in öffentlichen Märkten
- Bedeutung von suqs für das Leben der Frauen
- Kritik an vereinfachenden Konzepten von Geschlechterrollen im öffentlichen Raum
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Einführung in die Fragestellung und die Methodik der Arbeit, mit Fokus auf die Rolle von Frauen in öffentlichen Orten im Mittleren und Nahen Osten, insbesondere Märkten (suqs).
- Bereich des Privaten als Welt der Frau, Bereich des Öffentlichen als Welt des Mannes – eine Dichotomie?: Analyse der Dichotomie von Privatsphäre und Öffentlichkeit, basierend auf Arbeiten von Levi-Strauss, Weintraub, Gobetti, Cohen, Wolfe und Hansen. Diskussion der Ambivalenz und soziohistorischen Bedingtheit dieses Konzepts.
- Gender in al-Zawiya al-Hamra: Beschreibung der Ergebnisse von Farha Ghannams Forschung in Kairo, die sich mit Gender, Privatsphäre und öffentlichen Orten in al-Zawiya al-Hamra beschäftigt. Analyse von Ghannams Beobachtungen zum suq als frauendominiertem Ort und dem coffee shop als vermeintliche Sphäre der Männer.
- Suqs und Gender in Marokko - wer dominiert den Markt?: Untersuchung der Arbeiten von Clifford Geertz und Deborah zweiten Landes, um die These der Dichotomie im marokkanischen Kontext zu hinterfragen. Analyse der Rolle von Frauen auf Marokkos Märkten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf Themen wie Gender, Privatsphäre und Öffentlichkeit, Frauenrollen in öffentlichen Orten, suqs im Mittleren und Nahen Osten, Ethnographie, Dichotomie, soziokulturelle Unterschiede, und die Bedeutung von Märkten für das Leben von Frauen.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es im Nahen Osten eine strikte Trennung von privat und öffentlich?
Die Arbeit hinterfragt die klassische Dichotomie, nach der das Private nur weiblich und das Öffentliche nur männlich sei, und zeigt Schnittpunkte auf.
Welche Rolle spielen Frauen auf den Märkten (Suqs)?
Anhand von Beispielen aus Kairo (al-Zawiya al-Hamra) wird gezeigt, dass der Suq oft ein frauendominierter Ort ist, der für das soziale Leben der Frauen zentral ist.
Sind Coffee Shops reine Männersphären?
In vielen Regionen gelten Coffee Shops als traditionelle Sphären der Männer, in denen soziale Netzwerke und politische Diskurse gepflegt werden.
Wie unterscheidet sich die Situation in Marokko?
Untersuchungen in Sefrou zeigen, dass dort der Suq teilweise als Männerdomäne wahrgenommen wurde, was die soziohistorische Bedingtheit von Geschlechterrollen unterstreicht.
Wie beeinflussen Familien das Verhalten in der Öffentlichkeit?
Das Verhalten von Männern und Frauen wird stark durch gesellschaftliche Erwartungen und familiäre Ehrkonzepte geprägt, die den Zugang zu bestimmten Orten regeln.
- Citation du texte
- Katharina Wilhelm (Auteur), 2013, Gender und öffentliche Orte im Mittleren und Nahen Osten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375978