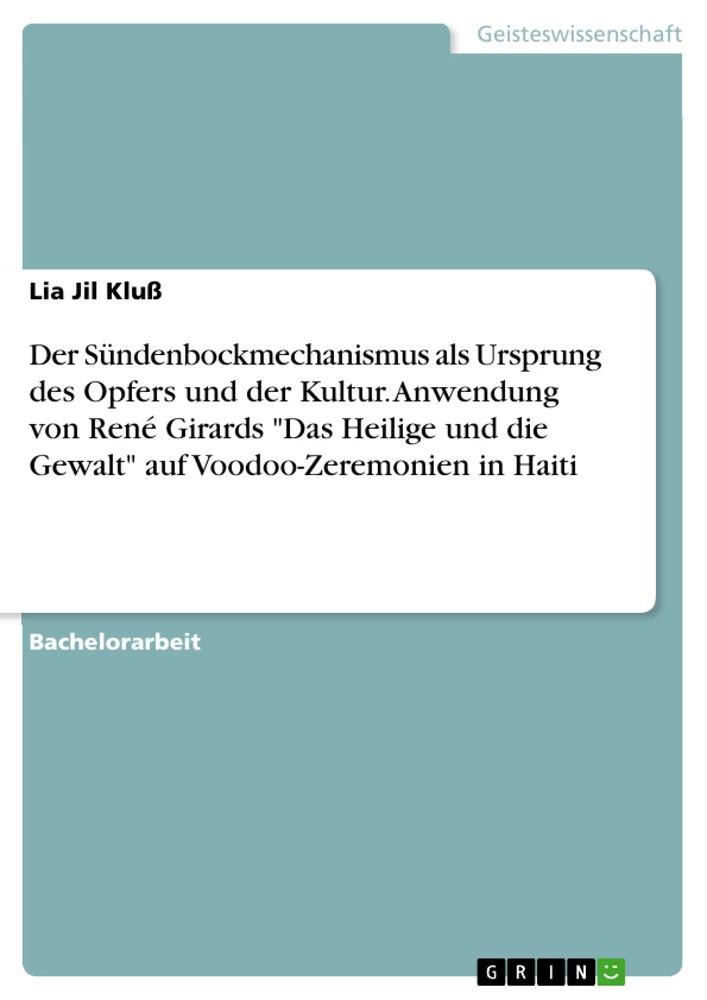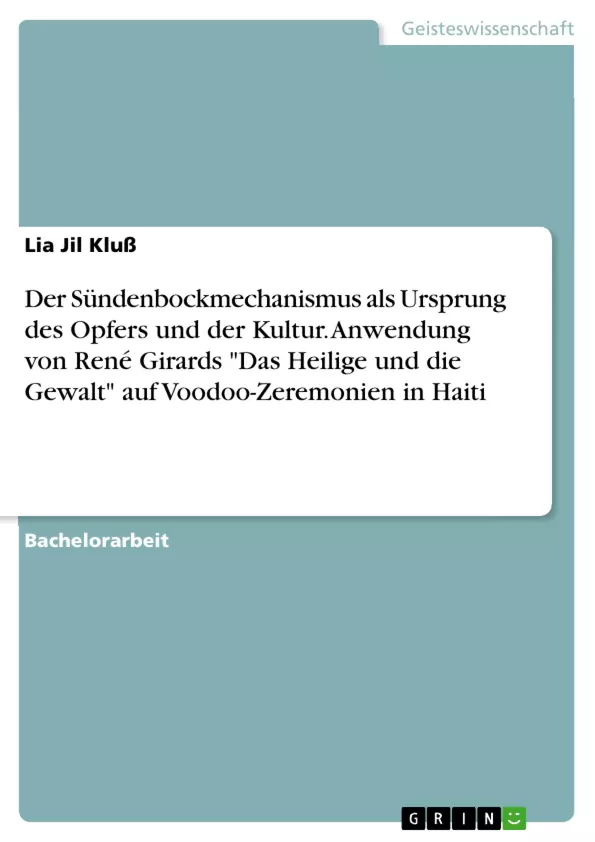Die vorliegende Arbeit verschafft einen kritischen Überblick von René Girards allgemeiner Kulturtheorie, inklusive einer Anwendung seiner Thesen auf ein Ritual im haitianischen Voodoo.
Das Verhältnis von Religion und Gewalt ist ein viel und kontrovers diskutiertes Thema von großem öffentlichen Interesse. Im Mittelpunkt des Diskurs zur Korrelation von Religion und Gewalt steht oft die religiöse Praxis der Blutopfers. In der Reihe der Opfertheorien gliedert sich zwischen Marcel Mauss, Sigmund Freud und Walter Burkert der Literaturwissenschaftler René Girard ein, der Erkenntnisse und Materialien aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen kombiniert. Girards Theorie ist insofern interessant, als dass sie nicht nur eine Theorie über das Verhältnis von Religion und Gewalt ist, sondern auch deutlich macht, welche Rolle die Religion ganz allgemein für das soziale Miteinander der Menschen spielt.
In dieser Arbeit wird René Girards Theorie, mit besonderer Betrachtung seines Werks "Das Heilige und die Gewalt", vorgestellt. Ein grundlegendes Verständnis der mimetischen Theorie ist unabdingbar, um Girards These zu verstehen. Daher steht eine knappe Zusammenfassung der mimetischen Zusammenhänge am Anfang der Ausführungen über Girard. Ihr folgt die Erläuterung des Sündenbockmechanismus, der für Girard das Ende der gegenseitigen Gewalt und gleichzeitig den Ursprung der Kulturen und Religionen ausmacht. Was diese ersten Formen von Religion und Kultur ausgemacht haben, wird daraufhin erörtert.
Auf die Darstellung Girards Theorie folgt der Versuch, ethnographisches Material - hier eine Zeremonie im haitianischen Voodoo - nach seinem Modell auszuwerten. Ein kritisches Fazit erlaubt, die Möglichkeiten und Grenzen von Girards Theorie anzuerkennen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- René Girard - Leben und Werk
- Das Heilige und die Gewalt
- Das mimetische Begehren
- Der Sündenbockmechanismus
- Das Opfer, die Mythen und die Verbote
- Das Heilige und die Gewalt im Voodoo
- Voodoo in Haiti
- Pantheon und Praxis
- Voodoo-Zeremonie
- Fazit und Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit René Girards Theorie über das Heilige und die Gewalt, insbesondere im Kontext des Sündenbockmechanismus. Ziel ist es, Girards These anhand von ethnographischem Material aus dem haitianischen Voodoo zu überprüfen und zu bewerten.
- Das mimetische Begehren als Grundlage sozialer Interaktion
- Der Sündenbockmechanismus als Ursprung von Religion und Kultur
- Die Rolle des Opfers in der Überwindung von Gewalt
- Die Verbindung von Ritual und Opfer im haitianischen Voodoo
- Die Relevanz und Grenzen von Girards Theorie für das Verständnis von Religion und Gewalt
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit thematisiert das Verhältnis von Religion und Gewalt anhand aktueller Ereignisse und stellt René Girards Theorie als einen wichtigen Ansatz zur Erklärung dieses Phänomens vor.
- René Girard - Leben und Werk: Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über Girards Leben und Werk, wobei sein Interesse an der Geschichte des Mittelalters und seine Dissertation über das private Leben in Avignon hervorgehoben werden.
- Das Heilige und die Gewalt: Hier werden die zentralen Elemente von Girards Theorie vorgestellt, darunter das mimetische Begehren, der Sündenbockmechanismus und die Rolle des Opfers in der Entstehung von Religion und Kultur.
- Das Heilige und die Gewalt im Voodoo: In diesem Kapitel werden die Geschichte, das Pantheon und die Praxis des Voodoo in Haiti erläutert, um die Anwendung von Girards Theorie auf eine konkrete religiöse Tradition zu ermöglichen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Religion, Gewalt, Opfer, Sündenbockmechanismus, mimetisches Begehren, Voodoo, Haiti, Kultur, Sozialanthropologie, Religionswissenschaft und René Girard. Girards Theorie bietet einen interdisziplinären Ansatz zur Untersuchung des Verhältnisses von Religion und Gewalt, der die Rolle des Opfers als zentralen Mechanismus für die Stabilisierung und den Fortbestand von Kulturen und Religionen hervorhebt.
- Citar trabajo
- Lia Jil Kluß (Autor), 2017, Der Sündenbockmechanismus als Ursprung des Opfers und der Kultur. Anwendung von René Girards "Das Heilige und die Gewalt" auf Voodoo-Zeremonien in Haiti, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376068