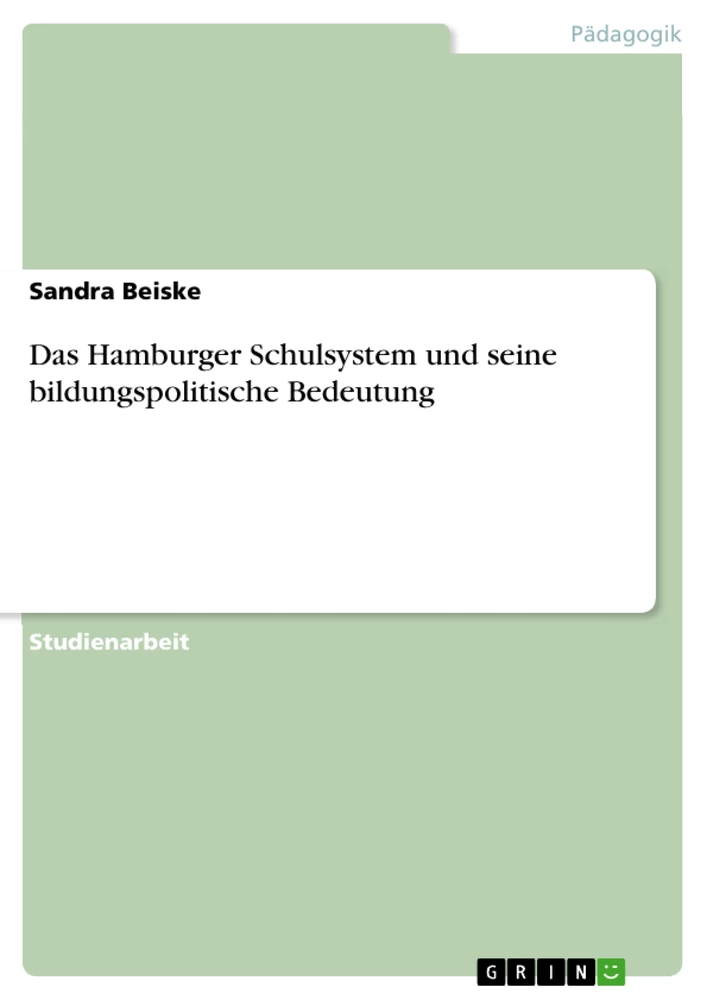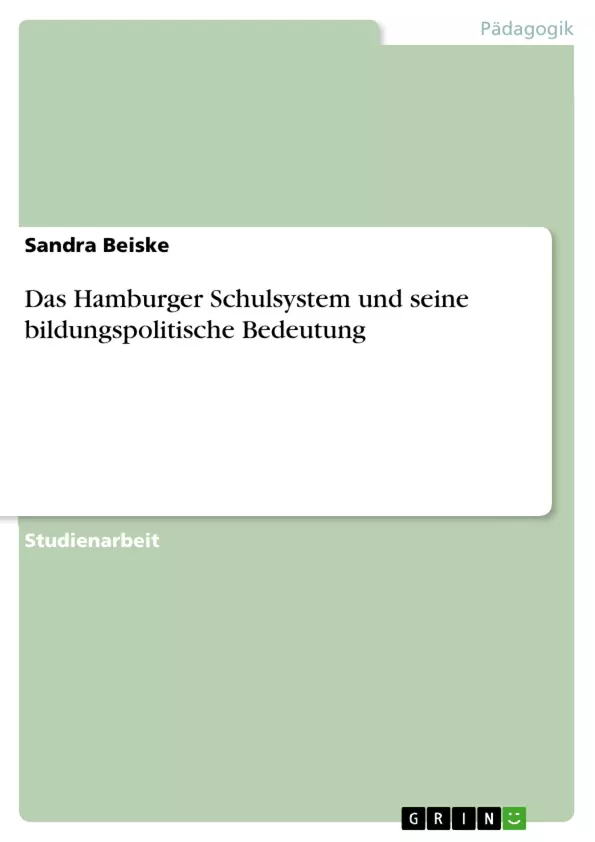Seit der ersten PISA-Studie aus dem Jahr 1999 befindet sich die Bildungslandschaft in Deutschland im Umbruch. Die Lehrpläne postulierten eine konsequente Kompetenzausrichtung und stärkere Schülerorientierung mit dem Leitgedanken "etwas fürs Leben zu lernen". Dies bedeutet, dass Kinder und Jugendliche im Laufe ihres Schullebens verschiedene Fähig- und Fertigkeiten entwickeln sollen, die sie dann im späteren (Berufs-)Leben anwenden können. Diese Kompetenzorientierung hat zur Folge, dass Schule sich an erzielten Ergebnissen ihrer Schüler und Schülerinnen messen lassen muss.
Es geht um die Erreichung von definierten Zielen und die Frage, wie Schule sich in Richtung auf dieses Ziel hin entwickeln kann. Dabei müssen erst einmal Erfolge oder Misserfolge sichtbar gemacht werden, um auf dieser Basis neue Maßnahmen für mehr Effizienz und Effektivität im Schulbereich zu entwickeln und implementieren.
Weil die Lehrpläne in einer neuen Leitlinie seit 1999 eine stärkere OutputOrientierung fordern, gilt es, das Lernangebot der Schule nicht mehr nur an Lehrplänen, Erlassen und Stundendeputaten auszurichten, sondern vielmehr zu berücksichtigen, welche Wirkung der Unterricht auf die Leistung der Schüler und Schülerinnen hat und welche Konsequenzen daraus folgen. Hierzu kann Schule auf die Methoden der freien Wirtschaft zurückgreifen und sich der Methoden des Qualitätsmanagements und der Evaluation bedienen. Damit ist gemeint, dass Unterricht nach der Qualität der Leistungen, der Akzeptanz bei Schülerinnen und Schülern und nach dem Klassenklima beurteilt werden sollte.
Diese Arbeit zum Thema "Evaluation von Unterricht zur Stärkung von Unterrichtsqualität" soll zunächst die Begriffe Evaluation und Qualitätsmanagement klären und in den Kontext Schule einordnen. Im nächsten Schritt werden unterschiedliche Perspektiven und Möglichkeiten, Unterricht zu evaluieren, vorgestellt. Abschließend soll der Fragestellung nachgegangen werden, welchen Nutzen und welche möglichen Auswirkung Evaluationsergebnisse aus dem Unterricht haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Qualitätsmanagement und Evaluation
- Begriffsklärung
- Evaluationskreislauf
- Einordnung der Evaluation in den Kontext Schule
- Abgrenzung des Begriffes Evaluation von anderen Beurteilungs- konzepten
- Möglichkeiten und Instrumente der Evaluation von Unterricht
- Evaluation unter dem Aspekt des Initiators
- Interne Evaluation
- Externe Evaluation
- Evaluation unter dem Aspekt der Durchführung
- Prozessorientierte Evaluation
- Ergebnisorientierte Evaluation
- Beispiel einer Evaluation
- Evaluation unter dem Aspekt des Initiators
- Nutzen der Evaluation für den Unterricht
- Nutzen der internen Evaluation für den Unterricht
- Nutzen der externen Evaluation für den Unterricht
- Umsetzung von Qualitätsmanagement und Evaluation
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung analysiert die Rolle von Qualitätsmanagement und Evaluation im Kontext der schulischen Bildungslandschaft. Sie beleuchtet die Entwicklungen seit der ersten PISA-Studie und deren Einfluss auf die Lehrpläne und die Notwendigkeit einer stärkeren Kompetenzorientierung im Unterricht.
- Die Bedeutung von Qualitätsmanagement und Evaluation für die Steigerung der Unterrichtsqualität.
- Die unterschiedlichen Perspektiven und Möglichkeiten der Evaluation von Unterricht.
- Der Nutzen und die Auswirkungen von Evaluationsergebnissen für den Unterricht.
- Die Einordnung der Evaluation in den Kontext Schule und die Abgrenzung zu anderen Beurteilungsformen.
- Die Relevanz von Effizienz- und Effektivitätssteigerung im Schulbereich.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Evaluation von Unterricht zur Stärkung von Unterrichtsqualität ein und beleuchtet den Wandel der Bildungslandschaft seit der PISA-Studie.
Das zweite Kapitel behandelt die Begriffe Qualitätsmanagement und Evaluation im Detail, wobei insbesondere die Begriffsklärung, der Evaluationskreislauf und die Einordnung der Evaluation in den Kontext Schule im Fokus stehen.
Das dritte Kapitel widmet sich verschiedenen Perspektiven und Möglichkeiten der Evaluation von Unterricht, indem es unterschiedliche Aspekte wie den Initiator und die Durchführung der Evaluation beleuchtet.
Das vierte Kapitel untersucht den Nutzen der Evaluation für den Unterricht, wobei sowohl die interne als auch die externe Evaluation betrachtet werden.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter dieser Ausarbeitung sind Qualitätsmanagement, Evaluation, Unterrichtsqualität, Kompetenzorientierung, PISA-Studie, Evaluationskreislauf, interne Evaluation, externe Evaluation, Prozessorientierte Evaluation, Ergebnisorientierte Evaluation, Effizienz, Effektivität, Schulentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Evaluation im Schulsystem heute so wichtig?
Seit der PISA-Studie 1999 gibt es einen Wandel hin zur Ergebnisorientierung (Output-Orientierung), wodurch Schulen ihre Qualität messbar machen müssen.
Was ist der Unterschied zwischen interner und externer Evaluation?
Interne Evaluation wird von der Schule selbst initiiert, während externe Evaluation durch schulfremde Personen oder Institutionen durchgeführt wird.
Welche Rolle spielt Qualitätsmanagement in Schulen?
Qualitätsmanagement hilft Schulen, systematische Prozesse zur Verbesserung von Unterrichtsqualität und Klassenklima zu implementieren.
Was versteht man unter dem Evaluationskreislauf?
Es handelt sich um einen wiederkehrenden Prozess aus Zielsetzung, Datenerhebung, Analyse und der Ableitung von Verbesserungsmaßnahmen.
Wie beeinflusst die Kompetenzorientierung den Unterricht?
Der Fokus liegt nicht mehr nur auf dem Lehrstoff, sondern auf den Fähigkeiten, die Schüler für ihr späteres Leben und den Beruf entwickeln.
- Arbeit zitieren
- Sandra Beiske (Autor:in), 2014, Das Hamburger Schulsystem und seine bildungspolitische Bedeutung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376240