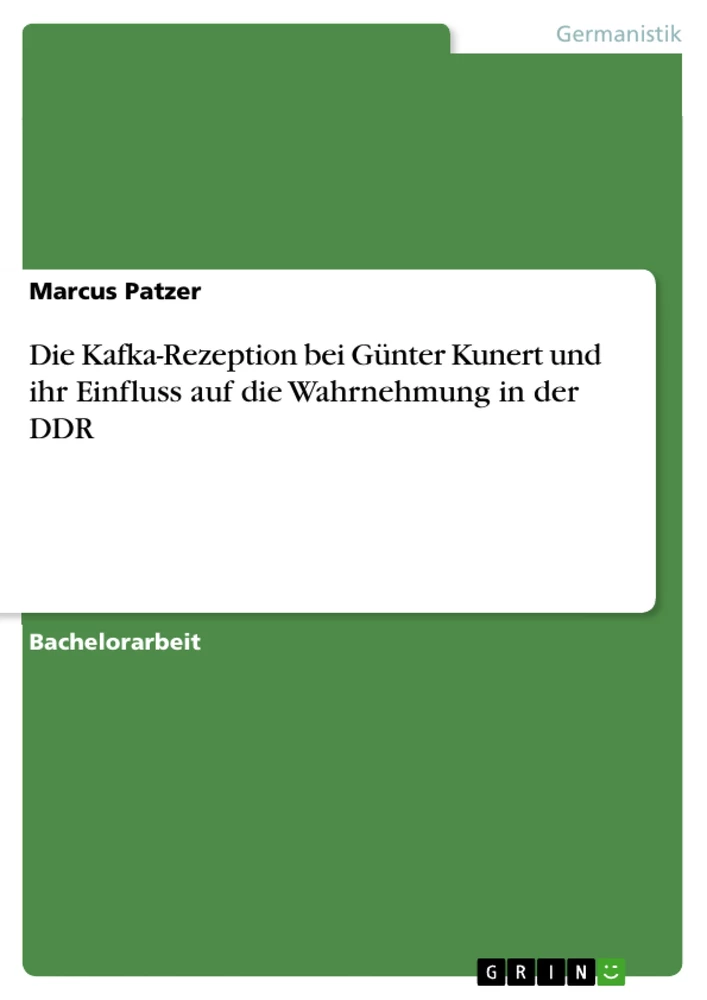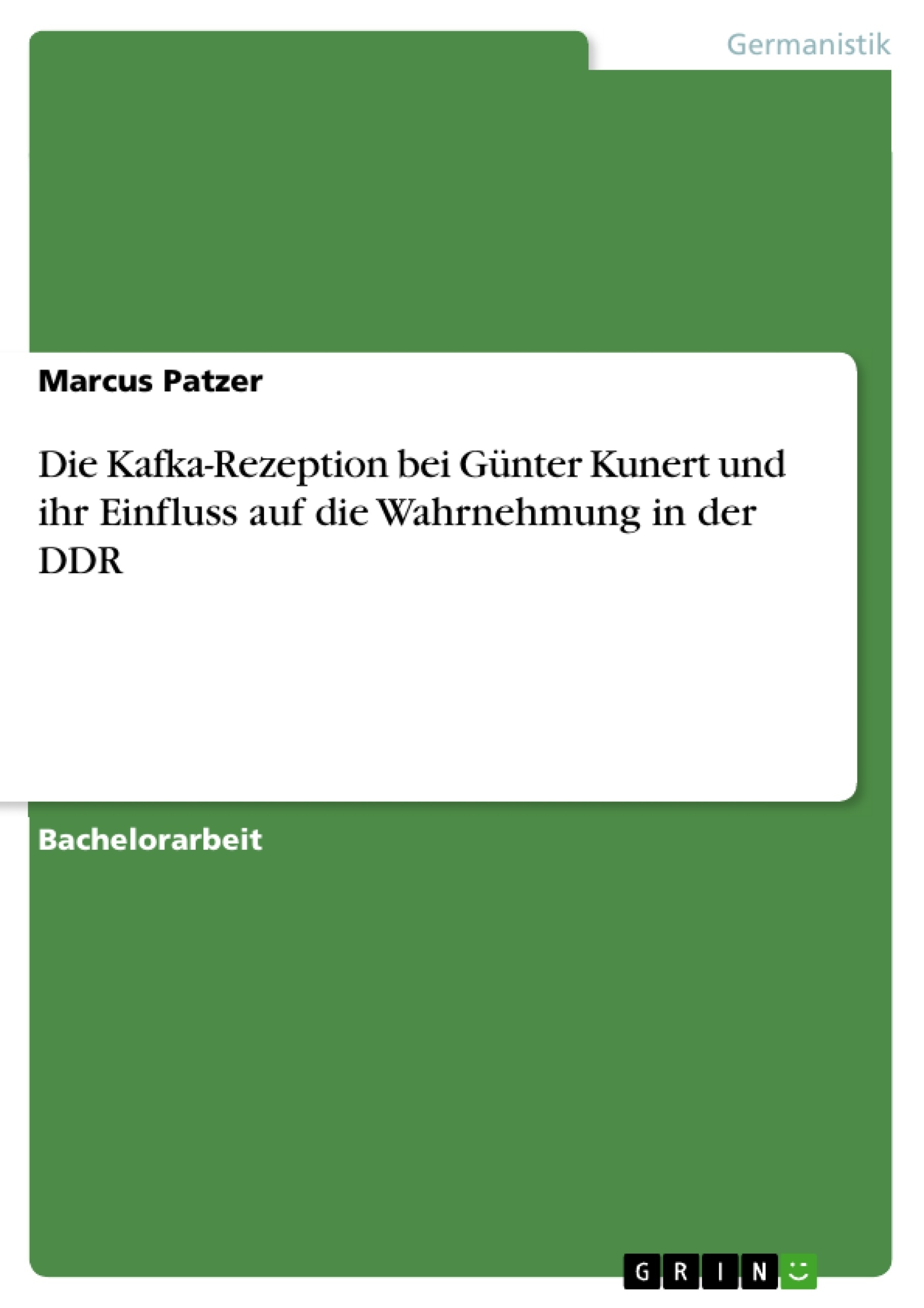In dieser Arbeit sollen mehrere Fragen zur Kafka-Rezeption bei Günter Kunert untersucht werden. Welche Rolle spielt Günter Kunert innerhalb der Kafka-Rezeption in der DDR und auf welche Weise hat er Kafkas Texte für sein eigenes Schreiben genutzt? Lassen sich demnach einfache intertextuelle Bezüge erkennen oder üben sogar ganze Kafkasche Stimmungsräume einen Einfluss auf Kunerts Schreiben aus?
Jedes gelesene Wort, jeder Satz und jedes Buch haben eine starke Auswirkung auf das, was man als Künstler in einem neuen Werk produziert. In der Literaturwissenschaft wird das als Intertextualität bezeichnet. Über diese lässt sich erkennen, wie stark beispielsweise ein Autor wie Günter Kunert Schriften eines Franz Kafka gelesen, verarbeitet und möglicherweise für sein eigenes Werk genutzt hat. Besondere Relevanz erhält jene Problematik vor dem Hintergrund der Kafka-Rezeption in der DDR.
Inhaltsverzeichnis
- Themenbegründung
- Kafkas,,Erbe“ oder „ein anderer K.“: Zur Spezifik der Kafka-Rezeption bei Günter Kunert am Beispiel ausgewählter Werke von 1960 bis 1975
- Forschungsstand
- Zur Spezifik des Kafkaschen Schreibens
- Zur Kafka-Rezeption in der DDR
- Gab es eine Kafka-Rezeption in der DDR?
- Zur Kafka-Rezeption bei Günter Kunert
- Eine kurze Darstellung des Lebens und Wirkens von Günter Kunert in der DDR
- Zur Spezifik des Werks von Günter Kunert (1960 bis 1975)
- Zusammenfassung
- Analysen
- Interfragmentarium (zu Franz K.s Werk), 1962
- Zentralbahnhof, 1968
- Dornröschen, 1973
- Schluss
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Rezeption des Werks von Franz Kafka bei Günter Kunert im Kontext der DDR-Literatur. Sie zielt darauf ab, die spezifischen Merkmale dieser Rezeption herauszuarbeiten und zu analysieren, wie Kunert Kafkas Texte in seinen eigenen Werken verarbeitet und integriert hat.
- Die Rolle Günter Kunerts innerhalb der Kafka-Rezeption in der DDR.
- Intertextuelle Bezüge zwischen Kafkas Texten und den Werken von Günter Kunert.
- Die Spezifik des Kafkaschen Schreibens und dessen Einfluss auf Kunerts Werk.
- Die Rezeption von Kafka in der DDR, insbesondere die Frage nach der Abwesenheit oder Geringfügigkeit der Auseinandersetzung mit Kafkas Werk.
- Die späte Frühphase von Günter Kunert (1960-1975) und deren Bedeutung für die Rezeption von Kafka.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Themenbegründung und führt den Leser in die Problematik der Kafka-Rezeption bei Günter Kunert im Kontext der DDR-Literatur ein. Das zweite Kapitel widmet sich dem Forschungsstand und analysiert die Spezifik des Kafkaschen Schreibens, die Rezeption von Kafka in der DDR und insbesondere die Rolle von Günter Kunert innerhalb dieser Rezeptionsgeschichte.
Im dritten Kapitel werden drei ausgewählte Werke von Günter Kunert aus der späten Frühphase (1960-1975) analysiert: "Interfragmentarium (zu Franz K.s Werk)", "Zentralbahnhof" und "Dornröschen". Anhand dieser Analysen werden intertextuelle Bezüge zu Kafkas Texten untersucht und die Frage beantwortet, ob Kafkasche Stimmungsräume einen Einfluss auf Kunerts Schreiben haben.
Die Ergebnisse und Schlüsse dieser Untersuchung werden im vierten Kapitel, dem Schluss, präsentiert.
Schlüsselwörter
Kafka-Rezeption, Günter Kunert, DDR-Literatur, Intertextualität, Kafkasches Schreiben, späte Frühphase, "Interfragmentarium", "Zentralbahnhof", "Dornröschen".
Häufig gestellte Fragen zur Kafka-Rezeption bei Günter Kunert
Wie beeinflusste Franz Kafka das Werk von Günter Kunert?
Kunert nutzte Kafkas Texte als intertextuelle Bezugspunkte und übernahm oft die typisch 'kaffkaesken' Stimmungsräume von Entfremdung und bürokratischer Beklemmung in seine eigenen Schriften.
War Kafka in der DDR offiziell anerkannt?
Die Kafka-Rezeption in der DDR war lange Zeit problematisch und von ideologischen Vorbehalten geprägt, da seine Werke oft als zu pessimistisch oder dekadent für das sozialistische Menschenbild galten.
Was bedeutet Intertextualität in diesem Zusammenhang?
Es beschreibt die Beziehung zwischen Kunerts Texten und den Werken Kafkas, wobei Kunert Zitate, Motive oder Strukturen von Kafka verarbeitet und in neue Kontexte setzt.
Welche Werke Kunerts sind besonders von Kafka geprägt?
Analysen zeigen starke Bezüge in Werken wie 'Interfragmentarium' (1962), 'Zentralbahnhof' (1968) und 'Dornröschen' (1973).
Was ist das Besondere an Kunerts Kafka-Bild?
Kunert sah in Kafka nicht nur ein literarisches Vorbild, sondern einen Seismographen für die existenziellen Nöte des Individuums in modernen Machtstrukturen.
- Quote paper
- Marcus Patzer (Author), 2011, Die Kafka-Rezeption bei Günter Kunert und ihr Einfluss auf die Wahrnehmung in der DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376334