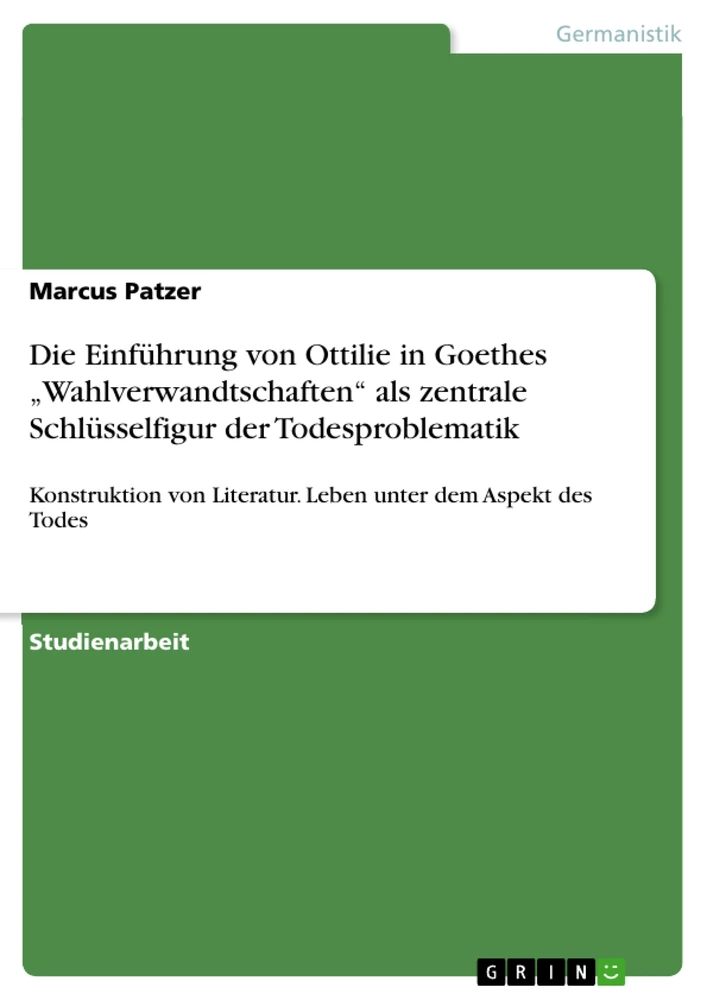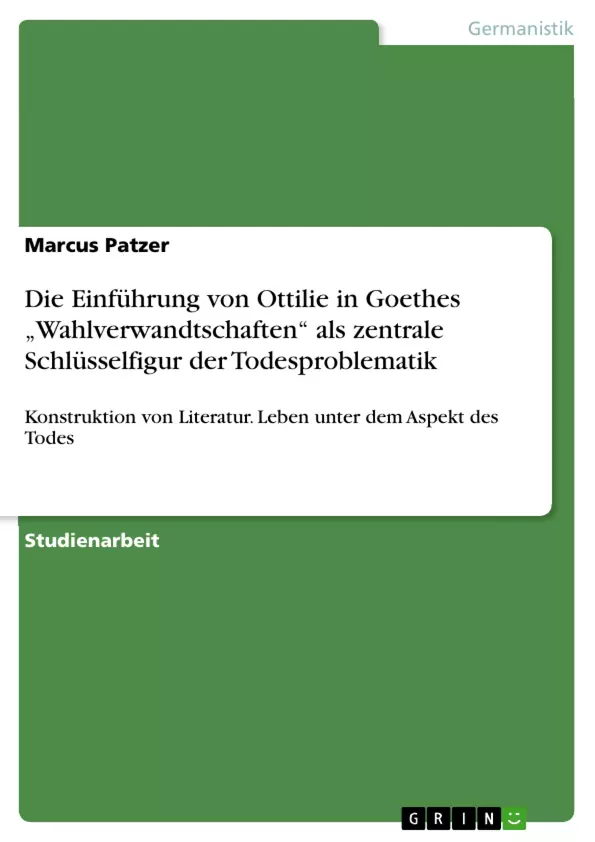Liebe ist ein zentraler Bestandteil des Lebens, wenn nicht sogar der zentralste. Schon immer sind Menschen auf der Suche nach dem Sinn des Lebens: Warum leben wir? Was ist unsere Bestimmung, was unser Ziel? Und ist es nicht eine befriedigende Antwort, wenn wir sagen: Liebt man wirklich aufrichtig und wird man auch so geliebt, dann hat man den Sinn des Lebens zu einem nicht unwichtigen Teil erkannt. Aus diesem Grund ist die Liebe auch immer wieder ein Thema in der Literatur; egal, in welche Epoche man schaut, egal, in welchen Kulturkreis man blickt: Liebe wird immer verarbeitet, da sie allgegenwärtig ist. Doch die Liebe tritt nicht immer nur allein auf. Häufig hat sie einen Mitspieler – einen mindestens genauso zentralen Begriff: den Tod. Denn genau wie die Liebe gehört auch der Tod als ein fester Bestandteil zum Leben. Und so finden sich auch in der Literatur immer wieder Bilder, die Beispiele für die Verbindung dieser beiden Begriffe darstellen: Romeo und Julia, die erst im Tode endgültig zueinander finden; auch Tristan und Isolde trifft ein ähnliches Schicksal. Werther begeht Selbstmord, weil es ihm unmöglich erscheint, seine Liebe zu Lotte erfüllt zu sehen und auch in seinen „Wahlverwandtschaften“ liefert Goethe eines der wohl eindrücklichsten und intensivsten Todessymbole der Weimarer Klassik, wenn nicht gar überhaupt - Ottilie. Das besondere an ihr ist, dass sich ihr Sterben über das gesamte Werk erstreckt, sehr zäh und quälend dargestellt wird und schließlich im Tod sein Ergebnis findet. Doch kann man sogar so weit gehen und sagen, dass dieser schon zu Beginn des Romans in der betont indirekten Einführung von Ottilie über die Briefe der Vorsteherin und ihres Gehilfen angelegt ist?
In dieser Arbeit soll eben diese Frage in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt werden: Eine Analyse der beiden Briefe, der Vorsteherin und des Gehilfen, soll klären, in wie weit eine bewusste Konstruktion der notwendigen Elemente, die zum Tod Ottilies führen, bereits in der Figurenexposition vorliegt? Kann man diese also als Vorausdeutung betrachten? Zu diesem Zweck soll in einem ersten Schritt analysiert werden, wie Ottilie überhaupt in die Handlung eingeführt wird und in einem nächsten Schritt sollen drei ob ihrer besonderen Ausdruckskraft ausgewählte Aspekte genauer beleuchtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Themenbegründung
- Ottilie als Schlüsselfigur der Todesproblematik
- Die Einführung der Ottilie
- Drei Merkmale
- Die Außensicht - Das Bild der Ottilie
- Reaktion statt Aktion - Passivität statt Aktivität
- Ottilies Gebärde
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Einführung von Ottilie in Goethes „Wahlverwandtschaften" und analysiert, inwiefern diese bereits Elemente der Todesproblematik beinhaltet. Der Fokus liegt auf der Analyse der Briefe der Vorsteherin und ihres Gehilfen, um zu klären, ob die Figurenbeschreibung Ottilies bereits als Vorausdeutung auf ihren Tod interpretiert werden kann.
- Die Einführung von Ottilie als „funktionales Element“
- Die Bedeutung der Außensicht und des Bildes von Ottilie, das von anderen konstruiert wird
- Ottilies Passivität und ihr Mangel an Handlungsfähigkeit
- Die Rolle von Ottilies Gebärde und ihre Verbindung zum Tod
- Die Vorausdeutung auf Ottilies Tod durch die Briefe der Vorsteherin und ihres Gehilfen
Zusammenfassung der Kapitel
Themenbegründung
Die Einleitung beleuchtet die zentrale Bedeutung der Liebe und des Todes im Leben und in der Literatur. Die Arbeit argumentiert, dass Ottilie in Goethes „Wahlverwandtschaften" ein exemplarisches Todessymbol darstellt und ihre Einführung bereits Elemente ihres zukünftigen Todes beinhaltet.
Ottilie als Schlüsselfigur der Todesproblematik
Die Einführung der Ottilie
Ottilie wird als letztes Mitglied der „Wahlverwandtschaften" eingeführt, nicht als lebendige Person, sondern als funktionales Element der Handlung. Der Leser erlebt ihr Erscheinen nicht direkt, sondern durch die Beschreibungen anderer Personen, insbesondere durch Briefe der Vorsteherin und ihres Gehilfen. Diese Art der Einführung stellt Ottilie von Anfang an als Objekt der Betrachtung und nicht als eigenständiges Subjekt dar.
Drei Merkmale
Die Außensicht - Das Bild der Ottilie
Ottilie wird hauptsächlich durch die Beschreibungen anderer Personen charakterisiert, wobei ihr eigenes Wesen und ihre Gedanken nur indirekt zum Ausdruck kommen. Sie wird als „weibliche Imago-Gestalt" dargestellt, deren Bedeutung an nicht mehr lebende Personen gekoppelt ist. Die Betrachtung Ottilies erfolgt durch die Brille ihrer Mitmenschen, wodurch ein von außen konstruiertes Bild von ihr entsteht.
Reaktion statt Aktion - Passivität statt Aktivität
Ottilie ist ein passives Wesen, das sich kaum aktiv in die Handlung einbringt. Sie ist nicht in der Lage, sich selbst zu erklären und wird von den Umständen und den Meinungen anderer bestimmt. Ihre passiv-reagierende Haltung wird als ein weiteres Indiz für ihre Todesproblematik gesehen.
Ottilies Gebärde
Dieser Abschnitt untersucht die körperliche Ausdrucksweise Ottilies und ihre Verbindung zum Tod. Es wird argumentiert, dass ihre Gebärde bereits im frühen Stadium des Romans Elemente der Krankheit und des Todes impliziert.
Schlüsselwörter
Goethe, „Wahlverwandtschaften“, Ottilie, Todesproblematik, Figurenexposition, Vorausdeutung, Briefe, Vorsteherin, Gehilfe, Passivität, Imago-Gestalt, Gebärde.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt Ottilie in Goethes „Wahlverwandtschaften“ als Todessymbol?
Ottilie ist eine zentrale Schlüsselfigur, deren gesamtes Erscheinen im Roman eng mit der Todesproblematik verknüpft ist. Ihr langsames Sterben erstreckt sich über das Werk und wird als zäh und quälend dargestellt.
Wie wird Ottilie in die Handlung eingeführt?
Sie wird betont indirekt eingeführt, nämlich durch Briefe der Vorsteherin und ihres Gehilfen. Der Leser lernt sie zunächst nur durch die Beschreibungen und Projektionen anderer Personen kennen.
Welche Rolle spielt die Passivität für Ottilies Charakter?
Ottilie zeichnet sich durch Reaktion statt Aktion aus. Ihre Passivität und mangelnde Handlungsfähigkeit werden als Indizien für ihre Bestimmung zum Tod gewertet, da sie sich den äußeren Umständen nicht widersetzen kann.
Was bedeutet der Begriff „Imago-Gestalt“ im Zusammenhang mit Ottilie?
Er beschreibt, dass Ottilie oft als Bild oder Objekt wahrgenommen wird, deren Bedeutung an bereits verstorbene Personen gekoppelt ist. Sie wird von ihren Mitmenschen eher konstruiert als als eigenständiges Subjekt gesehen.
Gibt es im Roman Vorausdeutungen auf ihren Tod?
Ja, die Analyse der Briefe zur Figurenexposition zeigt, dass wesentliche Elemente, die zu ihrem späteren Tod führen, bereits in der ersten Beschreibung ihrer Person angelegt sind.
- Quote paper
- Marcus Patzer (Author), 2009, Die Einführung von Ottilie in Goethes „Wahlverwandtschaften“ als zentrale Schlüsselfigur der Todesproblematik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376343