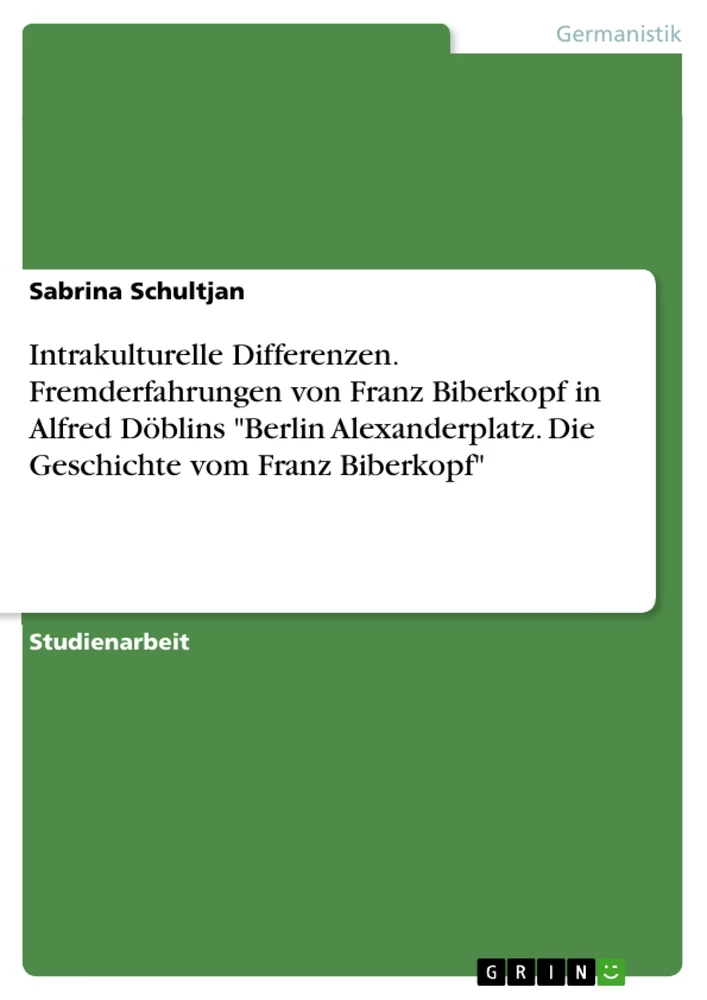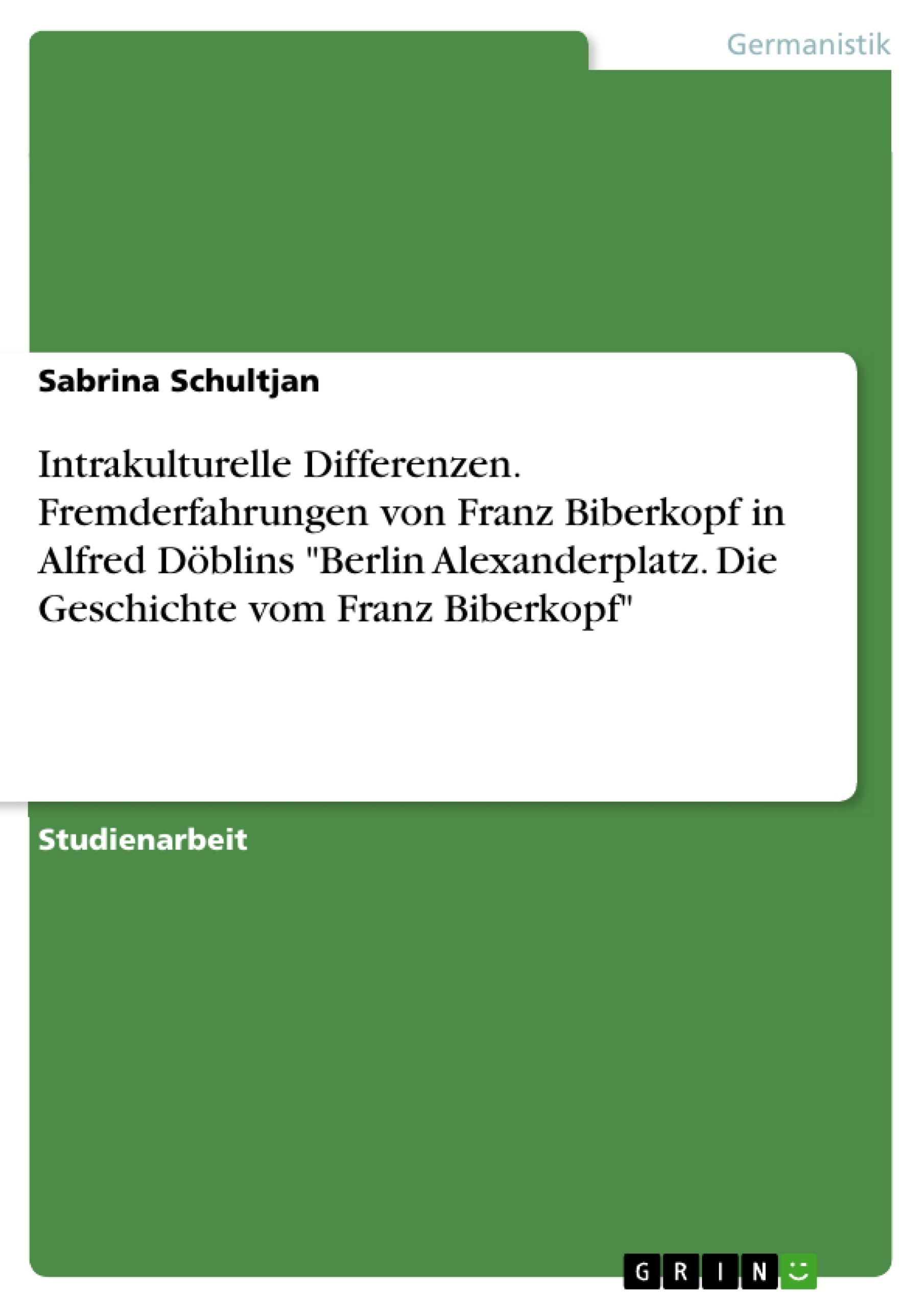In dieser Arbeit wird exemplarisch herausgearbeitet, wie die intrakulturellen Differenzen und Fremderfahrungen durch bestimmte literarische Erzähltechniken in "Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf" veranschaulicht werden. Dazu wird zunächst eine begriffliche Konkretisierung und eine Einordnung des Romans in den entsprechenden Zeitkontext vorgenommen. Darauf aufbauend werden die Simultan- und Montagetechnik sowie die narrativen Ebenen betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fremderfahrungen im eigenen Land
- Theorie der Intrakulturalität
- Intrakulturelle Bedeutung der Großstadtliteratur
- Zeitgeschichtlicher Kontext
- Perzeption der Großstadt
- Döblins urbane Poetik
- Literarische Konstruktionstechniken
- Simultantechnik
- Stadtmontagen
- Narrative Ebenen
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die intrakulturellen Differenzen und Fremderfahrungen von Franz Biberkopf in Alfred Döblins Großstadtroman „Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf“ zu untersuchen. Insbesondere wird untersucht, wie diese Erfahrungen durch bestimmte literarische Erzähltechniken veranschaulicht werden.
- Die Bedeutung der Intrakulturalität im Kontext der Großstadt
- Die Darstellung der Großstadt in Döblins Werk
- Die Rolle der literarischen Konstruktionstechniken bei der Vermittlung von Fremdheitserfahrungen
- Die Vielschichtigkeit des Lebens in der Großstadt Berlin in den 1920er Jahren
- Die Herausforderungen, denen sich Franz Biberkopf in der urbanen Umgebung gegenübersteht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der intrakulturellen Differenzen im Kontext der modernen Urbanisierung ein und stellt den Roman „Berlin Alexanderplatz“ als Beispiel für die Darstellung dieser Differenzen in der Großstadtliteratur vor.
Das Kapitel „Fremderfahrungen im eigenen Land“ definiert den Begriff der Intrakulturalität und erläutert seine Bedeutung für die Analyse von Fremdheitserfahrungen in urbanen Kontexten. Es werden verschiedene Konstruktionsattribute von Fremdheit betrachtet und die Bedeutung der Intrakulturalität für die Großstadtliteratur hervorgehoben.
Das Kapitel „Zeitgeschichtlicher Kontext“ beleuchtet die Perzeption der Großstadt im frühen 20. Jahrhundert und analysiert Döblins urbane Poetik.
Das Kapitel „Literarische Konstruktionstechniken“ untersucht die Rolle der Simultan- und Montagetechnik sowie der narrativen Ebenen bei der Darstellung der intrakulturellen Differenzen und Fremderfahrungen im Roman.
Schlüsselwörter
Intrakulturalität, Großstadtliteratur, Fremderfahrungen, Berlin Alexanderplatz, Alfred Döblin, Simultan- und Montagetechnik, Narrative Ebenen, Urbanisierung, Zeitgeschichtlicher Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Was thematisiert Döblins „Berlin Alexanderplatz“?
Der Roman beschreibt das Leben von Franz Biberkopf in der Metropole Berlin der 1920er Jahre und seine Erfahrungen mit Fremdheit und Kriminalität.
Was versteht man unter „intrakulturellen Differenzen“?
Es bezeichnet Fremdheitserfahrungen innerhalb der eigenen Kultur, oft ausgelöst durch die Anonymität und Vielschichtigkeit der Großstadt.
Welche Rolle spielt die Montagetechnik im Roman?
Döblin nutzt Montagen von Zeitungsberichten, Werbesprüchen und Stadtgeräuschen, um die Hektik und Komplexität Berlins literarisch abzubilden.
Was ist Döblins „urbane Poetik“?
Ein Erzählstil, der die Stadt nicht nur als Hintergrund, sondern als eigenständigen, pulsierenden Akteur darstellt.
Wie wird Franz Biberkopf als Fremder dargestellt?
Nach seiner Haftentlassung findet er sich in der modernen Großstadt nicht mehr zurecht und erlebt die urbane Umwelt als bedrohlich und fremd.
- Quote paper
- Sabrina Schultjan (Author), 2017, Intrakulturelle Differenzen. Fremderfahrungen von Franz Biberkopf in Alfred Döblins "Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376426