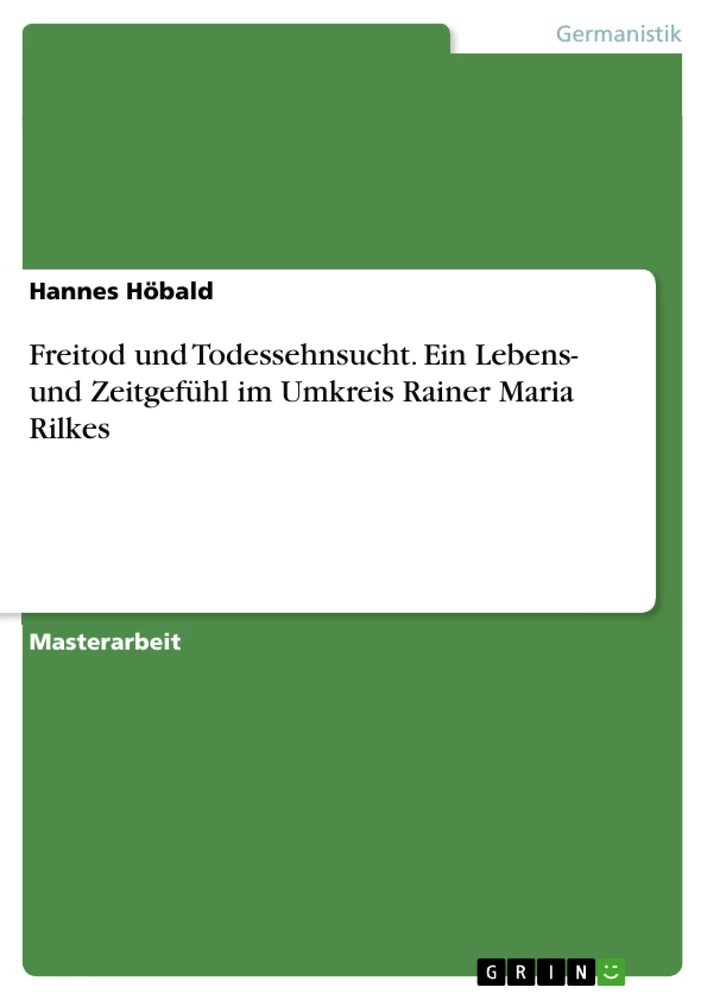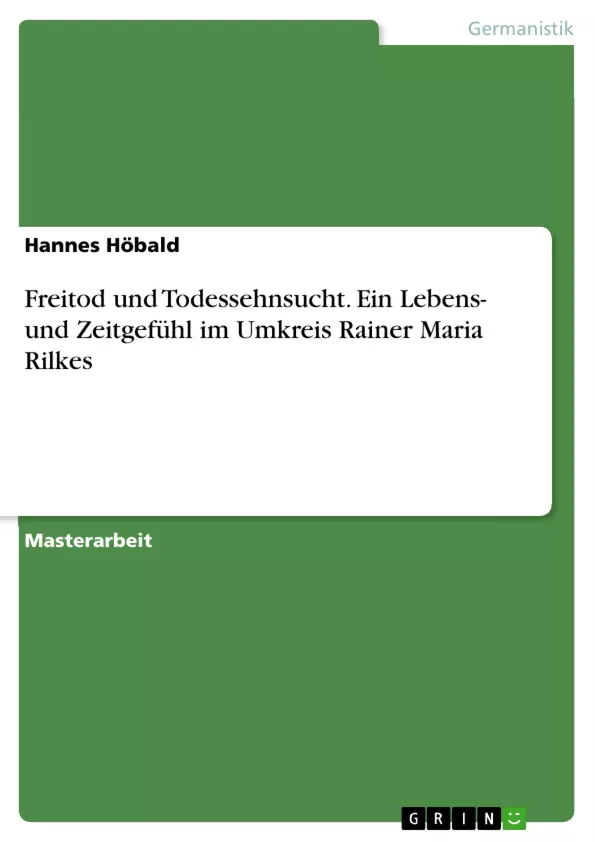"Freitod und Todessehnsucht als Lebens- und Zeitgefühl im Umkreis Rilkes", ein Titel, der am Anfang eine kleine Erklärung nötig macht. Mit Umkreis ist nicht der nähere Kreis um Rilke gemeint, sondern der zeitliche Umkreis in dem Rilke gelebt hat, also die Zeit zwischen seiner Geburt und seinem Tod. Rilkes Lebenszeit wurde als Zeitrahmen gewählt, da sein Leben sich mit dem vieler anderer berühmter Menschen überschneidet und er ist so bekannt, dass jeder in etwa weiß, wann er gelebt hat und wann er gestorben ist, während das bei literarischen Strömungen oftmals nicht der Fall ist. Rilkes Leben als zeitlicher Rahmen bietet auch eine gewisse Flexibilität, durch die man nicht so fest an bestimmte Zeitpunkte gebunden ist, wie bei der Verwendung selbst gewählter Zeitabschnitte, aber der Zeitrahmen ist trotzdem noch fest genug, um ein zeitliches Ausufern des Themas zu verhindern.
Die Frage dieser Arbeit ist nun, ob im genannten zeitlichen Rahmen Freitod und Todessehnsucht so prägnant vorkommen, dass sich hierbei schon von einem Lebens- und Zeitgefühl sprechen lässt, welches viele Menschen und die Zeit entscheidend mitgeprägt hat. Es kann natürlich auch sein, dass es sich hierbei bloß um literarische Motive handelt und die Menschen weder Todessehnsucht noch das Verlangen gespürt haben, sich umzubringen. Es stellt sich also die Frage, ob Literatur und Gesellschaft der Zeit bei diesen beiden Themen Hand in Hand gehen oder ob sie völlig auseinanderklaffen und man genannte Phänomene vorrangig als bloße literarische Motive vorfindet, während sie in der Gesellschaft bloß ein irrelevantes Nischendasein führen. Dass ausgerechnet zwei eher suizidale Phänomene für die Fragestellung gewählt wurden, lässt sich damit erklären, dass sowohl die Todessehnsucht als auch der Freitod den Menschen schon seit Jahrhunderten begleiten und entsprechend vielfach literarisch bearbeitet wurden und auch viele Personen dadurch fast gestorben oder wirklich gestorben sind. Dies führt dann zu der Frage, ob es bestimmte Zeiten gibt, in denen diese Phänomene auch als Lebens- und Zeitgefühl auftreten, aber da nicht sämtliche Zeiträume untersucht werden können in dieser Arbeit, liegt der Fokus auf der Zeit, in der Rilke lebte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeines über Leben und Welt zur Zeit Rilkes
- Positive und negative Veränderungen
- Der Umgang der Menschen mit den Problemen
- Der 1. Weltkrieg
- Vor dem 1. Weltkrieg
- Die Menschen und der 1. Weltkrieg
- Über Sigmund Freud
- Freuds Arbeit
- Freud und der Todestrieb
- Über den Expressionismus
- Expressionismus und Expressionisten
- Expressionistische Literatur
- Positive und negative Veränderungen
- Freitod und Todessehnsucht
- Über den Freitod
- Ursachen des Freitods
- Der Freitod in der Literatur
- Über die Todessehnsucht
- Ursachen der Todessehnsucht
- Todessehnsucht in der Literatur
- Über den Freitod
- Freitod und Todessehnsucht in der Lyrik Rainer Maria Rilkes
- Das Stunden-Buch
- Das Buch der Bilder
- Neue Gedichte
- Requiem
- Duineser Elegien
- Weitere Gedichte
- Freitod und Todessehnsucht in der Lyrik Rainer Maria Rilkes?
- Freitod und Todessehnsucht in Stefan Zweigs Die Welt von Gestern
- Die Welt der Sicherheit
- Die Schule im vorigen Jahrhundert
- Eros Matutinus
- Heimkehr nach Österreich und Wieder in der Welt
- Freitod und Todessehnsucht in Stefan Zweigs Die Welt von Gestern?
- Freitod und Todessehnsucht in der Lyrik Georg Trakls
- Sebastian im Traum
- Sonstige Veröffentlichungen zu Lebzeiten und Nachlass
- Freitod und Todessehnsucht in der Lyrik Georg Trakls?
- Freitod und Todessehnsucht als Lebens- und Zeitgefühl im Umkreis Rilkes?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob Freitod und Todessehnsucht im zeitlichen Umkreis Rilkes so präsent waren, dass sie als prägendes Lebens- und Zeitgefühl betrachtet werden können. Es wird analysiert, inwiefern diese Themen in der Literatur der Zeit vorkommen und ob sie auch in der Gesellschaft der Zeit eine entsprechende Relevanz hatten. Die Arbeit beleuchtet die Entstehung dieser Phänomene und deren Ursachen sowie die Rolle der Literatur in diesem Kontext.
- Die Präsenz von Freitod und Todessehnsucht in der Literatur der Zeit Rilkes
- Die Ursachen und Hintergründe von Freitod und Todessehnsucht im historischen Kontext
- Die Rolle des 1. Weltkriegs und des Expressionismus im Zusammenhang mit Freitod und Todessehnsucht
- Die Bedeutung von Sigmund Freuds Theorien für das Verständnis von Freitod und Todessehnsucht
- Die Einordnung von Freitod und Todessehnsucht als Lebens- und Zeitgefühl
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert den gewählten zeitlichen Rahmen der Arbeit. Sie stellt die Forschungsfrage und definiert die verwendeten Begriffe. Kapitel 2 bietet einen Überblick über die gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen der Zeit Rilkes, mit Schwerpunkt auf den 1. Weltkrieg, Sigmund Freud und den Expressionismus. Kapitel 3 behandelt die Phänomene Freitod und Todessehnsucht allgemein und beleuchtet deren Ursachen und literarische Ausprägungen. Die Kapitel 4, 5 und 6 analysieren die Werke von Rainer Maria Rilke, Stefan Zweig und Georg Trakl, um deren Umgang mit den Themen Freitod und Todessehnsucht zu untersuchen. Die Arbeit schließt mit einer abschließenden Analyse, die die Frage beantwortet, ob Freitod und Todessehnsucht ein allgemeines Lebens- und Zeitgefühl im Umkreis Rilkes darstellten.
Schlüsselwörter
Freitod, Todessehnsucht, Lebensgefühl, Zeitgefühl, Rilke, 1. Weltkrieg, Expressionismus, Freud, Literatur, Gesellschaft, Suizid, Selbsttötung, Autobiographie, Lyrik.
- Quote paper
- Hannes Höbald (Author), 2013, Freitod und Todessehnsucht. Ein Lebens- und Zeitgefühl im Umkreis Rainer Maria Rilkes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376533