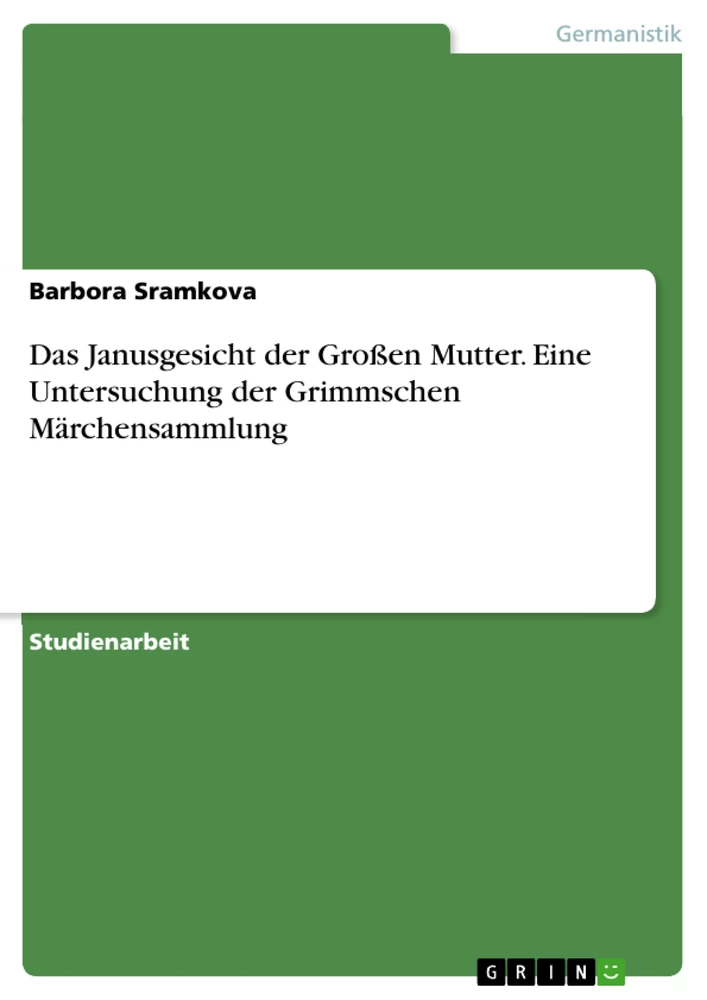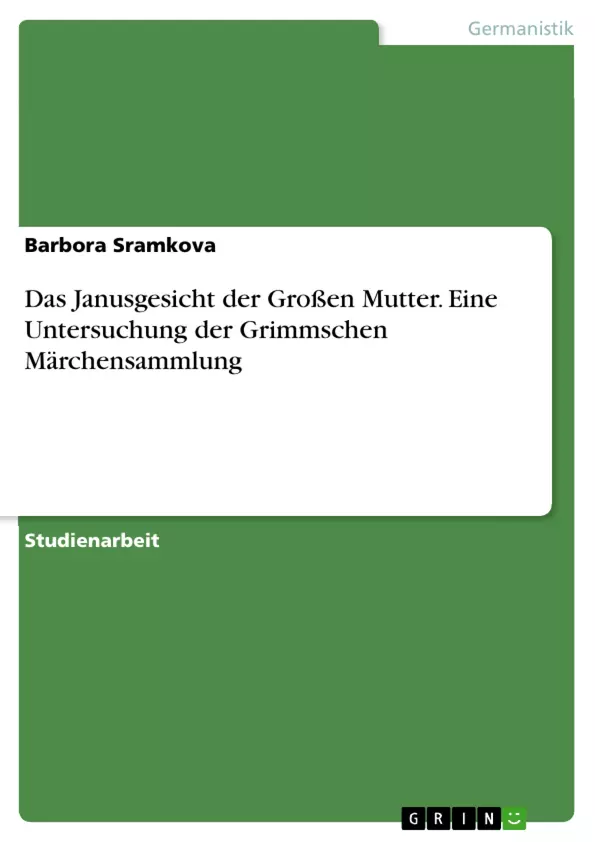Ausschlaggebend für die folgenden Untersuchungen, die sich mit dem Prinzip des Weiblichen in den Grimmschen Märchen beschäftigen, wie es sich in den mannigfaltigen Erscheinungsformen der Großen Mutter niederschlägt, war die Archetypenlehre von C.G.Jung. Dabei soll es sich weniger um eine tiefenpsychologische Märcheninterpretation handeln, wie sie z.B. Eugen Drewermann geliefert hat , als um eine vergleichende Untersuchung der archetypischen Motiven, die mit dem weiblichen Prinzip zusammenhängen. Jung hat darauf hingewiesen, dass die Märchenmotive, die in zahlreichen Abwandlungen parallel bei verschiedenen Völkern auftauchen, eine Manifestation des kollektiven Unbewussten sind. Als solche sind dann die Märchenmotive nicht isoliert zu betrachten, sondern in breiteren Zusammenhängen der Mythologie der griechisch-römischen Antike, aber auch der östlichen Kulturen, um nur die wichtigsten Bezugspunkte zu nennen, auf die sich die Archetypenanalyse stützt.
In der Grimmschen Märchensammlung begegnen wir einer Schar Gestalten, die dem Archetyp der Großen Mutter zuzuordnen sind. Da der Begriff des weiblichen Prinzips sehr umfangreich ist, soll er hier nicht in seinem ganzen Spektrum dargestellt werden. Weitgehend unberücksichtigt bleiben z.B. die Jungfrauen und Prinzessinnen, die als Verkörperungen der Anima in den Märchen eine durchaus wichtige Bedeutung haben. Unser Augenmerk wird sich vorwiegend auf die weiblichen Figuren richten, die das personifizierte Prinzip des Mütterlichen vertreten. Die zentrale Gestalt dieses Umfeldes ist die Große Mutter. Diese Bezeichnung scheint, unter allen verwandten Begriffen, wie z.B. Mutter Erde, Mutter Natur, die gute oder schlechte Mutter, am ehesten das auszudrücken, was das eigentliche Faszinosum dieses Archetyps ausmacht, nämlich den merkwürdigen Doppelcharakter dieser Gestalt. Natürlich ist die Große Mutter ein Abstraktum, das an sich nicht untersucht werden kann. In den Märchen kommen meistens Figuren vor, die einige positive oder negative Aspekte des Weiblichen darstellen.
Die Archetypenlehre Jungs wird uns in diese Problematik einführen; ein zweiter Grundstein sei mit den Erforschungen von Erich Neumann gelegt, die sich mit dem Archetyp des Großen Weiblichen in allen seinen Erscheinungsformen auseinandersetzen.
Inhaltsverzeichnis
- 1.1 Einleitung
- 2. Die Archetypenlehre C.G.Jungs
- 3. Das doppelte Gesicht der Großen Mutter
- 4. Die Große Mutter als Schicksalsmacht
- 5. Die bedrohliche Mutter
- 5.1 Die Todesmutter
- 5.2 Die Mutter, die es gut meint
- 6. Die hegende Mutter
- 6.1 Die lebensfördernden Tiergestalten
- 6.2 Die allmächtige Herrin der Unterwelt
- 7. Zwischen Gut und Böse: Die Teufelin
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das weibliche Prinzip in den Grimmschen Märchen, insbesondere die vielfältigen Erscheinungsformen der Großen Mutter, basierend auf der Archetypenlehre von C.G. Jung. Der Fokus liegt auf einem vergleichenden Studium archetypischer Motive, die mit dem weiblichen Prinzip verbunden sind, ohne sich in eine tiefenpsychologische Märcheninterpretation zu vertiefen. Es wird die Manifestation des kollektiven Unbewussten in den Märchenmotiven beleuchtet und deren Zusammenhang mit Mythen anderer Kulturen erörtert.
- Der Archetyp der Großen Mutter in den Grimmschen Märchen
- Das doppelte Gesicht der Großen Mutter: positive und negative Aspekte
- Vergleich mit mythologischen Gestalten anderer Kulturen
- Die Rolle des kollektiven Unbewussten in der Gestaltung der Figuren
- Analyse archetypischer Motive im Kontext von Gut und Böse
Zusammenfassung der Kapitel
1.1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Grundlage der Untersuchung: die Archetypenlehre von C.G. Jung. Es wird erklärt, dass der Fokus weniger auf einer tiefenpsychologischen Interpretation liegt, sondern auf einem Vergleich archetypischer Motive, die mit dem weiblichen Prinzip verbunden sind. Die Grimmschen Märchen bieten eine reichhaltige Quelle an Figuren, die dem Archetyp der Großen Mutter zugeordnet werden können. Die Arbeit konzentriert sich auf weibliche Figuren, die das mütterliche Prinzip verkörpern, unter Berücksichtigung der von Jung und Neumann entwickelten Konzepte.
2. Die Archetypenlehre C.G.Jungs: Dieses Kapitel liefert einen kurzen Überblick über Jungs Archetypenlehre, insbesondere die Konzepte des kollektiven Unbewussten und des Archetyps. Es wird erläutert, wie Archetypen als Inhalte des kollektiven Unbewussten verstanden werden und sich in Mythen, Sagen, Märchen, Kunst und Träumen manifestieren. Die Vielfältigkeit und Wandelbarkeit archetypischer Bilder wird thematisiert, wobei die formale statt inhaltliche Bestimmung der Archetypen betont wird. Die Hierarchie der Archetypen, mit primären (z.B. die Große Mutter) und sekundären Archetypen, wird ebenfalls behandelt, sowie die potenzielle Gefahr einer Reduktion aller Phänomene auf die Dualität von Gut und Böse.
3. Das doppelte Gesicht der Großen Mutter: Dieses Kapitel befasst sich mit dem ambivalenten Charakter der Großen Mutter, der sowohl positive (gütig, hegend) als auch negative (finster, verführerisch, bedrohlich) Aspekte umfasst. Jung’s Beschreibung der magischen Autorität und Weisheit des Weiblichen wird hier diskutiert. Der scheinbare Widerspruch wird mit Erich Neumanns Konzept eines „Urarchetypus“ in Verbindung gebracht, der die Einheit von positiven und negativen Aspekten in der Frühphase der menschlichen Bewusstseinsentwicklung repräsentiert.
4. Die Große Mutter als Schicksalsmacht: [Diese Zusammenfassung muss aus dem Originaltext erstellt werden, da dieser Abschnitt im Auszug nicht enthalten ist.]
5. Die bedrohliche Mutter: Dieses Kapitel analysiert die Aspekte der Großen Mutter, die mit Bedrohung und Gefahr verbunden sind. Es wird zwischen der „Todesmutter“ und der „Mutter, die es gut meint“, unterschieden, wobei die Ambivalenz des mütterlichen Prinzips weiter vertieft wird. Die Kapitel behandeln sowohl die zerstörerischen als auch die wohlwollenden Facetten der mütterlichen Figur in den Märchen. Konkrete Beispiele aus den Märchen werden benötigt um den Inhalt des Kapitels in der Zusammenfassung darzustellen.
6. Die hegende Mutter: Dieses Kapitel widmet sich den positiven und nährenden Aspekten der Großen Mutter. Es beleuchtet die „lebensfördernden Tiergestalten“ und die „allmächtige Herrin der Unterwelt“, wobei die unterschiedlichen Manifestationen des hegenden Prinzips analysiert werden. Auch hier werden Beispiele und detaillierte Erläuterungen benötigt, um eine vollständige Zusammenfassung zu erstellen.
7. Zwischen Gut und Böse: Die Teufelin: [Diese Zusammenfassung muss aus dem Originaltext erstellt werden, da dieser Abschnitt im Auszug nicht enthalten ist.]
Schlüsselwörter
Große Mutter, Archetypen, C.G. Jung, Grimmsche Märchen, weibliches Prinzip, kollektives Unbewusstes, Mythologie, Ambivalenz, Gut und Böse, Mütterlichkeit, Schicksal, Märchenanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des weiblichen Prinzips in den Grimmschen Märchen
Was ist der Gegenstand der Untersuchung?
Die Arbeit untersucht das weibliche Prinzip, insbesondere die vielfältigen Erscheinungsformen der Großen Mutter in den Grimmschen Märchen, basierend auf C.G. Jungs Archetypenlehre. Der Fokus liegt auf einem vergleichenden Studium archetypischer Motive, die mit dem weiblichen Prinzip verbunden sind, ohne sich in eine tiefenpsychologische Märcheninterpretation zu vertiefen. Die Manifestation des kollektiven Unbewussten in den Märchenmotiven und deren Zusammenhang mit Mythen anderer Kulturen wird beleuchtet.
Welche theoretische Grundlage wird verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf C.G. Jungs Archetypenlehre, insbesondere die Konzepte des kollektiven Unbewussten und des Archetyps der Großen Mutter. Es wird erläutert, wie Archetypen als Inhalte des kollektiven Unbewususten verstanden werden und sich in Mythen, Sagen, Märchen, Kunst und Träumen manifestieren. Die Vielfältigkeit und Wandelbarkeit archetypischer Bilder wird thematisiert, wobei die formale statt inhaltliche Bestimmung der Archetypen betont wird.
Welche Aspekte der Großen Mutter werden untersucht?
Die Arbeit analysiert das ambivalente Bild der Großen Mutter, welches sowohl positive (gütig, hegend) als auch negative (finster, verführerisch, bedrohlich) Aspekte umfasst. Es werden die hegende Mutter mit ihren lebensfördernden Tiergestalten und der allmächtigen Herrin der Unterwelt ebenso untersucht wie die bedrohliche Mutter, unterteilt in die Todesmutter und die Mutter, die es gut meint. Die Teufelin als eine weitere Manifestation des weiblichen Prinzips wird ebenfalls behandelt. Der scheinbare Widerspruch wird mit Erich Neumanns Konzept eines „Urarchetypus“ in Verbindung gebracht.
Wie wird der Vergleich mit anderen Kulturen hergestellt?
Die Arbeit erörtert den Zusammenhang der in den Grimmschen Märchen dargestellten archetypischen Motive mit Mythen anderer Kulturen. Dies ermöglicht einen breiteren Kontext für das Verständnis der verschiedenen Erscheinungsformen des weiblichen Prinzips und der Großen Mutter.
Welche Rolle spielt das kollektive Unbewusste?
Die Arbeit beleuchtet die Manifestation des kollektiven Unbewussten in den Märchenmotiven und deren Einfluss auf die Gestaltung der Figuren. Es wird untersucht, wie archetypische Bilder und Motive Ausdruck des kollektiven Unbewussten sind.
Wie wird das Thema „Gut und Böse“ behandelt?
Die Arbeit analysiert archetypische Motive im Kontext von Gut und Böse, wobei die Ambivalenz des weiblichen Prinzips und die potenzielle Gefahr einer Reduktion aller Phänomene auf diese Dualität betont werden. Die Arbeit zeigt die verschiedenen Facetten des weiblichen Prinzips, die sowohl positive als auch negative Aspekte umfassen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Die Archetypenlehre C.G. Jungs, Das doppelte Gesicht der Großen Mutter, Die Große Mutter als Schicksalsmacht, Die bedrohliche Mutter (inkl. Todesmutter und Mutter, die es gut meint), Die hegende Mutter (inkl. lebensfördernden Tiergestalten und allmächtigen Herrin der Unterwelt), Zwischen Gut und Böse: Die Teufelin.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Große Mutter, Archetypen, C.G. Jung, Grimmsche Märchen, weibliches Prinzip, kollektives Unbewusstes, Mythologie, Ambivalenz, Gut und Böse, Mütterlichkeit, Schicksal, Märchenanalyse.
- Quote paper
- Barbora Sramkova (Author), 1997, Das Janusgesicht der Großen Mutter. Eine Untersuchung der Grimmschen Märchensammlung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37660