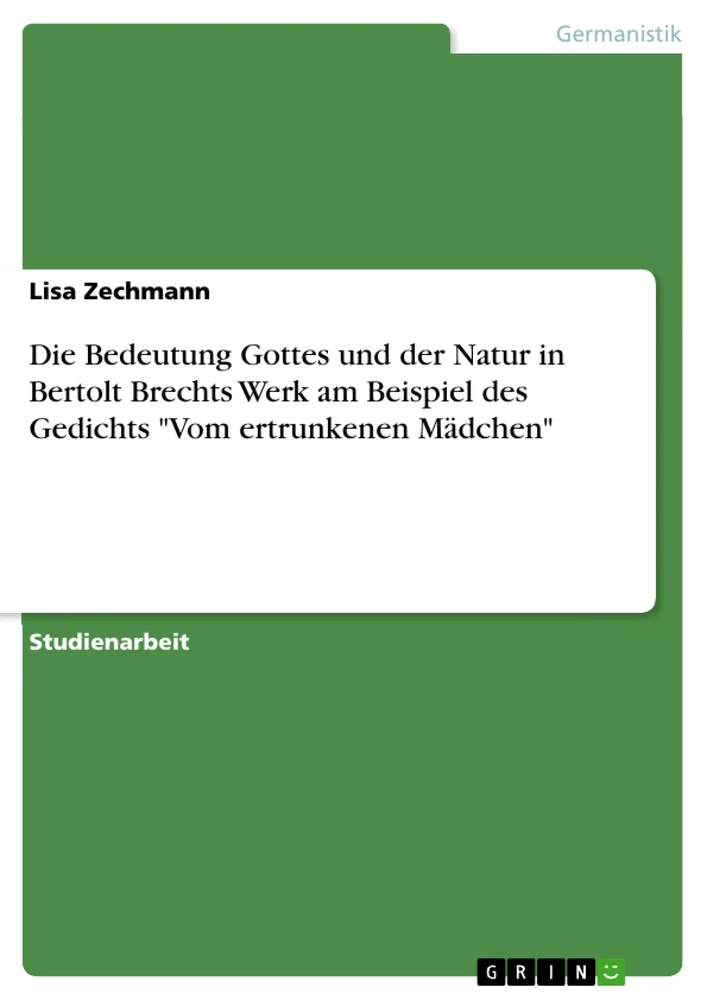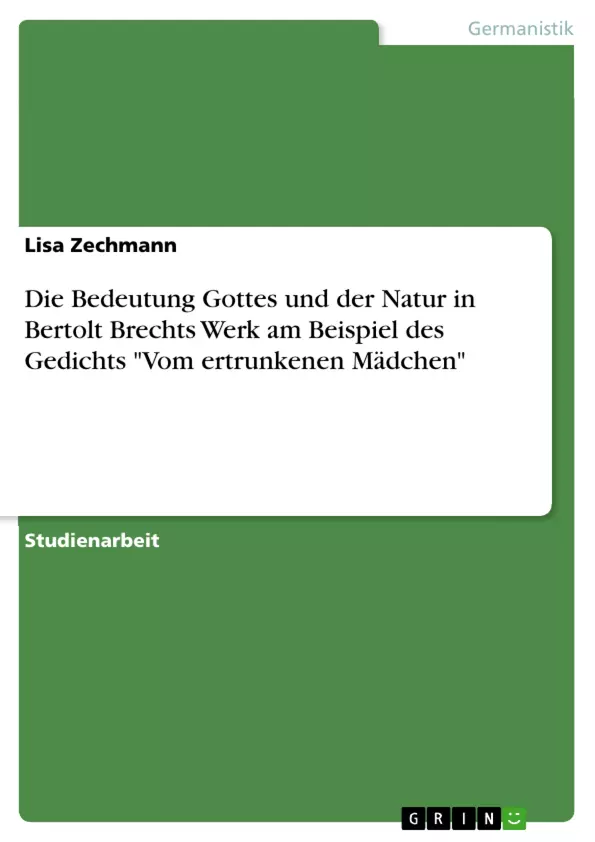Brecht, die Natur und Gott – es ist deutlich, dass sich die Themenkreise Natur und Gott wie ein roter Faden durch das Gesamtwerk Brechts ziehen. Anhand der genaueren Untersuchung des Gedichts "Vom ertrunkenen Mädchen" soll die Verwendung dieser Motive im Rahmen der Arbeit exemplarisch verdeutlicht werden.
Ausgehend von Peter Paul Schwarz, der den Nihilismus Brechts als Grundlage der schematischen und strukturellen Zusammenhänge in dessen Werk versteht, untersucht die Arbeit die Verbindung von Brecht und Gott. Die Abwendung Brechts von Gott hin zu einer nihilistischen Weltsicht wirkte sich auf die von ihm, im Zuge dieser Entwicklung, verfassten Einzelwerke aus. Ein Teil dieser Arbeit befasst sich demnach mit der religiösen Entwicklung Brechts und deren Auswirkung auf Brechts Gesamtwerk. Die Ausarbeitung dieses Teils basiert weitgehend auf Schwarz' Werk "Brechts frühe Lyrik, 1914 – 1922". Des weiteren wird das Motiv Gottes, dessen Existenz und die dadurch zu reflektierende Weltsicht Brechts anhand des Gedichts "Vom ertrunkenen Mädchen" exemplarisch erläutert.
Doch nicht nur das Motiv Gott, sondern auch die Thematik der Natur spielt in Brechts Lyrik eine bedeutende Rolle. Bereits ab dem 18. Jahrhundert finden Gefühle und die Reflexion des Naturbegriffs Ausdruck in der Lyrik. Der Strom der Naturlyrik breitete sich bis hin ins 20. Jahrhundert aus. Die freie Natur galt als Hauptthema dieser Strömung. Brecht, der zwar ebenfalls von diesem Strom tangiert wurde, wird in der Forschung jedoch als Ausnahme innerhalb der Naturlyriker des 20. Jahrhunderts gesehen. Wie Brecht die Natur und ihre Symbolik in sein Werk einband wird im Laufe dieser Arbeit näher betrachtet. Auf die allgemeine Einordnung der Natur in Brechts Gesamtwerk folgt die spezifische Interpretation dieses Motivs im Gedicht "Vom ertrunkenen Mädchen".
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Einordnung des Gedichts Vom ertrunkenen Mädchen in Brechts Werk
- 1. Die Hauspostille
- 2. Die Untergangsgedichte
- 3. Die Wassergedichte
- III. Das Motiv der Natur
- 1. Bedeutung der Natur in Brechts Werken
- 2. Natursymbolik im Vom ertrunkenen Mädchen
- IV. Das Motiv Gottes
- 1. Brechts Entwicklung zum Nihilismus
- 2. Der Einfluss Gottes im Vom ertrunkenen Mädchen
- VI. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse des Gedichts "Vom ertrunkenen Mädchen" von Bertolt Brecht. Ziel ist es, die Bedeutung der Motive Gott und Natur in Brechts Werk am Beispiel dieses Gedichts zu untersuchen und deren Einfluss auf die literarische Gestaltung zu beleuchten.
- Einordnung des Gedichts "Vom ertrunkenen Mädchen" in Brechts Werk
- Analyse der Natursymbolik im Gedicht
- Untersuchung von Brechts religiöser Entwicklung und dem Einfluss des Motivs Gottes
- Zusammenhang zwischen den Motiven Gott und Natur in Brechts Werk
- Bedeutung des Gedichts für das Verständnis von Brechts Gesamtwerk
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung stellt Bertolt Brecht und seine Werke vor und führt in die Thematik der Arbeit ein. Sie beleuchtet die Bedeutung des Gedichts "Vom ertrunkenen Mädchen" im Kontext von Brechts Lyriksammlung "Hauspostille" und setzt die Arbeit in den Rahmen der Forschung zu Brechts Werk.
II. Einordnung des Gedichts Vom ertrunkenen Mädchen in Brechts Werk
Dieses Kapitel befasst sich mit der Einordnung des Gedichts "Vom ertrunkenen Mädchen" in Brechts Werk. Es analysiert die Entstehung des Gedichts, seine Zugehörigkeit zu Brechts "Hauspostille" und die Einordnung in die Kategorie der "Untergangsgedichte" sowie "Wassergedichte".
III. Das Motiv der Natur
In diesem Kapitel wird die Bedeutung der Natur in Brechts Gesamtwerk untersucht, sowie die spezifische Rolle der Natursymbolik im Gedicht "Vom ertrunkenen Mädchen" analysiert.
IV. Das Motiv Gottes
Dieses Kapitel befasst sich mit Brechts Entwicklung zum Nihilismus und dem Einfluss des Motivs Gottes in seinem Werk. Es analysiert die Reflexion des Motivs Gottes im Gedicht "Vom ertrunkenen Mädchen".
Schlüsselwörter
Bertolt Brecht, Hauspostille, Vom ertrunkenen Mädchen, Untergangsgedichte, Wassergedichte, Naturlyrik, Natursymbolik, Gott, Nihilismus, religiöse Entwicklung
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hat das Gedicht "Vom ertrunkenen Mädchen" in Brechts Werk?
Es gehört zu Brechts frühen "Untergangs- und Wassergedichten" aus der Sammlung "Hauspostille" und verdeutlicht seine nihilistische Weltsicht.
Wie wird die Natur im Gedicht "Vom ertrunkenen Mädchen" dargestellt?
Die Natur wird als gleichgültige, zersetzende Kraft dargestellt, die den Körper des Mädchens ohne Mitleid in den Kreislauf des Werdens und Vergehens aufnimmt.
Welche Rolle spielt Gott in Brechts früher Lyrik?
Brecht wendet sich in dieser Phase vom christlichen Gottesbild ab und entwickelt eine nihilistische Perspektive, in der Gott als abwesend oder irrelevant für das menschliche Schicksal erscheint.
Was versteht man unter dem "Nihilismus" bei Bertolt Brecht?
Nach Peter Paul Schwarz bildet der Nihilismus die Grundlage für die strukturellen Zusammenhänge in Brechts Frühwerk, in dem traditionelle Werte und religiöse Heilsversprechen ihre Gültigkeit verlieren.
Wie unterscheidet sich Brechts Naturlyrik von anderen Dichtern des 20. Jahrhunderts?
Während viele Naturlyriker Gefühle in der Natur reflektieren, nutzt Brecht die Natur oft als kühles Symbol für Materialität und die Endgültigkeit des Todes.
Was sind die zentralen Symbole im Gedicht?
Wichtige Symbole sind das Wasser (als Element der Auflösung), Aas, Pflanzen und der Himmel, die den körperlichen Verfall des Mädchens begleiten.
- Quote paper
- Lisa Zechmann (Author), 2015, Die Bedeutung Gottes und der Natur in Bertolt Brechts Werk am Beispiel des Gedichts "Vom ertrunkenen Mädchen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376633