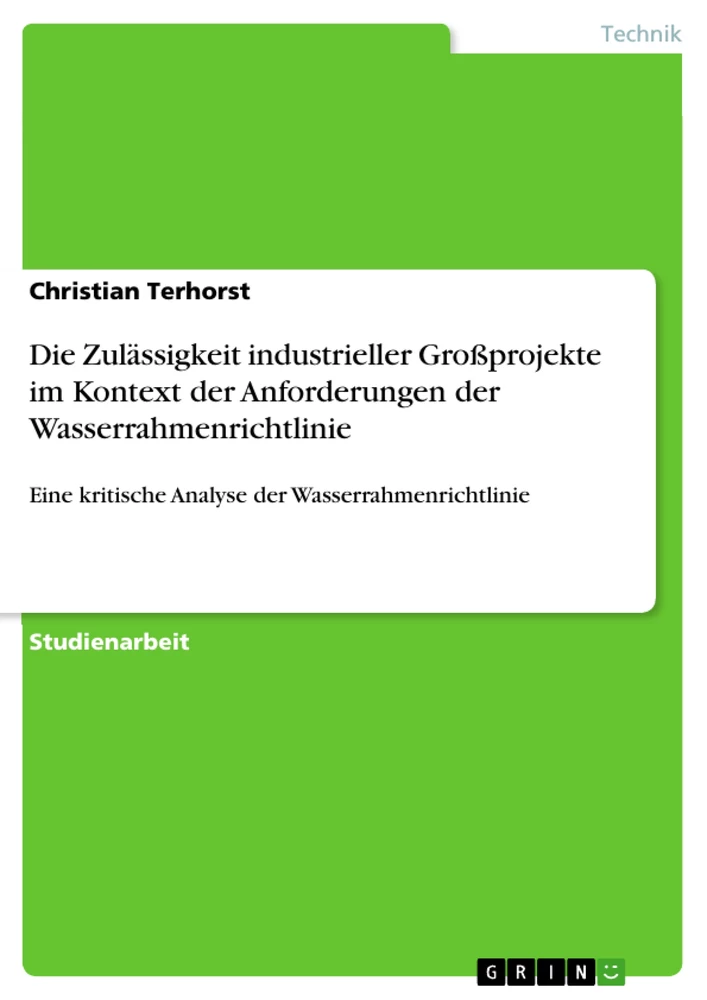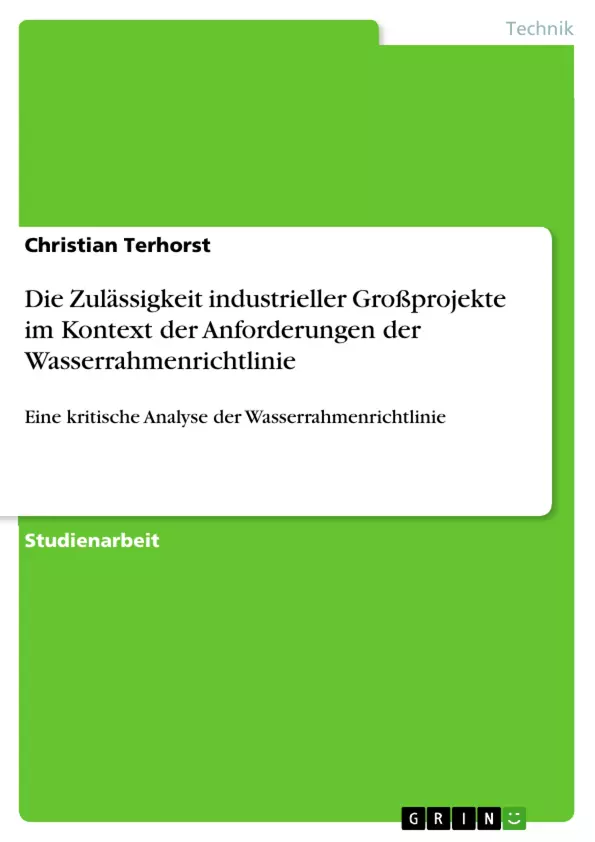Diese Arbeit thematisiert die Wasserrahmenrichtlinie, die im Jahr 2000 erlassen wurde. Die Entscheidungen innerhalber der Richtlinie sollen kritisch analyisiert werden und im Zuge dessen werden die Bewirtschaftungsziele und die damit verbundenen Begriffe Verschlechterung und Verbesserung näher erläutert, sowie die daraus resultierenden Konflikte beschrieben. Das Verschlechterungsverbot und die damit im Zusammenhang stehende Rechtsprechung stellen den Schwerpunkt dieser Ausarbeitung dar.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie
3. Umsetzung der WRRL in nationales Recht
4. Anforderungen an die Einleitungen
5. Die Bewirtschaftungsziele der Wasserrahmenrichtlinie
5.1. Verbindlichkeit der Bewirtschaftungsziele
5.2. Das Verbesserungsgebot
5.3. Das Verschlechterungsverbot
5.3.1. Stufentheorie (auch: Zustandsklassentheorie) und Status-quo-Theorie ..
5.3.2. Das EuGH-Urteil vom 01.07.2015 zur Vertiefung der Weser
5.3.3. Anwendbarkeit in Bezug auf den chemischen Zustand eines Oberflächenwasserkörpers
5.4. Das Phasing-Out-Ziel
5.5. Das Trendumkehrgebot
5.6. Zusammenfassung
6. Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen
6.1. Neue Veränderungen der physischen Gewässereigenschaften oder des Grundwasserstandes
6.2. Das übergeordnete öffentliche Interesse
6.3. Alternativlosigkeit zu den verfolgten Zielen
6.4. Minimierungsgebot
6.5. Neue nachhaltige Entwicklungstätigkeiten
6.6. Zusammenfassung
7. Übertragbarkeit auf Indirekteinleitungen
8. Resümee
9. Literatur
1. Einleitung
Die Wasserrahmenrichtlinie 1 (WRRL) wurde im Jahr 2000 erlassen und verfolgt das Ziel, die Entwicklung und Wiederherstellung der natürlichen Gewässerfunktion voranzubringen um langfristig einen guten Zustand aller Gewässer zu erreichen. Die Essenz bilden die Umweltziele Verbesserungsgebot,
Verschlechterungsverbot, Phasing- Out zur Reduktion bzw. schrittweisen Einstellung der Emission prioritär-gefährlicher Stoffe (siehe Kapitel 5.4) und das Trendumkehrgebot (für Grundwasser). Industrielle Großprojekte, wie etwa der Neubau von Kraftwerken, geraten nahezu zwangsläufig in Konflikt mit diesen Bewirtschaftungszielen. Jedoch ist keineswegs eine Deindustrialisierung der Europäischen Union durch die ambitionierten Ziele der WRRL beabsichtigt. Vielmehr gestattet die WRRL Ausnahmen, mit der den industriellen Nutzungen von Gewässern Rechnung getragen wird. Diese Ausnahmen sind an bestimmte Tatbestandsvoraussetzungen gekoppelt, deren Erfüllung der Vorhabenträger nachweisen und die zuständige Behörde prüfen und zulassen muss. Die WRRL will somit einen Ausgleich zwischen den gegensätzlichen Interessen schaffen und nicht lediglich größere Vorhaben verhindern.
Jedoch hat der Richtliniengeber es versäumt, die Begriffe der zu erreichenden Umweltziele Verschlechterung und Verbesserung hinreichend klar zu definieren. Es blieb der Rechtsprechung überlassen, den Charakter dieser Bewirtschaftungsziele zu konkretisieren. Bislang liegen Urteile in Bezug auf den ökologischen Zustand vor. Unklar ist die Anwendbarkeit in Bezug auf den chemischen Zustand.
Im Rahmen dieser Ausarbeitung sollen die Bewirtschaftungsziele und die damit verbundenen Begriffe Verschlechterung und Verbesserung näher erläutert und die daraus resultierenden Konflikte beschrieben werden. Das Verschlechterungsverbot und die damit im Zusammenhang stehende Rechtsprechung stellen den Schwerpunkt dieser Ausarbeitung dar.
Weiterhin hat die WRRL das Ziel, Einleitungen, Emissionen und Verluste prioritär gefährlicher Stoffe zu beenden oder sukzessiv einzustellen. Diese Phasing-Out-Vorgabe der WRRL führt zu der Frage, ob eine neu beantragte Industrieanlage, die zum Beispiel den prioritär-gefährlichen Stoff Quecksilber in ein Gewässer einleitet, noch zulassungsfähig ist.
Ein industrielles Großprojekt kann aber auch dann zulässig sein, wenn es gegen die Bewirtschaftungsziele verstößt. Für diese Ausnahme, die einen weiteren Schwerpunkt dieser Ausarbeitung bildet, müssen bestimmte Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sein, die jedoch in ihrer Auslegung nicht immer eindeutig sind.
Die Anwendbarkeit der vorgenannten Ziele in Bezug auf eine Indirekteinleitung stellt ein weiteres Thema dar.
2. Die Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie
Die WRRL ist am 22.12.2000 in Kraft getreten und schafft damit einen einheitlichen Ordnungsrahmen für die Mitgliedstaaten in der Wasserpolitik. Sie ist der Grundstein der gemeinsamen, ganzheitlichen Gewässerbewirtschaftung in der Europäischen Union und hat im Wesentlichen die folgenden Ziele:
- Die Schaffung eines Ordnungsrahmens für die unionsweite Wasserwirtschaft und Vereinheitlichung bzw. Bündelung des wasserwirtschaftlichen Handelns mit Hilfe der Maßnahmenprogramme (Art. 11 WRRL) bzw. Bewirtschaftungspläne (Art. 13 WRRL),
- Die Vermeidung weiterer Verschlechterungen, der Schutz und die Verbesserung der aquatischen Ökosysteme und der direkt von ihnen abhängenden Landökosysteme (Art. 1 lit. a) WRRL),
- Die Förderung einer nachhaltigen Wassernutzung auf der Grundlage eines langfristigen Schutzes der vorhandenen Ressourcen (Art. 1 lit. b) WRRL),
- Der Schutz der aquatischen Umwelt durch eine schrittweise Reduzierung von prioritären Stoffen und der Beendigung bzw. schrittweisen Einstellung der Einleitungen, Emissionen und Verluste von prioritär-gefährlichen Stoffen (Phasing-Out, Art. 1 lit. c) WRRL, siehe auch Kapitel 5.4),
- Die schrittweise Reduzierung der Verschmutzung des Grundwassers und die Verhinderung einer weiteren Verschmutzung (Art. 1 lit. d) WRRL) und
- Der Beitrag zur Minderung der Auswirkungen von Überschwemmungen und Dürren.
Diese Ziele dienen der ausreichenden Versorgung der Bevölkerung mit Oberflächen- und Grundwasser in guter Qualität und der Verringerung der Grundwasserverschmutzung. Überdies erfolgt ein Schutz der Hoheits- und Meeresgewässer und damit die Verwirklichung der Ziele von einschlägigen internationalen Übereinkommen zur Vermeidung und Beseitigung der Verschmutzungen (Art. 1, 2. Halbsatz WRRL).
Artikel 4 der WRRL beschreibt die Umweltziele differenziert nach Oberflächengewässern (lit. a) ), Grundwasser (lit. b) ) und Schutzgebieten (lit. c) ). Für Oberflächengewässer sieht sie die Verhinderung einer Verschlechterung des Zustands, die Verbesserung von natürlichen (Ziff. ii) und künstlichen bzw. erheblich veränderten Wasserkörpern (Ziff. iii), sowie das o.g. Phasing-Out-Ziel (Ziff. iv, siehe Kapitel 5.4) vor. Im Hinblick auf das Grundwasser ist das wesentliche Umweltziel das Trendumkehrgebot des Art. 4 Abs. 1 lit.
b) Ziff. iii) der WRRL. Die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, die nötigen Maßnahmen zu treffen, um alle signifikanten und anhaltenden Trends einer Steigerung der Konzentration von Schadstoffen aufgrund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten umzukehren. Artikel 5, 11 und 12 schreiben Analysen der Umweltauswirkungen menschlicher Tätigkeiten sowie die Aufstellung von Maßnahmenprogrammen und Bewirtschaftungsplänen vor. Die Definition der Klassifizierungen des Zustandes für die Gewässertypen ergibt sich aus den Anhängen.
Bei Erfüllung bestimmter Tatbestandsvoraussetzungen erlaubt Art. 4 Abs. 5 die "Verwirklichung weniger strenger Umweltziele" und damit Ausnahmen, die für die Zulassung von Einleitungen von Abwässern industrieller Herkunft eine wesentliche Rolle spielen können. Die Erreichung des guten Zustands aller Oberflächengewässer sowie des Grundwassers ist innerhalb von 15 Jahren nach In-Kraft-Treten der WRRL vorgesehen, wobei bei den Oberflächengewässern die Funktion als Lebensraum besonders zu berücksichtigen ist. Eine Verlängerung der Umsetzungsfrist gem. Art. 4 Abs. 4 WRRL ist möglich und in sehr vielen Fällen bereits unter der Festlegung weniger strenger Ziele gemäß Art. 4 Abs. 5 erfolgt.
Mit Erlass der WRRL hat sich das Verhältnis zwischen Umweltschutz und Gewässernutzung auf oberster Rechtsetzungsebene umgekehrt: Das Gewässerrecht ist von einem nutzungsbezogenen zu einem schutzgutbezogenen Ressourcen- bewirtschaftungsrecht entwickelt worden.2
3. Umsetzung der WRRL in nationales Recht
Eine Richtlinie ist hinsichtlich der zu erreichenden Ziele für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet ist, verbindlich und in nationales Recht umzuwandeln. Die Wahl der Mittel und der Form bleibt den staatlichen Stellen vorbehalten (vgl. dazu Art. 288 Abs. 3 AEUV3). Oftmals haben die Richtlinien einen hohen Detailierungsgrad und überlassen dem Gesetzgeber keine oder kaum substantielle Umsetzungs- und Ausfüllungsspielräume.
Umgesetzt wurden die Umweltziele der WRRL auf Bundesebene mit Ausnahme des Phasing-Out-Ziels (vgl. Art. 4 Abs. 1 lit. a) Ziff. iv) der WRRL) durch das Siebte Gesetz zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetz vom 18.06.20024 und finden sich eng angelehnt an die Vorgabe in den §§ 27 ff. und 47 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG)5 wieder. Es fällt auf, dass der Gesetzgeber diese Umsetzungspolitik durchgängig verfolgt, da auch mit dem Gesetz zur Neuregelung des Wasserrechts vom 31.07.20096 keine Konkretisierungen vorgenommen wurden, die die zu diesem Zeitpunkt bereits bestehende rechtswissenschaftliche Diskussion um das Verschlechterungsverbot aufzulösen vermochte. Der Text der deutschen Norm sollte sich sogar noch enger an die Vorgabe der WRRL anlehnen.7 Mit Urteil vom 11.09.2014 forderte der EuGH8 die Mitgliedstaaten explizit auf, eine eigengestalterische Ausfüllung der von der WRRL belassenen Freiräume vorzunehmen. Dieser Aufforderung ist der deutsche Gesetzgeber im Wasserrecht jedoch bisher nicht nachgekommen.
Das Phasing-Out-Ziel des Art. 4 Abs. 1 lit. a) Ziff. iv) der WRRL ist bislang nicht in nationales Recht umgesetzt worden. In einigen Fällen kommt jedoch eine unmittelbare Wirkung der Richtlinie ohne den expliziten nationalen Umsetzungsakt in Betracht. Zumindest im Fall eines Phasing-Out für Quecksilber, dessen Einleitung als Abfallprodukt der Rauchgaswäsche von Kohlekraftwerken in ein Gewässer nicht gänzlich vermieden werden kann, ist dies erfüllt. Das Ziel ist sowohl inhaltlich (Erreichung der Null-Emission von Quecksilbereinträgen in Oberflächengewässer) als auch im Hinblick auf die zeitliche Dimension, nämlich die Gewährleistung der Erreichung der Zielvorgaben bis 2028, unbedingt und hinreichend präzise definiert.9 Daraus resultiert eine Zielvorgabe, die von deutschen Behörden anzuwenden ist.
Überfällig ist noch die Anpassung des Bundeswasserstraßengesetzes (WaStrG)10. Die WRRL bezieht die künstlichen und erheblich veränderten Wasserkörper in Art. 4 Abs. 1 lit. a) Ziff. iii) der WRRL explizit ein. Nach Ansicht des BVerwG11 ist das WaStrG alslex specialisdem allgemeinen Wasserrecht vorzuziehen. Damit kommt dem WaStrG immense Bedeutung für die Umsetzung der WRRL bei allen Bundeswasserstraßen12 zu. Dort heißt es in § 8 Abs. 1 Satz 4 und in § 12 Abs. 7 Satz 2 WaStrG lediglich, dass in den §§ 27 bis 31 des WHG geregelten maßgebenden Bewirtschaftungsziele zu "berücksichtigen" seien.13 Als aquatische Ökosysteme und natürliche Ressourcen spielen die in Rede stehenden Gewässer noch immer nur eine untergeordnete Rolle, da die Ziele des WaStrG die Schiffbarmachung als Verkehrsweg sowie der Abfluss des Wassers sind (§§ 8 Abs. 1 Satz 1, 12 Abs. 2, 24 Abs. 1 WaStrG).
Die Ziele sind nicht nur zu berücksichtigen, sondern vielmehr konkrete und verbindliche Zielvorgaben, die bei Eingriffen in den Wasserhaushalt der Oberflächenwasserkörper anzuwenden sind und nicht nur Abwägungsbelange der Bundeswasserstraßenverwaltung. Die Umweltziele sind von allen Mitgliedstaaten bei allen Gewässern zwingend umzusetzen und zu erreichen. Abweichungen davon sind nur im Rahmen des Ausnahmeregimes (Art. 4 Abs. 3 bis 9 WRRL) möglich. Eine bloße Berücksichtigung des Gewässerbewirtschaftungsrechts und der europarechtlichen Zielvorgaben verstößt damit gegen zwingendes europäisches Recht und damit gegen die Verpflichtung zur vollständigen Umsetzung der WRRL. 14
4. Anforderungen an die Einleitungen
Einleitungen stehen unter dem Erlaubnis- oder Bewilligungsvorbehalt im Sinne des § 8 des WHG. Die Benutzungstatbestände führt § 9 WHG auf. Die Entscheidung steht im pflichtgemäßen Bewirtschaftungsermessen der zuständigen Behörde (§ 12 Abs. 2 WHG) und kann nur erteilt werden, wenn die Menge und Schädlichkeit des Abwassers so gering wie möglich gehalten wird (vgl. § 57 Abs. 1 Nr. 1 WHG). Für die Errichtung und den Betrieb von Abwasserbehandlungsanlagen sind eigene Genehmigungsverfahren durchzuführen. In § 60 WHG sind die Genehmigungsvoraussetzungen für den Bau und Betrieb geregelt. Beachtlich sind zudem die Vorgaben der jeweiligen Landeswassergesetze, nach dem die Anlagen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen müssen. Die Arbeitsblätter der DWA15 zum Beispiel regeln den Stand der Technik. In Bezug auf die Einleitungsqualität und -quantität konkretisiert die Abwasserverordnung (AbwV)16 die emissionsseitigen Anforderungen herkunftsspezifisch. Sie legt konkrete Grenzwerte für die direkte oder indirekte Einleitung fest. Einwirkungen von Einleitungen in Gewässer (Emissionsprinzip).
Gemäß § 57 Abs. 1 Nr. 2 WHG ist jedoch auch die gewässerseitige Situation bei der Entscheidung über eine Einleitung zu berücksichtigen (Immissionsprinzip). In Art. 4 Abs. 1 lit. a) Ziff. i) bis iv) beschreibt die WRRL die gewässerseitigen Anforderungen, die zur Erreichung oder Beibehaltung eines guten Zustandes einzuhalten sind. Somit ist die Gewässerverträglichkeit einer Einleitung in jedem Einzelfall zu berücksichtigen.
Überprüft werden müssen dabei die biologischen Parameter, die chemisch- physikalischen Parameter (Temperatur, Sauerstoffgehalt, Nährstoffverhältnisse, Salzgehalt, Versauerungszustand) und hydromorphologische Qualitätskomponenten (Durchgängigkeit des Gewässers, Wasserhaushalt [Abfluss und Abflussdynamik, Verbindung zu Grundwasserkörpern], morphologische Bedingungen [Tiefen- und Breitenvariation, Struktur und Substrat des Flussbettes, Struktur der Uferzone]). Die höchste Priorität haben aber die biologischen Komponenten, denn die hydromorphologischen, chemischen und chemisch-physikalischen Parameter nach Anhang V sind lediglich "in Unterstützung" der biologischen Komponenten zu werten. 17
Die zuständige Behörde kann folglich strengere Überwachungsanforderungen an die Einleitung stellen, wie es der Stand der Technik fordert, wenn die Belastungssituation und die Gewässereigenschaften auf Grund der „Nutzungserfordernisse und die besondere Schutzbedürftigkeit eines Gewässers z.B. für die Trinkwasserversorgung oder die Erholung der Bevölkerung (Baden/Fischen) und zur Bewahrung der natürlichen Funktionsfähigkeit des Gewässers oder des Natur- und Landschaftsschutzes" 18 dieses erfordern.
Ermessenslenkend sind weiterhin die wasserwirtschaftlichen Planungsvorgaben (vgl. §§ 82 ff. WHG), wobei insbesondere die Maßnahmenprogramme verbindliche Anordnungen von Maßnahmen zur Bewirtschaftung eines Gewässers enthalten.19 Darüber hinaus hat die zuständige Behörde in Bezug auf das Verschlechterungsverbot (§ 27 Abs. 2 WHG bzw. Art. 4 Abs. 1 lit. a) Ziff. i) der WRRL nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht den Umfang und die Grenzen des Einzelfalls mit auszugestalten. Die Behörde darf sich der Pflicht zur Berücksichtigung gewässerspezifischer Besonderheiten weder entziehen, noch die notwendigen Ermittlungen zu den konkreten Auswirkungen von Vorhaben Dritter auf den Vorhabenträger abwälzen. 20
5. Die Bewirtschaftungsziele der Wasserrahmenrichtlinie
Die langfristige Erreichung eines guten Zustandes der Wasserkörper soll durch die Bewirtschaftungsziele Verbesserungsgebot, Verschlechterungsverbot, Phasing-Out und Trendumkehrgebot für Grundwasser erfolgen. Diese Ziele ergänzen und verstärken sich gegenseitig. So ist bei dem Verbesserungsgebot eine Verschlechterung bereits ausgeschlossen. Das Phasing-Out-Ziel für die prioritären Stoffe ist eine spezielle Form des Verbesserungsgebots. Durch die Bewirtschaftungspläne (Art. 13 WRRL) und Maßnahmenprogramme (Art. 11 WRRL) entfalten die Bewirtschaftungsziele praktische Wirkung, da sie dort bezogen auf einzelne Gewässer konkretisiert und dadurch handhabbar werden. Sie sind aber auch bei jeder Einzelfallentscheidung im Rahmen der Prüfung des § 57 WHG zu berücksichtigen. Die Frist ist gem. Art. 4 Abs. 1 lit. a) Ziff. ii) der WRRL für die Erreichung eines guten ökologischen und chemischen Zustandes bzw. eines guten ökologischen Potenzials der Oberflächengewässer 2015 abgelaufen und bedurfte einer Verlängerung gem. Art. 4 Abs. 4 WRRL, wenn keine weitere Verschlechterung stattfindet und die Bedingungen der Ziff. i) bis iii) erfüllt werden. Dies dürfte nahezu flächendeckend der Fall sein. Alle genannten Ziele haben das Potenzial, künftige industrielle Großprojekte, wie etwa Kraftwerksneubauten zu verhindern, gäbe es nicht die Ausnahmen gem. Art. 4 Abs. 7 WRRL (§ 31 WHG).
5.1. Verbindlichkeit der Bewirtschaftungsziele
In der deutschen Literatur überwog schon seit langem die Meinung, dass die Umweltziele nicht rein "programmatischen" Charakter21 haben oder als "Bemühensnorm" 22 zu verstehen seien. Vielmehr seien sie auch bei jeder einzelnen Gewässerbenutzung und jedem einzelnen Gewässerausbau beachtlich. Der EuGH entschied sich im Fall "Acheloos"23 gegen die Ansicht, dass das Verschlechterungsverbot lediglich auf der planerischen Ebene zu berücksichtigen sei und im einzelnen Zulassungsverfahren über einen Programmansatz nicht hinausreiche.
Trotzdem musste sich das OVG Hamburg in Sachen Kohlekraftwerk Moorburg24 bei seiner Urteilsfindung mit einem Rechtsgutachten auseinandersetzen, demzufolge das Verschlechterungsverbot nur im Rahmen der einschlägigen Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme anwendbar sei.25 Dem widersprach das Gericht mit dem Hinweis, dass der § 27 Abs. 2 Nr. 1 WHG unmittelbar gültiges Recht sei und nicht nur nach Maßgabe der in §§ 82 ff. WHG vorgesehenen Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne zu berücksichtigen sei.
Diese Auslegungsfrage wurde vom BVerwG im Verfahren Weservertiefung mit Beschluss vom 11.07.2013 an den EuGH26 zur Vorabentscheidung weitergeleitet. Das BVerwG unterschied dabei zwischen dem Verschlechterungsverbot und dem Verbesserungsgebot und begründete beides auch separat. Grund dafür war, dass die Planfeststellungbehörde eine eigenständige Bedeutung des Verbesserungsgebots verneint hatte. 27
Mit Urteil vom 01.07.2015 stellte der EuGH28 klar, dass die maßgeblichen Bestimmungen des Art. 4 Abs. 1 WRRL die Mitgliedsstaaten verpflichtet, vorbehaltlich der Gewährung einer Ausnahme, die Genehmigung für ein konkretes Vorhaben zu versagen, wenn es eine Verschlechterung des Zustands eines Oberflächenwasserkörpers herbeizuführen vermag. Dies gilt auch, wenn die Erreichung des guten Zustandes bzw. eines guten ökologischen Potenzials zu dem nach der Richtlinie maßgeblichen Zeitpunkt gefährdet ist. Überdies ist das Verschlechterungsverbot in jedem Stadium der Durchführung der WRRL und für jeden Typ und Zustand eines Oberflächenwasserkörpers verbindlich. Dazu mehr unter Kapitel 5.3.2.
5.2. Das Verbesserungsgebot
Vorbehaltlich einer Ausnahme ist gem. Art. 4 Abs. 1 lit. a) Ziff. ii) der WRRL ein guter ökologischer und chemischer Zustand aller Oberflächengewässer zu erreichen und zu erhalten.
Die Kriterien für die Einstufung der Qualität von Struktur und Funktionsfähigkeit der aquatischen Ökosysteme, die in Verbindung mit den Oberflächengewässern stehen, sind dem Anhang V der WRRL zu entnehmen. Dieser Anhang enthält zur fachlichen Konkretisierung und Einstufung des ökologischen Zustands, gegliedert in die verschiedenen Oberflächengewässertypen, detaillierte hydro- morphologische, biologische und chemische bzw. chemisch- physikalische Qualitätskriterien. Mit Hilfe dieser Qualitätskriterien erfolgt für die einzelnen Gewässertypen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Der chemische Zustand in Deutschland ist flächendeckend nicht gut, weil die Umweltqualitätsnorm für Quecksilber von 20 µg/kg Biota Frischgewicht in sämtlichen Proben überschritten ist. (aus "Die Wasserrahmenrichtlinie, Deutschlands Gewässer 2015", Umweltbundesamt (Hrsg.), Dessau 2016)
mittels der so genannten normativen Begriffsbestimmungen eine Einstufung, ob ein "sehr guter", "guter" oder "mäßiger" ökologischer Zustand vorliegt.
Der "gute chemische Zustand" liegt dann vor, wenn kein Schadstoff die Umweltqualitätsnormen übersteigt, die in den gem. Art. 16 Abs. 7 WRRL erlassenen einschlägigen Rechtsnormen29 der Gemeinschaft über die Umweltqualitätsnormen geregelt sind.
Problematisch wird es, wenn sich ein Gewässer bereits in einem nicht guten Zustand in Bezug auf einen bestimmten Parameter, etwa Quecksilber, befindet. Gemäß Art. 4 Abs.
1 lit. a) Ziff. ii) der WRRL ist der Oberflächenwasserkörper zu verbessern und zu sanieren, um dem Umweltziel eines "guten chemischen Zustandes" im Rahmen der gegebenen Fristen näher zu kommen. Eine weitere Einleitung von Quecksilber durch ein neu errichtetes Kraftwerk gefährde die Erreichung des Umweltziels erheblich und sei damit prinzipiell ausgeschlossen. Selbst dann, wenn neutralisierende Maßnahmen getroffen würden, die dem Erhalt des Status Quo dienten. 30 In Deutschland befinden sich nahezu alle Oberflächenwasserkörper in einem nicht guten chemischen Zustand (siehe Abbildung 1). Das Verbesserungsgebot steht einem industriellen Großprojekt entgegen, wenn absehbar ist, dass dessen Umsetzung die Möglichkeit ausschließt, die Umweltziele der WRRL fristgerecht zu erreichen.
5.3. Das Verschlechterungsverbot
Die Bewirtschaftung eines Gewässers muss so erfolgen, dass eine Verschlechterung des ökologischen und chemischen Zustandes vermieden wird. Der Begriff "Verschlechterung" ist näher an der Vorgabe der WRRL angesiedelt, als die inhaltlich gleich geartete Vorläuferbestimmung "nachteilige Veränderung". Eine Verschlechterung meint grundsätzlich jede Einwirkung auf den Gewässerzustand, die sich in ökologischer oder chemischer Hinsicht nicht positiv oder neutral niederschlägt. Selbst wenn die Beeinträchtigungen gering sind, jedoch oberhalb einer durch den rechtsstaatlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz vorgezeichneten Erheblichkeitsgrenze liegen, können sie bereits unzulässig sein.31
In der Vergangenheit avancierte die Auseinandersetzung, ab wann eine Verschlechterung anzunehmen ist, zur wichtigsten Streitfrage des Wasserrechts und entfernte sich durch die immer komplexer werdenden interdisziplinären Deutungsansätze von der Vollzugsfähigkeit. Erst mit dem EuGH-Urteil vom 01.07.2015 32 konnte der Knoten durchschlagen werden (Siehe dazu Kapitel 5.3.2).
5.3.1. Stufentheorie (auch: Zustandsklassentheorie) und Status- quo-Theorie
Maßgeblich, auch aus Praktikabilitätsgründen, für dieStufentheorieist der Zustandsklassenwechsel der in Anhang V der WRRL näher beschriebenen Zustandsklassen für eine differenzierte Betrachtung des ökologischen Zustands von Oberflächengewässern. Bei dem chemischen Zustand sieht die WRRL nur den "guten" und "nicht guten" Zustand vor. Befände sich nun ein Gewässer im "nicht guten" Zustand, liefe die Stufentheorie ins Leere, da ja keine weitere Verschlechterung (und damit Wechsel in eine schlechtere Zustandsklasse) mehr möglich wäre. Damit wäre die Theorie in Bezug auf den chemischen Zustand nicht anwendbar und die Gewässer und die darin vorkommenden Biota könnten endlos weiter belastet werden. Diese Auslegung widerspricht jedoch dem Zweck der WRRL (vgl. Art. 1). Die Legaldefinition des ökologischen Zustands in Art. 2 Nr. 21 WRRL legt dennoch eine Auslegung im Sinne der Stufentheorie nahe. Weiterhin waren in der Vergangenheit auch die EU- Wasserdirektoren der Auffassung, dass ein Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot erst dann vorläge, wenn die Einstufung in eine schlechtere Zustandsklasse erfolge.33
Frankreich regelte in seinem Wassergesetz ausdrücklich, dass ein Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot nur dann vorliegt, wenn der Wasserkörper in eine schlechtere Zustandsklasse kategorisiert wird. 34
Für industrielle Einleitungen aus großen Anlagen würde dies bedeuten, dass oftmals keine Verschlechterung in entsprechend vorgeprägten Gewässern anzunehmen wäre. Jedoch hätte das Verschlechterungsverbot keinen eigenständigen Gehalt, wenn jede Verschlechterung nicht gleichzeitig auch gegen das Verbesserungsgebot verstieße. Eine Sperrwirkung entfalte das Verbesserungsgebot jedoch nur, wenn sich absehen ließe, dass die Verwirklichung eines Vorhabens die Möglichkeit ausschließe, die Umweltziele der WRRL fristgerecht zu erreichen.35
Konträr dazu ist jede oder zumindest jede erhebliche nachteilige Beeinträchtigung der Wasserqualität gemäß derStatus-quo-Theorieeine Verschlechterung im Sinne der §§ 27
Abs. 1 Nr. 1 und 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG. Damit ist jede Einwirkung in ökologischer und chemischer Hinsicht gemeint, die sich nicht positiv oder neutral im Gewässerzustand verhält. Der Wechsel in eine andere Zustandsklasse ist nicht maßgeblich. Offen ist noch, ab wann eine Beeinträchtigung erheblich ist. Die Prüfung der Erheblichkeit kann sich nur aus der WRRL und ihren Tochterrichtlinien als Maßstab ergeben.36 Zur Orientierung beim chemischen Zustand der Oberflächengewässer können die Umweltqualitätsnormen der Umweltqualitätsnormenrichtlinie (UQN-RL)37 herangezogen werden, da sie gemäß Art. 3 Nr. 35 WRRL nicht überschritten werden dürfen. Demnach ist jede Einwirkung auf das Gewässer, die einer Erreichung des Biota-Werts gemäß Art. 3 Abs. 2 lit. a) der UQN-RL der Zielerreichung entgegenwirkt, als erheblich zu werten. Somit ist jede Quecksilbereinleitung als erheblich zu werten, wenn sie sich nicht positiv oder neutral auf den Gewässerzustand auswirkt. Für die wasserrechtliche Erlaubnisfähigkeit industrieller Großprojekte bedeutet dies, dass nur der Weg über die Ausnahme gem. § 31 WHG zulässig wäre, sofern deren Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt wären.
5.3.2. Das EuGH-Urteil vom 01.07.2015 zur Vertiefung der Weser
In Sachen "Weservertiefung" wurde vom BVerwG ein Vorabentscheidungsersuchen beim EuGH eingereicht. Betroffen war der Ausbau der Weser, die nicht nur ein Oberflächengewässer, sondern auch eine bedeutende Wasserstraße ist. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) klagte gegen den Planfeststellungsbeschluss der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung der Bundesrepublik Deutschland bezugnehmend auf das Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot. Das in Rede stehende Ausbauvorhaben sah massive Eingriffe durch die Vertiefung der Fahrtrinne vor, obwohl der Tiefwasserhafen von Wilhelmshaven nicht ausgelastet war. Dies hätte erhebliche Einwirkungen aus hydrologischer und hydromorphologischer Hinsicht gehabt, wie etwa die Erhöhung der Fließgeschwindigkeit bei Ebbe und Flut und die Erhöhung des Salzgehaltes.
Der EuGH hat auch mit diesem Beschluss wenig überraschend bestätigt, dass das Verschlechterungsverbot einen nicht rein programmatischen Charakter in der Bewirtschaftungsplanung entfaltet, sondern unmittelbare Bindungswirkung in jedem wasserrechtlichen Zulassungsverfahren hat. Dabei ist die wasserrechtliche Zulassung eines bestimmten Vorhabens zu versagen, wenn daraus eine Verschlechterung eines bestimmten Oberflächenwasserkörpers resultieren kann oder wenn es die Erreichung der maßgeblichen Umweltziele gefährdet. 38
Neue Impulse setzte der EuGH gleichwohl abweichend von den Schlussanträgen des Generalanwalts Jääskinen: Eine Verschlechterung eines Oberflächenwasserkörpers ist dann anzunehmen, wenn sich der Zustand mindestens einer Qualitätskomponente im Sinne des Anhangs V WRRL um eine Klasse verschlechtert. Dies gilt auch dann, wenn sich die Einstufung der Zustandsklasse insgesamt nicht ändert. Befindet sich ein Oberflächenwasserkörper bereits in der schlechtesten Zustandsklasse, gilt abweichend jede Verschlechterung dieser Komponente als Zustandsverschlechterung im Sinne des Art. 4 Abs. 1 lit a) Ziff. i WRRL. Damit entschieden sich die Richter für einen eigenen Mittelweg, der sich keiner der beiden Theorien ohne weiteres zuordnen lässt. In der Begründung wird zunächst die Zustandsklassentheorie mit Verweis auf den Richtlinientext verworfen.39 Allein der Art. 4 Abs. 1 lit. a) Ziff. i WRRL begründet die Verpflichtung einer Verschlechterung eines Oberflächenwasserkörpers, ohne dabei etwaige Einstufungen in Klassen zu berücksichtigen. Im formalen, systematischen Umkehrschluss folgt dasselbe für Art. 4 Abs. 1 lit. a) Ziff. ii und iii WRRL, wobei jedoch anders als in Art. 4 Abs. 1 lit. a) WRRL durch den expliziten Verweis auf Anhang V Bezug zur Klasseneinteilung genommen wird. Anders könnten die Mitgliedsstaaten nicht dazu bewegt werden, Zustandsverschlechterungen innerhalb der Zustandsklassen zu verhindern.40 Dies würde ansonsten den Gewässerschutz in den höchsten Zustandsklassen weiter schwächen. 41
Das Gericht entschied gegen ein pauschales Erheblichkeitskriterium, weil es eine Interessenabwägung eröffne, die der Ausnahmebestimmung des Art. 4 Abs. 7 WRRL und nicht dem Verschlechterungsverbot des Art. 4 Abs. 1 lit. a) Ziff. i WRRL vorbehalten sei.42
Für die Zulassung von Vorhaben stellt das Urteil der Luxemburger Richter eine Erleichterung dar und das nicht nur, weil der gordische Knoten nun zerschlagen ist. Grundsätzlich ist nicht jede nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften, anders als vom Generalanwalt vorgebracht, eine Verschlechterung im Sinne des Art. 4 Abs. 1 lit.
a) Ziff. i WRRL. Anders sieht dies freilich für die Qualitätskomponenten in der untersten Kategorie aus. Dort ist jede weitere nachteilige Veränderung auch eine (weitere) Verschlechterung. Es bleibt der Weg über eine Ausnahme nach Art. 4 Abs. 7 WRRL. Wird also bei der Umsetzung eines Vorhabens ein weiterer Klassenabstieg einzelner Qualitätskomponenten verhindert, können die zuständigen Behörden grundsätzlich und uneingeschränkt die Abwärtsbewegung aller Komponenten innerhalb der Klassengrenzen zulassen. Dies gilt natürlich mit der bereits genannten Einschränkung, dass eine weitere negative Beeinträchtigung eines in der schlechtesten Zustandsklasse befindlichen Gewässers unzulässig ist. Als Folge kann angenommen werden, dass sich Vorhabenträger, Wasserwirtschaftsbehörden und Verwaltungsgerichte weniger um den Erhalt des Gesamtzustands eines Oberflächenwasserkörpers kümmern werden, als vielmehr um die vom Abstieg bedrohten Qualitätskomponenten. Dies kann den partikulären Ansatz der Gewässerbewirtschaftung fördern. Zwar kanalisiert dies die Begründungspflichten und konzentriert die Entscheidungsmaßstäbe, es verringert aber auch die Notwendigkeit für den übergeordneten Blick auf den Gesamtzusammenhang der Bewirtschaftung und damit auf den Gesamtzustand. 43
Wasserwirtschaftlich dem Ziel entgegenstehend ist die formalistische Auslegung des Gerichts in Bezug auf den Abstieg einzelner Qualitätskomponenten, wenn der Zustandsklassenkorridor einer oder mehrerer Qualitätskomponenten vom oberen bis zum unteren Rand vollständig ausgenutzt wird. Dies sei, so die Richter, keine Verschlechterung, wohl aber eine geringfügige Änderung, die einen Zustandsklassenwechsel verursacht, selbst dann, wenn andere Qualitätskomponenten nicht betroffen sind oder sich sogar verbessern.
Weiterhin für die Zielerreichung nachteilig dürfte es sein, dass das Urteil keinen Schluss auf die Begriffserklärungen Verhältnismäßigkeit, Erheblichkeit oder Bagatellfall zulässt, da sie nur oberflächlich umgangen wurden.44 Als Beispiel sei die biologische Qualitätskomponente der benthischen wirbellosen Fauna in Flüssen45 genannt, die "geringfügige Anzeichen für Abweichungen von den typspezifischen Werten" zum Kriterium für den guten Zustand macht. Dies sei nur exemplarisch für die überwiegend undeutlichen Beschreibungen des Anhang V der WRRL genannt, die letztlich darüber rechtlich verbindlich entscheiden, ob ein Zustandsklassenwechsel stattfindet und im konkreten Fall eine Verschlechterung vorliegt, die einem Vorhaben nur noch die Möglichkeit über die Ausnahme gestattet. Diese formaljuristische Instrumentalisierung als entscheidendes Kriterium über das Vorliegen einer Verschlechterung gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. a) Ziff. i) WRRL stellt die materiellen Unschärfen des Anhangs V der WRRL in den Vordergrund und verlagert damit lediglich die Kontroverse. Reinhardt spricht insoweit von "einem rechtstaatlich problematischen immanenten Bestimmtheitsdefizit".46
Überdies problematisch ist weiterhin die Übertragung des Judikats auf den chemischen Zustand eines Oberflächenwasserkörpers oder auf den mengenmäßigen und chemischen Zustand eines Grundwasserkörpers. Eine Abwägung der Verhältnismäßigkeit im Tatbestand des Art. 4 Abs. 1 lit. a) Ziff. i) WRRL beispielsweise für den chemischen Zustand wurde durch die Richter unmöglich gemacht, was eine Auslegung im Sinne von unumgänglichen oder gebotenen Gewässerbenutzungen ausschließt.
Dem Wortlaut gemäß Art. 4 Abs. 7 WRRL nach bezieht sich die Ausnahme lediglich auf den ökologischen Zustand bzw. auf das ökologische Potenzial eines Oberflächenwasserkörpers. Der chemische Zustand ist nicht genannt. Damit wären im Einzelfall bestimmte individuelle Belastungen vorprogrammiert, die das geltende Recht nicht angemessen zu regeln in der Lage ist.
5.3.3. Anwendbarkeit in Bezug auf den chemischen Zustand eines Oberflächenwasserkörpers
Wie bereits beschrieben kann der chemische Gewässerzustand nur gut oder schlecht sein. 47 Befindet sich ein Oberflächenwasserkörper bereits in einem schlechten Zustand, ist jede weitere Verschlechterung unzulässig. Wie bereits ausgeführt, ist die Verschlechterung des chemischen Zustands nicht im Ausnahmetatbestand des Art. 4 Abs. 7 WRRL aufgeführt. Zudem sind in diesem Fall die Konzentrationswerte der Umweltqualitätsnormen-Richtlinie anzuwenden, was zur Konsequenz hätte, dass nun jeder Verstoß gegen eine Umweltqualitätsnorm durch z.B. die Einleitung eines prioritären Stoffes in ein bereits als schlecht klassifiziertes Gewässer zu einer Verschlechterung im Sinne des Art. 4 Abs. 1 lit. a) Ziff. i) der WRRL führen würde. Dies ist in Deutschland flächendeckend der Fall, weil die Novellierung der o.g. Umweltqualitätsnormen-Richtlinie zu dem Ergebnis führte, dass sich nun alle Gewässer auf Grund des ubiquitär auftretenden Quecksilbers im nicht guten Zustand befinden (siehe Abbildung 1). 48
Nicht zuletzt durch den Ausschluss der verhältnismäßigkeitsorientierten Erheblichkeits- und Bagatellschwellen im Tatbestand des Verschlechterungsverbots kann nur eine Versagung der wasserrechtlichen Zulassung einer Gewässerbenutzung durch z.B. die Einleitung von Abwasser aus der Rauchgasentschwefelung eines Kraftwerkes, die Folge sein, obwohl die Quecksilberelimination dem Stand der Technik entspricht. Deshalb sollte die Frage erneut dem EuGH vorgelegt werden. Zweifelhaft ist nämlich, ob der höchstrichterlichen Instanz die Tragweite ihrer Entscheidung vom 01.07.2015 (siehe Kapitel 5.3.2) und die damit verbundenen Konsequenzen bewusst waren. 49
5.4. Das Phasing-Out-Ziel
Die Mitgliedstaaten führen gemäß Art. 16 Abs. 1 und 8 WRRL die notwendigen Maßnahmen durch mit dem Ziel, die Verschmutzung durch prioritäre Stoffe schrittweise zu reduzieren und die Einleitungen, Emissionen und Verluste prioritär-gefährlicher Stoffe zu beenden oder schrittweise einzustellen (Art. 4 Abs. 1 lit. a) Ziff. iv) WRRL).
Das zweite Ziel dient erkennbar der völligen Einstellung der anthropogenen Emissionen der besagten Stoffe.
Die Liste der prioritären und der prioritären gefährlichen Stoffe wurde mit der Entscheidung Nr. 2455/2001/EG50 festgelegt. Sie umfasst insgesamt 33 Stoffe bzw. Stoffgruppen. 14 Stoffe wurden dabei in eine dritte Kategorie zur Überprüfung als prioritäre gefährliche Stoffe eingestuft. Prioritäre Stoffe stellen generell ein erhebliches Risiko für die aquatische Umwelt dar. Prioritär-gefährliche Stoffe sind darüber hinaus toxisch, persistent und bioakkumulierbar oder im ähnlichen Maße besorgniserregend. 51 Dieses Umweltziel ist bisher nicht in nationales Recht umgesetzt worden, in Zulassungsverfahren jedoch zu beachten (Näheres siehe Kapitel 3).
Zur Erreichung beider Ziele sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, die gemäß Art. 16 Abs.
1 und 8 WRRL erforderlichen Maßnahmen durchzuführen. Zwar wurde das Reduktionsziel 2008 durch die UQN-RL konkret gefasst, die speziellen Maßnahmen, die Art. 16 Abs. 8 i.V.m. Abs. 6 2. Spiegelstrich WRRL vorsieht, liegen allerdings nicht vor. Das Phasing-Out-Ziel verlangt jedoch nicht den sofortigen Stopp aller Einleitungen, sondern erlaubt ausdrücklich eine schrittweise Einstellung. Jedoch müssen einem Betreiber alle notwendigen und technisch möglichen "anspruchsvollen" Maßnahmen zur Reduzierung der Fracht abverlangt werden. 52
Dies bedeutet, dass neue Einleitungen möglich sind, wenn im Rahmen von Bewirtschaftungsmaßnahmen die Frachten der bestehenden Einleitungen reduziert wird, so dass insgesamt eine Reduzierung des Eintrages von prioritär gefährlichen Stoffen erreicht wird. Die Antwort der Europäischen Kommission vom 27.01.2010 an die Deutsche Umwelthilfe untermauert diese Vorgehensweise, wonach das Phasing-Out-Ziel "nicht zwangsläufig ein vollständiges Verbot neuer Genehmigungen [bedeutet]". Die Kommission vertritt die Auffassung, dass das Phasing-Out-Ziel nur mit einer neuen Zulassung zu vereinbaren ist, wenn eine Bewertung der gesamt getroffenen Maßnahmen im Zusammenhang mit einem Stoff erfolgt.
Bestehende Einleitungen sind nachzurüsten, so dass die Freisetzung von prioritär- gefährlichen Stoffen soweit begrenzt wird, wie dies technisch machbar und verhältnismäßig ist. Im Hinblick auf die wasserrechtlichen Erlaubnisse besteht die Möglichkeit, auch nachträglich Nebenbestimmungen gemäß § 13 Abs. 1 WHG festzulegen. Insbesondere Anforderungen an die Beschaffenheit einzubringender und einzuleitender Stoffe gehören gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 1 WHG zu den zulässigen Nebenbestimmungen. Diese erhöhten Anforderungen betreffen die physikalische, chemische und biologische Beschaffenheit, vor allem die Reinheit der Stoffe. 53 Dieses Umweltziel lässt sich nicht innerhalb einer kurzen Zeitspanne umsetzen. Im Hinblick auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und das Verursacherprinzip ist eine systematische und konzertierte Vorgehensweise der zuständigen Behörden erforderlich.54
5.5. Das Trendumkehrgebot
Zusätzlich zu den genannten Umweltzielen (Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot) gilt für das Grundwasser das Trendumkehrgebot gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. b) WRRL bzw. § 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG. Demnach müssen alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen umgekehrt werden, wenn sie Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten sind, um so die Verschmutzung des Grundwassers schrittweise zu reduzieren. Dieses Ziel dient der Erreichung eines guten chemischen Zustands. Es soll frühzeitig auf einen Anstieg von Schadstoffkonzentrationen in Grundwasserkörpern, möglichst vor Erreichen der Grenzwerte, reagiert werden. Das betrifft insbesondere die Grundwasserkörper, die im Rahmen der Bestandsaufnahme als gefährdet eingestuft wurden. Die Maßnahmen, die zur Verhinderung oder Begrenzung des Eintrags von Schadstoffen in das Grundwasser notwendig sind, konkretisiert die Grundwasser-Richtlinie 2006/118/EG 55 in Art. 6.
Die Stoffe der Nrn. 1 bis 9 des Anhangs VIII der WRRL werden als gefährlich erachtet. Es sind alle notwendigen Maßnahmen zur Verhinderung des Eintrags in das Grundwasser zu ergreifen. Für alle anderen Stoffe, von denen eine Verschmutzungsgefahr ausgeht, gilt ein Begrenzungsgebot. 56
5.6. Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der zweigeteilte Verschlechterungsbegriff des EuGH-Urteils vom 01.07.2015 tendenziell zu einer rechtsmethodischen Erleichterung industrieller Großprojekte führen wird, weil selbst nachteilige Veränderungen eines Wasserkörpers nicht als Verschlechterung zu werten sind, solange alle maßgeblichen Qualitätskomponenten in ihrer Klasse gehalten werden können. Dies gilt nicht, wie bereits geschildert, für Wasserkörper, die sich bereits im schlechten Zustand befinden. Unklar bleibt jedoch, ab wann sich eine Klasseneinstufung ändert. Die Maßstäbe des Anhang V sind nicht hinreichend präzise und bieten Potenzial für künftige Rechtsstreitigkeiten.
Das Verbesserungsgebot verfolgt das Ziel, die Oberflächengewässer in einem guten ökologischen und chemischen Zustand zu bringen. Wenn ein Großprojekt in der Lage ist die Erreichung eines guten Zustands dauerhaft zu gefährden, so steht das Verbesserungsgebot der Umsetzung dieses Vorhabens entgegen. Für Grundwasserkörper ist ein guter mengenmäßiger und chemischer Zustand anzustreben. Diese konkreten Schritte sind für einzelne Oberflächenwasserkörper oder Grundwasserkörper in Maßnahmenprogramme festzulegen.
Die Berücksichtigung des Phasing-Out-Ziels ist im Rahmen des Zulassungsverfahrens unerlässlich, auch wenn es nicht abschließend in nationales Recht transformiert wurde. Diesem Umweltziel kann durch die weitestgehende technisch mögliche und verhältnismäßige Begrenzung der Einleitung, Emissionen und Verluste prioritär- gefährlicher Stoffe in Gewässern Rechnung getragen werden. Es verlangt keine Nullemission, jedoch eine Bewirtschaftung mit dem Ziel, den absoluten Eintrag der in Rede stehenden Stoffe in einen Wasserkörper nicht zu erhöhen.
6. Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen
Infrastrukturvorhaben ab einer bestimmten Größe führen regelmäßig zu einer Verschlechterung der Gewässereigenschaften. Insbesondere im Kontext zum ergangenen EuGH-Urteil vom 01.07.2015 und der strikten Auslegung des Verschlechterungsverbotes in Bezug auf sich im schlechten Zustand befindliche Oberflächengewässer (s. Kapitel 5.3.2) wird die Möglichkeit einer Ausnahme gemäß Art. 4 Abs. 7 WRRL bzw. § 31 Abs. 2 WHG größere Bedeutung erlangen. Die Ausnahme gilt auch für Grundwasser, da § 47 Abs. 3 WHG auf § 31 Abs. 1 und 2 Satz 1 und Abs. 3 WHG verweist.
Die Ausnahme nach § 31 Abs. 1 WHG gestattet nur vorübergehende Verschlechterungen bzw. Abweichungen vom Zielerreichungsgebot (= Verbesserungsgebot) und ist deshalb für Großprojekte eher zu vernachlässigen, da dort mit anhaltenden negativen Änderungen der Gewässereigenschaften gerechnet werden muss.
Bemerkenswert ist jedoch die Tatsache, dass als Tatbestandsmerkmal in § 31 Abs. 2 WHG die Nichterreichung oder das Verschlechtern des guten ökologischen Zustands explizit genannt wurde. Somit ist bewusst der chemische Zustand für eine dauerhafte negative Veränderung eines Oberflächengewässers ausgenommen worden. Die Ausnahme für eine vorübergehende Verschlechterung (Abs. 1) differenziert hier nicht.
Für eine dauerhafte Ausnahme gem. § 31 Abs. 2 WHG müssen vier Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein. Zum einen ist dies eine neue Veränderung der physischen Gewässereigenschaften oder des Grundwasserstandes (Nr. 1). Zum anderen müssen die Gründe für eine Veränderung vom übergeordneten öffentlichen Interesse sein (Nr. 2).
Alternativmaßnahmen mit wesentlich geringeren nachteiligen Auswirkungen, die bei technischer Durchführbarkeit verhältnismäßig sind, dürfen nicht zur Verfügung stehen (Nr. 3). Weiterhin müssen alle geeigneten Maßnahmen ergriffen worden sein, um die nachteiligen Veränderungen des Gewässerzustands zu verringern (Nr. 4). Die Ausnahmen müssen im Bewirtschaftungsplan gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 3 aufgenommen werden.57
Konkretisierende Urteile zum Ausnahmetatbestand liegen bislang nur vereinzelt vor. Als Grundlage für die Ausnahmeprüfung bedarf es laut dem Hinweisbeschluss des Bundesverwaltungsgerichtes der fehlerfreien Ermittlung des Ist-Zustandes des betreffenden Gewässers. Die angewandte Methodik zur Ermittlung der Verschlechterung und Ausnahmefähigkeit müsse schlüssig und transparent gestaltet werden. Überdies müsse sie "fachlich unterfüttert" sein. Der zuständigen Behörde komme hier ein Einschätzungsspielraum zu, da bisher keine anerkannte Standardmethode existiere.58 Eine Alternative im Sinne des § 31 Abs. 2 Nr. 3 WHG sei dann unzulässig, wenn sich gegenüber den geplanten Vorhaben nur geringe Verbesserungen ergäben, jedoch mit einem sehr hohen Mehraufwand verbunden seien, so das OVG Hamburg.59
Ausnahmeprüfungen können in einem Genehmigungsverfahren auch vorsorglich erfolgen, wenn angenommen wird, dass die gerichtliche Überprüfung ergibt, es läge doch eine Verschlechterung des Gewässers vor. Diese hilfsweise Ausnahmeprüfung in behördlichen Genehmigungsverfahren ist gängige Verwaltungspraxis und gerichtlich bestätigt. 60
6.1. Neue Veränderungen der physischen Gewässereigen- schaften oder des Grundwasserstandes
Die im Gewässer festgestellte oder prognostizierte Verschlechterung des Zustands muss zu einer neuen Veränderung der Gewässereigenschaften oder des Grundwassers führen um ausnahmefähig zu sein. Zweifelsohne müssen diese Veränderungen anthropogenen Ursprungs sein und dürfen keine natürlichen Gründe haben.61 Die Veränderung ist als neu zu werten, wenn sie nach dem Zeitpunkt der nationalen Umsetzung der WRRL, somit also nach dem 25.06.2002, vorgenommen wurde.62
Ungeklärt ist jedoch noch, was unter physische Gewässereigenschaften zu verstehen ist und ob chemische Veränderungen durch z.B. das Einleiten von Abwasser dazu gehören und damit ausnahmefähig sind. Einer sehr engen Auslegung nach sind hiervon lediglich die Veränderungen der Wassermenge und die Hydromorphologie erfasst. Chemische Änderungen des Gewässerzustandes seien nicht ausnahmefähig, so die Europäische Kommission. Zudem seien durch Schadstoffeinträge verursachte Verschlechterungen aus Punktquellen und diffusen Quellen, die zu einem schlechteren als den guten Zustand eines Oberflächenwasserkörpers führen, grundsätzlich nicht durch eine Ausnahme gedeckt.63 Nachvollziehbar und begründbar, weshalb insbesondere die chemischen und ökologischen Änderungen ausgeklammert sind, ist dies aufgrund der Systematik der WRRL nicht. Vermehrt wird in der rechtswissenschaftlichen Literatur64 eine weite Auslegung des Begriffs "physisch" vertreten. Demnach seien alle in § 3 Abs. 7 WHG aufgeführten Gewässereigenschaften einzubeziehen und damit ausnahmefähig. Diese Auslegung erscheint sinnvoll, weil es nicht begreiflich ist, dass ein massiver hydromorphologischer Eingriff (etwa die Begradigung eines Gewässers) grundsätzlich von einer Ausnahme gedeckt sei, Unterhaltungsmaßnahmen wie das Ausbaggern von Sedimenten, die zu einer Remobilisierung von Schadstoffen führen können, jedoch nicht.65
6.2. Das übergeordnete öffentliche Interesse
Weiterhin müssen die Gründe für die zuzulassende Ausnahme von übergeordnetem öffentlichen Interesse sein oder der Nutzen der neuen Veränderung für die Gesundheit oder Sicherheit des Menschen oder für die nachhaltige Entwicklung größer sein als der Nutzen, den die Erreichung der Bewirtschaftungsziele für die Umwelt und die Allgemeinheit hat (§ 31 Abs. 2 Nr. 2 WHG). Der Begriff des öffentlichen Interesses wird im WHG mehrfach genannt und ist mit dem Wohl der Allgemeinheit gleichzusetzen. Neben echten wasserwirtschaftlichen Belangen (etwa Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Hochwasserschutz) umfasst das übergeordnete öffentliche Interesse auch die Daseinsfürsorge in Form der Energiebereitstellung (aus erneuerbaren Ressourcen, aber auch konventionell), Verkehr sowie "gewerbliche Interessen von nicht unerheblicher volkswirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Bedeutung".66
Die Sicherung der Energieversorgung für die Allgemeinheit durch ein Kohlekraftwerk mit Strom, Bahnstrom und der Fernwärmeproduktion als übergeordnetes öffentliches Interesse wäre demnach anzuerkennen. Dabei erfolgt eine Abwägung zwischen dem Interesse an der Bereitstellung der o.g. Produkte und dem Interesse an der Integrität eines Oberflächenwasserkörpers und den Bewirtschaftungszielen.
6.3. Alternativlosigkeit zu den verfolgten Zielen
Die mit der Veränderung des Gewässers verfolgten Ziele dürfen nicht mit anderen Maßnahmen erreichbar sein, die wesentlich geringere nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hätten, sie müssen technisch machbar sein und dürfen mit keinem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden sein. Alternativ sind ein anderer Ort, eine andere Größenordnung oder andere Prozesse in Erwägung zu ziehen.67 Der Belastungsvergleich beschränkt sich nicht lediglich auf das Schutzgut Wasser, sondern bezieht sich auf die Umwelt insgesamt. Eine Alternative darf somit nicht zu Lasten anderer Umweltkompartimente gehen. 68 Da die Alternative nicht mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden sein darf, ist zusätzlich zu der ökologischen und technischen auch die ökonomische Verhältnismäßigkeit abzuprüfen. Die Alternative ist demnach unverhältnismäßig, wenn sie zwar wesentlich geringere Auswirkungen auf die Umwelt hat und zudem technisch machbar wäre, aber höhere Kosten verursacht. 69
Parallel hierzu drängt sich die Alternativenprüfung im Habitatschutzrecht gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)70 auf. In diesem Zusammenhang wies das BVerwG darauf hin, dass von einer Alternative "dann nicht mehr die Rede sein [kann], wenn sie auf ein anderes Projekt hinausläuft, weil die vom Vorhabenträger in zulässiger Weise verfolgten Ziele nicht mehr verwirklicht werden könnten. Zumutbar ist es nur, Abstriche vom Zielerfüllungsgrad in Kauf zu nehmen. Eine planerische Variante, die nicht verwirklicht werden kann, ohne dass selbstständige Teilziele, die mit dem Vorhaben verfolgt werden, aufgegeben werden müssen, braucht dagegen nicht berücksichtigt werden." 71
6.4. Minimierungsgebot
Laut § 31 Abs. 2 Nr. 4 WHG hat ein Vorhabenträger alle praktikablen und zumutbaren Maßnahmen vorzusehen, um die nachteiligen Auswirkungen auf den Gewässerzustand so gering wie möglich zu halten. Im engeren Sinne handelt es sich hierbei nicht um eine Zulassungsvoraussetzung, sondern verpflichtet lediglich zur Ergreifung aller in Betracht kommender praktisch geeigneter Maßnahmen, um den nachteiligen Auswirkungen auf die Gewässer entgegenzusteuern.72 In der richtlinienrechtlichen Vorgabe des Art. 4 Abs. 7 lit. a) WRRL ist dies als Bedingung formuliert und wurde abgeschwächt in das WHG transformiert. Spezifizierte kompensatorische Handlungspflichten erwachsen nicht daraus.
6.5. Neue nachhaltige Entwicklungstätigkeiten
§ 31 Abs. 2 Satz 2 WHG lässt zudem eine Verschlechterung von einem sehr guten zu einem guten Zustand als Ausnahme zu, wenn es sich um nachhaltige Entwicklungstätigkeiten handelt. § 28 Nr. 1 WHG beschreibt die Tätigkeiten, die bei Erfüllung der in § 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 4 genannten Bedingungen von einer Ausnahme abgedeckt werden können. Nachhaltig bedeutet, dass die Einwirkungen nicht nur im unerheblichen Umfang und für eine längere Dauer bestehen.
6.6. Zusammenfassung
Die dauerhaften Ausnahmen für industrielle Großprojekte, die regelmäßig den Bewirtschaftungszielen entgegenstehen werden, gewinnen zukünftig an Bedeutung. In Bezug auf die Auslegung und Anwendung der wasserrechtlichen Ausnahmemöglichkeit sind einige Fragen noch unbeantwortet. Dies betrifft insbesondere die Auslegung des Begriffs physische Veränderungen, die Berücksichtigung von Ausgleichsmaßnahmen im Gewässerkörper und das Verhältnis von Bewirtschaftungs- und Maßnahmenplänen zu den Ausnahmen. Diese Fragen dürften Gegenstand weiterer Auseinandersetzungen werden.
7. Übertragbarkeit auf Indirekteinleitungen
Wenn in der AbwV an den Ort des Anfalls des Abwassers oder vor dem Ort seiner Vermischung Anforderungen festgelegt sind, bedarf das Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage (Indirekteinleitung) einer Genehmigung gemäß § 58 WHG.
Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn die nach der AbwV für die Einleitung maßgeblichen Anforderungen einschließlich der allgemeinen Anforderungen erfüllt werden (§ 58 Abs. 2 Nr. 1 WHG), die Erfüllung der Anforderungen an die Direkteinleitung nicht gefährdet wird (§ 58 Abs. 2 Nr. 2 WHG) und Abwasseranlagen oder sonstige Einrichtungen errichtet und betrieben werden, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Anforderungen nach den Nummern 1 und 2 sicherzustellen (§ 58 Abs. 2 Nr. 3 WHG). Die Anforderungen an die Direkteinleitung im Sinne des § 58 Abs. 2 Nr. 2 WHG ergeben sich aus § 57 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 WHG. Demnach muss die Menge und Schädlichkeit des Abwassers so gering wie möglich gehalten werden, wie dies bei Einhaltung der jeweils in Betracht kommenden Verfahren nach dem Stand der Technik möglich ist. Die Einleitung muss mit den Anforderungen an die Gewässereigenschaften und sonstigen rechtlichen Anforderungen vereinbar sein. Das Einleiten in eine öffentliche Abwasseranlage ist keine Gewässerbenutzung im Sinne des § 9 WHG.
Die Anforderungen an die Direkteinleitung sind gefährdet, wenn auf Grund der Indirekteinleitung die Erlaubnis für die Direkteinleitung nicht erteilt, verlängert oder revidiert werden könnte oder müsste. Demnach muss die zusätzliche Gewässerbelastung aus der Indirekteinleitung mit den Umweltzielen der WRRL übereinstimmen. Prüfumfang und -maßstäbe im Genehmigungsverfahren sind denen der Direkteinleitung gleichzusetzen. Auf Grund von Summationswirkungen, zur Vermeidung von Belastungsspitzen oder zur Erhaltung von wasserwirtschaftlich erforderlichen Reservekapazitäten kann es im Einzelfall erforderlich sein, eine Indirekteinleitung zu untersagen. Anlass für die tatbestandliche Versagung der Genehmigung kann aber nur eine konkrete Gefährdungssituation sein. 73
8. Resümee
Die WRRL stellt mit ihren Umweltzielen besondere Anforderungen an industrielle Großprojekte. Besonders deutlich wird dies bei Kohlekraftwerken, die ihr quecksilberhaltiges Abwasser aus der Rauchgaswäsche in ein Gewässer einleiten und damit die Erreichung der Umweltziele ernstlich gefährden. Jede neue Einleitung verstößt dann gegen das Verschlechterungsverbot, wenn keine kompensatorischen Bewirtschaftungsmaßnahmen getroffen werden.
Der Begriff der Verschlechterung wurde durch das Urteil des EuGH vom 01.07.2015 sowohl rechtlich als auch praktisch unbefriedigend nachgeschärft. Der zweigeteilte Begriff zielt auf die Zustandsklasseneinstufung einzelner Qualitätskomponenten ab und versteht nur in der jeweils schlechtesten Zustandsklasse jede weitere nachteilige Veränderung als Verschlechterung. Für die industriellen Zulassungsverfahren kann die weitgehende Absage an die Status-Quo-Theorie eine rechtsmethodische Erleichterung bedeuten. Solange nachteilige Veränderungen bei der Verwirklichung eines Großprojektes nicht zu einer Herabstufung einzelner Qualitätskomponenten führen, handelt es sich nicht um einen Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot, es sei denn, der Oberflächenwasserkörper befindet sich bereits in der niedrigsten Kategorie. Unklar bleibt jedoch, wann die einzelne Qualitätskomponente in ihrer Klasse absteigt. Dies liegt jedoch nicht an dem Begriff der Verschlechterung, sondern an der unzureichenden Präzision und Vollziehbarkeit des Anhang V der WRRL. Zudem besteht Klärungsbedarf in Bezug auf den chemischen Gewässerzustand, der nicht von einer Ausnahme im Sinne des § 31 Abs. 2 WHG erfasst werden kann.
Die Phasing-Out-Verpflichtung fordert die Einleitung, Emissionen und Verluste prioritär- gefährlicher Stoffe in Gewässer soweit zu begrenzen, wie dies technisch möglich und verhältnismäßig ist. Sie verlangt keine absolute Beendigung von Einträgen dieser Stoffe im Sinne einer Null-Emission, wenn eine gleichzeitige Bewirtschaftung bestehender Einleitungen insgesamt zu einer Verringerung führt. Die Tatsache, dass diese Verpflichtung nicht abschließend in nationales Recht umgesetzt wurde, entbindet die zuständigen Behörden nicht von der diesbezüglichen Prüfung.
Die Regelungen der WRRL lassen mit Hilfe des Ausnahmeregimes hinreichend Spielraum um auch in Zukunft eingriffsintensive Großprojekte zuzulassen. Die Auslegung und Anwendung der Ausnahme gemäß § 31 Abs. 2 WHG ist überdies nicht klar. Die Reichweite der Ausnahmemöglichkeit in Bezug auf die physischen Veränderungen, die Einbeziehung von Ausgleichsmaßnahmen in Gewässern und das Verhältnis von Ausnahmen zu den Bewirtschaftungs- und Maßnahmenprogrammen ist nicht abschließend geklärt und dürfte auch in Zukunft Gegenstand weiterer rechtswissenschaftlicher Auseinandersetzungen bleiben.
9. Literatur
Czychowski / Reinhardt. (2014). Wasserhaushaltsgesetz - WHG - Kommentar, 11. neubearbeitete Auflage. München: C.H. Beck.
Dieckmann, Riese. Verbot der Einleitung von Industrieabwässern? Die Reichweite der Phasing-Out-Verpflichtung der Wasserrahmenrichtlinie. UPR 6/2011, S. 212 ff.
Durner. Anmerkungen zum EuGH-Urteil vom 01.07.2015 - C-461/13 - "Weservertiefung".
DVBl 16/2015, S. 1049 ff.
Faßbender. Das Verschlechterungsverbot im Wasserrecht - aktuelle Rechtsentwicklungen. ZUR 4/2016, S. 195 ff.
Franzius. Die Mutter aller Wasserrechtsfälle. ZUR 12/2015, S. 643 ff.
Fritsch, Dallhammer. Verschlechterungsverbot - Aktuelle Herausforderungen an die Wasserwirtschaftsverwaltungen. ZUR 6/2016, S. 340 ff.
Füßer, Lau. Wasserrechtliches Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot nach dem Urteil des EuGH zur Weservertiefung. NuR 2015, S. 589 ff.
Ginzky. Das Verschlechterungsverbot nach der Wasserrahmenrichtlinie. NuR 30/2008, S.
147 ff.
OVG Hamburg. Urteil vom 18.01.2013 - Akz. 5 E 11708. ZUR 6/2013, S. 357 ff. von Keitz, Rumm. (2009). Handbuch der EU-Wasserrahmenrichtlinie: Inhalte,
Neuerungen und Anregungen für die nationale Umsetzung. Erich Schmidt Verlag GmbH & Co.
Europäische Kommission, (2009). Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive, Guidance Document No. 20. Brüssel.
Laskowski. Kohlekraftwerke im Lichte der Wasserrahmenrichtlinie. ZUR 3/2013, S. 131 ff. Laskowski. Zur Rechtmäßigkeit des Braunkohlenplan-Entwurfs "Welzow-Süd" nach der
EU-Wasserrahmenrichtlinie.
Möckel. Bewirtschaftung von Bundeswasserstraßen gemäß Wasserrahmenrichtlinie.
DVBl 10/2010, S. 618 ff.
Reinhardt. Das Verschlechterungsverbot der Wasserrahmenrichtlinie in der Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs. UPR 9/2015, S. 321ff.
Reinhardt, Giesberts. (2012). Beck'scher Online-Kommentar Umweltrecht. München:
C.H. Beck.
Schulte, Kloos. Europäisches Umweltrecht und das Ende der Kohlekraftwerksnutzung - Zur unmittelbaren Wirkung des Phasing-Out-Ziels im deutschen Recht. DVBl 16/2015, S. 997 ff.
Schütte, Warnke, Wittrock. Die Ausnahme vom Verschlechterungsverbot: rechtliche und praktische Lösungsvorschläge. ZUR 4/2016, S. 215 ff.
Statistisches Bundesamt (2002). Güterverkehrsdichte der See- und Binnenschifffahrt 2000 auf dem Hauptnetz der Bundeswasserstraßen. URL: www.wsv.de/service/karten/bundeseinheitlich/pdf/w172b.pdf (12.12.2016)
Umweltbundesamt. (2016). Die Wasserrahmenrichtlinie, Deutschlands Gewässer 2015.
Dessau.
Verschlechterung des Zustands eines Oberflächenwasserkörpers, Art. 4 RL 2000/60/EG..
ZUR 10/2015, S. 546 ff.
1 Richtlinie 2000/60/EG des europäischen Parlamentes und des Rates vom 23.10.2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, ABl. EG 2000, Nr. L 327 S. 1
2 Kessler, in: Rumm / von Keitz / Schmalholz (Hrsg.), Handbuch der EU-Wasserrahmenrichtlinie, 2. Aufl., 2009, S. 11
3 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Fassung aufgrund des am 1.12.2009 in
Kraft getretenen Vertrages von Lissabon, Konsolidierte Fassung bekanntgemacht im ABl. EG Nr. C 115 vom 9.5.2008, S. 47
4 BGBl. Jg. 2002, T. I, Nr. 37, S. 1914, berichtigt S. 2711
5 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04.08.2016 (BGBl. I S. 1972)
6 BGBl. Jg. 2009, T. I, Nr. 51, S. 2585
7 Vgl. dazu die Begründung der Bundesregierung zu ihrem Gesetzentwurf vom 17.03.2009, BT- Drs. 16/12275, S. 59 und 65.
8 EuGH, Urteil vom 11.09.2014, Rechtssache C-525/12
9 Dazu ausführlich: Schulte / Kloos, Europäisches Umweltrecht und das Ende der Kohlekraftwerksnutzung - Zur unmittelbaren Wirkung des Phasing-Out-Ziels aus Art. 4 Abs. 1 a) iv) WRRL im deutschen Recht, DVBl 16/2015, S. 997 ff.
10 Bundeswasserstraßengesetz in der Fassung vom 23.05.2007 (BGBl. I S. 963), zuletzt geändert durch Artikel 4 Abs. 118 des Gesetzes vom 18.07.2016 (BGBl. I S. 1666)
11 BVerwG, Urteil vom 28.06.2007, Az.: 7 C 3.07
12 Von den etwa 7.350 km langen Bundesbinnenwasserstraßen sind etwa 75% Flüsse und 25% Kanäle, vgl. dazu Statistisches Bundesamt, Güterverkehrsdichte der See- und Binnenschifffahrt 2000 auf dem Hauptnetz der Bundeswasserstraßen, 2002, www.wsv.de/service/karten/bundeseinheitlich/pdf/w172b.pdf
13 Vgl. dazu auch Reinhardt, Das Verschlechterungsverbot der Wasserrahmenrichtlinie in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, UPR 9/2015, S. 321 ff. und Faßbender, Das Verschlechterungsverbot im Wasserrecht - aktuelle Rechtsentwicklungen, ZUR 4/2016, S. 195 ff.
14 dazu auch Möckel, Bewirtschaftung von Bundeswasserstraßen gem. Wasserrahmenrichtlinie, DVBl. 2010, S. 618 - 625, 622 f.
15 Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. publiziert technische Regelwerke für die Bereiche Kulturbau, Bodenschutz, Abwasser- und Abfalltechnik. Diese Regelwerke enthalten Aussagen zu Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung und Überprüfung von Anlagen sowie zur nachhaltigen Nutzung von Wasser und Boden.
16 Abwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.06.2004 (BGBl. I S. 1108, 2625), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 01.06.2016 (BGBl. I S. 1290)
17 Vgl. Art. 2 Nr. 17 und Nr. 1.4.2 des Anhangs V der WRRL
18 OVG Lüneburg, Urteil vom 20.11.2014, Az.: 13 LC 140/13
19 Vgl. auch Czychowski/Reinhardt, WHG, Kommentar, 11. neubearbeitete Auflage, C.H. Beck 2014, § 83 Rn. 4, 9
20 OVG Hamburg, Urteil vom 13.01.2013, Az.: 5 E 11/08 und dazu allgemein auch Elgeti, Das Ziel des guten Zustandes - Ermessen der Behörden?, W+B 3/2015, S. 137
21 Vgl. Verschlechterung des Zustands eines Oberflächenwasserkörpers, Art. 4 RL 2000/60/EG, ZUR 10/2015 S.546
22 Durner, Anmerkungen zum EuGH, Urt. v. 01.07.2015 - C-461/13 - "Weservertiefung", DVBl. 2015/16, S. 1049
23 EuGH-Urteil vom 11.09.2012, Rechtssache C-43/10
24 BVerwG, Beschluss vom 16.09.2014 - Az. 7 VR 1.14
25 OVG Hamburg, Urteil vom 18.01.2013 - Az. 5 E 11708, ZUR 6/2013, S. 357
26 BVerwG, Urteil vom 11.07.2013 - Az. 7 A 20.11
27 Vgl. BVerwG, DVBl. 2013, S. 1450
28 EuGH-Urteil vom 01.07.2015, Rechtssache C-461/13
29 Insbesondere Richtlinie 2008/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik, in deutsches Recht transformiert durch Erlass der Verordnung zum Schutz von Oberflächengewässern (Oberflächengewässerverordnung – OGewV) vom 20.06.2016 (BGBl. I S. 1373)
30 Laskowski, Kohlekraftwerke im Lichte der EU-Wasserrahmenrichtlinie, ZUR 3/2013, S. 131 ff.
31 vgl. Fn. 19, § 27, Rn. 14
32 EuGH-Urteil vom 01.07.2015, Rechtssache C-461/13
33 Europäische Kommission, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive, Guidance Document No. 20, 2009, S. 25
34 vgl. Art. R212-213, Code de I´environnement (Frankreich)
35 BVerwG, Urteil vom 11.08.2016, Az.: 7 A 1.15, Rn. 169
36 so auch Rechenberg in: Giesberts/Reinhardt, BeckOK 2012, WHG, § 27 Rn. 7; Ginzky, NuR 2008, S. 147ff
37 Richtlinie 2008/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien des Rates 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG und 86/280/EWG sowie zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG (ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 84)
38 EuGH-Urteil vom 01.07.2015, Rechtssache C-461/13, Rn. 29ff., 51, 71
39 EuGH-Urteil vom 01.07.2015, Rechtssache C-461/13, Rn. 55
40 EuGH-Urteil vom 01.07.2015, Rechtssache C-461/13, Rn. 62
41 EuGH-Urteil vom 01.07.2015, Rechtssache C-461/13, Rn. 65
42 EuGH-Urteil vom 01.07.2015, Rechtssache C-461/13, Rn. 68
43 Vgl. dazu Reinhardt, Das Verschlechterungsverbot der Wasserrahmenrichtlinie in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, UPR 9/2015, S. 321 ff.
44 Fn. 42
45 Nr. 1.2.1 Anhang V WRRL
46 Fn. 43, S. 327
47 Vgl. Nr. 1.4.3 Anhang V WRRL
48 Vgl. Faßbender, Das Verschlechterungsverbot im Wasserrecht - aktuelle Rechtsentwicklungen, ZUR 4/2016, S.195 ff., 201 f.
49 Vgl. dazu auch Franzius, Die Mutter aller Wasserrechtsfälle, ZUR 2015, S. 643 ff., 646 f. und Dallhammer/Fritsch, Verschlechterungsverbot - Aktuelle Herausforderungen an die Wasserwirtschaftsverwaltungen, ZUR 6/2016, S. 340 ff., 346 f.
50 Entscheidung Nr. 2455/2001/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2001 zur Festlegung der Liste prioritärer Stoffe im Bereich der Wasserpolitik und zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG
51 Vgl. Art. 2 Nr. 29 WRRL; Erwägungsgrund der Entscheidung Nr. 2455/2001/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 20.11.2001 zur Festlegung der Liste prioritärer Stoffe im Bereich der Wasserpolitik und zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG
52 OVG NRW, Urteil vom 01.12.2011, Az.: 8 D 58/08.AK (Trianel), Rn. 461 - 463
53 Fn. 19, § 13, Rn. 99
54 Vgl. dazu auch Schulte, Kloos, Europäisches Umweltrecht und das Ende der Kohlekraftwerksnutzung - Zur unmittelbaren Wirkung des Phasing-Out-Ziels aus Art. 4 Abs. 1 a) iv) WRRL im deutschen Recht-, DVBl. 16/2015, S. 997 ff., Riese, Dieckmann, Verbot der Einleitung von Industrieabwässern? Die Reichweite der Phasing-out-Verpflichtung der Wasserrahmenrichtlinie, UPR 6/2011, S. 212 ff. und Laskowski, Kohlekraftwerke im Lichte der EU- Wasserrahmenrichtlinie, ZUR 3/2013, S. 131 ff., 135 ff.
55 Richtlinie 2006/118/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung
56 Vgl. Laskowski, Zur Rechtmäßigkeit des Braunkohlenplan-Entwurfs "Welzow-Süd" nach der EU- Wasserrahmenrichtlinie, S. 16 f.
57 Vgl. Fn 19, § 31, Rn. 13
58 BVerwG, Beschluss vom 02.10.2014, Akz.: 7 A 14.12, Rn. 5 f.
59 OVG Hamburg, Urteil vom 18.01.2013, Akz.: 5 E 11/08 (Kraftwerk Moorburg)
60 BVerwG, Urteil vom 09.07.2008, Az.: 9 A 14/07 für den Artenschutz
61 Fn. 19, § 31, Rn. 14
62 Füßer / Lau, Wasserrechtliches Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot nach dem Urteil des EuGH zur Weservertiefung, NuR 2015, S. 589 ff., 592
63 Fn. 33, S. 9
64 So Füßer / Lau, Fn. 60, auch Franzius, Die Mutter aller Wasserrechtsfälle, ZUR 2015, S. 643 ff.
65 Vgl. Schütte / Warnke / Wittrock, Die Ausnahme vom Verschlechterungsverbot: rechtliche und praktische Lösungsvorschläge, ZUR 4/2016, S. 215ff., S. 216 und Dallhammer / Fritsch, Verschlechterungsverbot - Aktuelle Herausforderungen an die Wasserwirtschaftsverwaltung, ZUR 6/2016, S. 341 ff., 349
66 Fn. 19, § 31, Rn. 15
67 Fn. 33, S. 15
68 Fn. 19, § 31, Rn. 16b
69 Fn. 19, § 31, Rn. 16c
70 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 13.10.2016 (BGBl. I S. 2258, 2348)
71 BVerwG NVwZ 2010, 1291 in Fn. 19, § 31, Rn. 16a
72 Fn. 19, § 31, Rn. 17
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)?
Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wurde im Jahr 2000 erlassen und verfolgt das Ziel, die Entwicklung und Wiederherstellung der natürlichen Gewässerfunktion voranzubringen, um langfristig einen guten Zustand aller Gewässer zu erreichen.
Welche Ziele verfolgt die WRRL?
Die WRRL verfolgt im Wesentlichen folgende Ziele: Schaffung eines Ordnungsrahmens für die unionsweite Wasserwirtschaft, Vermeidung weiterer Verschlechterungen der aquatischen Ökosysteme, Förderung einer nachhaltigen Wassernutzung, Schutz der aquatischen Umwelt durch Reduzierung prioritärer Stoffe, Reduzierung der Verschmutzung des Grundwassers und Beitrag zur Minderung der Auswirkungen von Überschwemmungen und Dürren.
Wie wurde die WRRL in nationales Recht umgesetzt?
Die Umweltziele der WRRL wurden auf Bundesebene durch das Siebte Gesetz zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes vom 18.06.2002 in den §§ 27 ff. und 47 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) umgesetzt. Das Phasing-Out-Ziel des Art. 4 Abs. 1 lit. a) Ziff. iv) der WRRL wurde bisher nicht in nationales Recht umgesetzt.
Welche Anforderungen werden an Einleitungen gestellt?
Einleitungen stehen unter dem Erlaubnis- oder Bewilligungsvorbehalt im Sinne des § 8 des WHG. Die Menge und Schädlichkeit des Abwassers muss so gering wie möglich gehalten werden (§ 57 Abs. 1 Nr. 1 WHG). Es ist die gewässerseitige Situation zu berücksichtigen (Immissionsprinzip, § 57 Abs. 1 Nr. 2 WHG).
Welche Bewirtschaftungsziele gibt es im Rahmen der WRRL?
Die Bewirtschaftungsziele umfassen Verbesserungsgebot, Verschlechterungsverbot, Phasing-Out (für prioritär gefährliche Stoffe) und das Trendumkehrgebot für das Grundwasser.
Was bedeutet das Verschlechterungsverbot?
Das Verschlechterungsverbot bedeutet, dass die Bewirtschaftung eines Gewässers so erfolgen muss, dass eine Verschlechterung des ökologischen und chemischen Zustandes vermieden wird. Eine Verschlechterung liegt vor, wenn sich der Zustand mindestens einer Qualitätskomponente im Sinne des Anhangs V WRRL um eine Klasse verschlechtert. Befindet sich ein Oberflächenwasserkörper bereits in der schlechtesten Zustandsklasse, gilt jede Verschlechterung dieser Komponente als Zustandsverschlechterung.
Was ist das Phasing-Out-Ziel?
Das Phasing-Out-Ziel gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. a) Ziff. iv) WRRL zielt darauf ab, die Einleitungen, Emissionen und Verluste prioritär-gefährlicher Stoffe zu beenden oder schrittweise einzustellen.
Was ist das Trendumkehrgebot?
Das Trendumkehrgebot gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. b) WRRL bzw. § 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG fordert, dass alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen im Grundwasser umgekehrt werden müssen, wenn sie Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten sind.
Gibt es Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen?
Ja, gemäß Art. 4 Abs. 7 WRRL bzw. § 31 Abs. 2 WHG sind Ausnahmen möglich. Dies erfordert, dass eine neue Veränderung der physischen Gewässereigenschaften oder des Grundwasserstandes vorliegt, die Gründe vom übergeordneten öffentlichen Interesse sind, keine Alternativmaßnahmen zur Verfügung stehen und alle geeigneten Maßnahmen ergriffen wurden, um die nachteiligen Veränderungen des Gewässerzustands zu verringern.
Wie werden Indirekteinleitungen behandelt?
Das Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage (Indirekteinleitung) bedarf einer Genehmigung gemäß § 58 WHG, wenn in der AbwV Anforderungen festgelegt sind. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn die Anforderungen der AbwV erfüllt werden, die Erfüllung der Anforderungen an die Direkteinleitung nicht gefährdet wird und Abwasseranlagen errichtet und betrieben werden, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Anforderungen sicherzustellen.
- Quote paper
- Dipl.-Ing. (FH) Christian Terhorst (Author), 2017, Die Zulässigkeit industrieller Großprojekte im Kontext der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376639