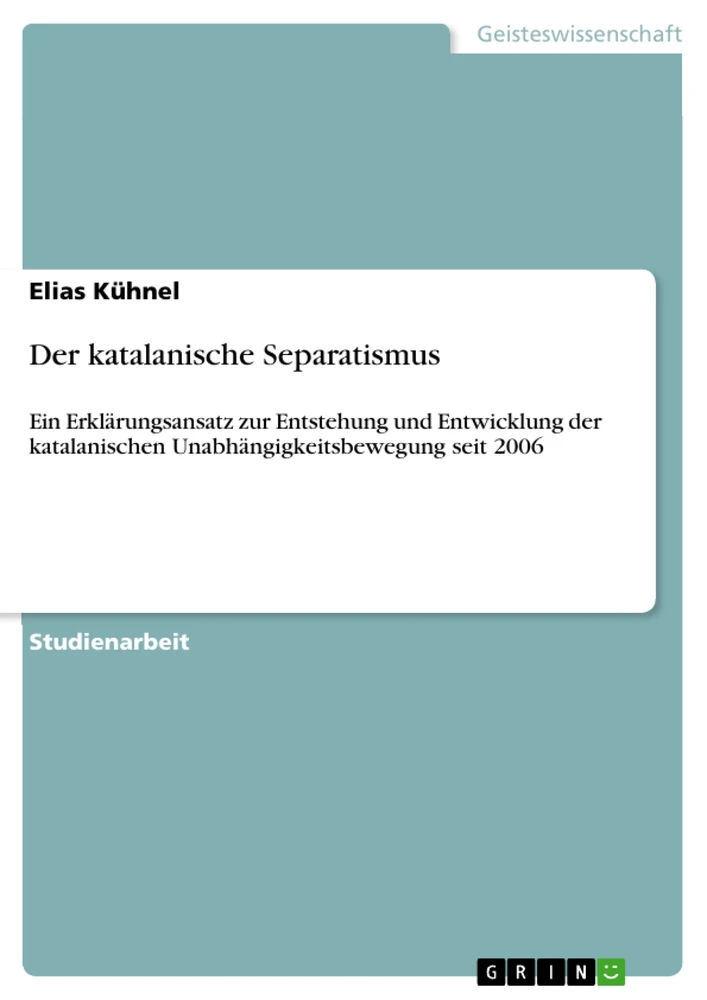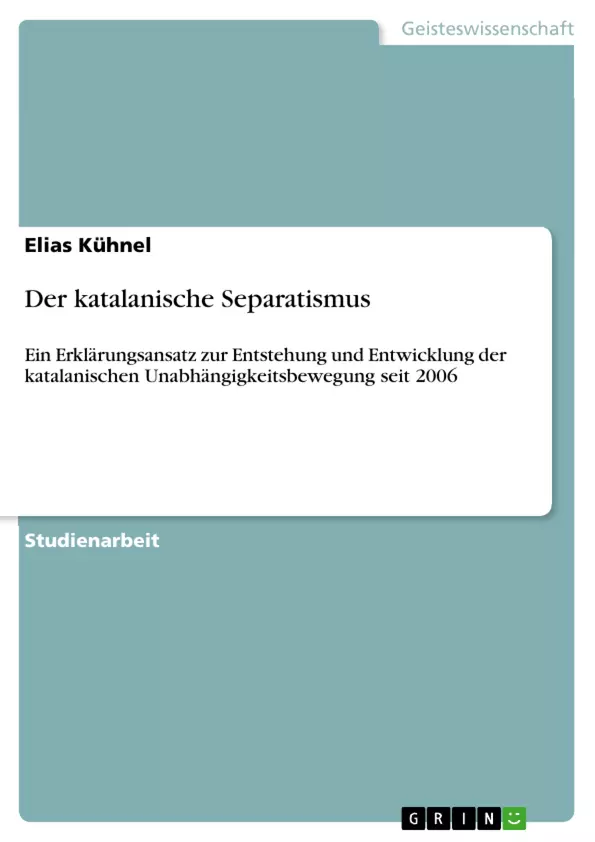In der vorliegenden Arbeit wird ein Erklärungsversuch der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung und ihrer Entwicklung seit 2006 vorgestellt. Vor allem seit der Anfechtung des neuen Autonomiestatuts Kataloniens durch die Partei Partido Popular (PP) und das spanische Verfassungsgericht konnte ein Auftrieb und eine zunehmende Institutionalisierung und Politisierung der Unabhängigkeitsbewegung verzeichnet werden. Die Spannungen zwischen Katalonien und der Zentralregierung in Madrid haben
sich auf ein hohes Maß zugespitzt. So hat die katalanische Regierung trotz eines Verbots durch das spanische Verfassungsgericht ein Unabhängigkeitsreferendum für den 01. Oktober diesen Jahres angesetzt. Es soll daher untersucht werden, welche Faktoren auf der Makroebene die individuellen Anreize für eine Beteiligung an der Unabhängigkeitsbewegung begünstigt oder auch reduziert haben. Als methodologische Grundlage fungiert das strukturell-kognitive Modell nach Karl-Dieter Opp, welches diverse andere Theorien sozialer Bewegungen integriert und in einen Mikro-Makro-Zusammenhang einfügt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsexplikation
- Nationalismus und Regionalismus
- Separatismus und Sezession
- Grundzüge der katalanischen Geschichte
- Die Entwicklung der Unabhängigkeitsbewegung
- Das integrative Erklärungsmodell nach Opp
- Erklärungsansatz zur Entstehung und Entwicklung der Unabhängigkeitsbewegung seit 2006
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung seit 2006 und zielt darauf ab, ein Erklärungsmodell zu entwickeln, das die individuellen Anreize zur Beteiligung an der Bewegung beleuchtet. Dazu wird das strukturell-kognitive Modell nach Karl-Dieter Opp herangezogen, das verschiedene Theorien sozialer Bewegungen integriert.
- Analyse der Faktoren, die die katalanische Unabhängigkeitsbewegung in den letzten Jahren verstärkt haben.
- Untersuchung der Bedingungen, die eine individuelle Beteiligung an der Bewegung fördern oder verhindern.
- Einbezug der strukturellen Veränderungen in Politik und Unabhängigkeitsbewegung.
- Bedeutung des neuen Autonomiestatuts Kataloniens und dessen Anfechtung durch die Partido Popular (PP) und das spanische Verfassungsgericht.
- Entwicklung von anfänglichen Protestbewegungen hin zu einer institutionalisierten Unabhängigkeitsbewegung mit politischem Einfluss.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage sowie die Relevanz des Themas dar. Es wird auf das geplante Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober 2017 eingegangen und der Hintergrund des Konflikts zwischen Katalonien und der spanischen Zentralregierung beleuchtet. Das zweite Kapitel erläutert wichtige Begriffe wie Nationalismus, Regionalismus, Separatismus und Sezession. Im dritten Kapitel werden die historischen Wurzeln der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung beleuchtet. Das vierte Kapitel widmet sich der Entwicklung der Bewegung in den letzten Jahren, insbesondere seit 2006. Kapitel fünf stellt das strukturell-kognitive Modell nach Opp vor und erläutert seine Anwendung auf die katalanische Unabhängigkeitsbewegung. Das sechste Kapitel präsentiert den Erklärungsansatz für die Entstehung und Entwicklung der Bewegung seit 2006. Schließlich werden im siebten Kapitel die Ergebnisse zusammengefasst und die Schlussfolgerungen gezogen.
Schlüsselwörter
Katalonien, Unabhängigkeitsbewegung, Separatismus, Sezession, Nationalismus, Regionalismus, strukturell-kognitives Modell, Karl-Dieter Opp, Anreize, Makro-Variablen, Protestbewegung, Institutionalisierung, Politisierung, Spanien, Zentralregierung, Partido Popular (PP), spanisches Verfassungsgericht.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Auslöser für den verstärkten katalanischen Separatismus seit 2006?
Ein zentraler Wendepunkt war die Anfechtung des neuen Autonomiestatuts Kataloniens durch die Partido Popular (PP) und das anschließende Urteil des spanischen Verfassungsgerichts.
Welches Modell wird zur Erklärung der Bewegung genutzt?
Methodologische Grundlage ist das strukturell-kognitive Modell nach Karl-Dieter Opp, das individuelle Anreize in einen Mikro-Makro-Zusammenhang einfügt.
Was ist der Unterschied zwischen Nationalismus und Regionalismus?
Regionalismus strebt oft nur nach mehr Autonomie innerhalb eines Staates, während Nationalismus im Kontext des Separatismus die Gründung eines eigenen, unabhängigen Staates (Sezession) zum Ziel hat.
Warum wurde die Bewegung zunehmend politisiert?
Die Spannungen mit der Zentralregierung in Madrid führten dazu, dass aus zivilgesellschaftlichen Protesten eine institutionalisierte Bewegung wurde, die schließlich das Referendum 2017 initiierte.
Welche Rolle spielen individuelle Anreize bei der Beteiligung?
Das Modell nach Opp untersucht, wie politische Unzufriedenheit, soziale Identität und die Erwartung kollektiver Güter den Einzelnen dazu bewegen, sich an der Unabhängigkeitsbewegung zu beteiligen.
- Arbeit zitieren
- Elias Kühnel (Autor:in), 2017, Der katalanische Separatismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376645